Nicht daß ich dies des Mangels halber sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen.
Elberfelder 1871 – Philipper 4,11
Nicht wegen des Mangels sage ich das; ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde.
Schlachter 2004 – Phil 4,11
Nicht, dass ich über äußere Not zu klagen hätte. Ich habe ja gelernt, in allen meinen Lebenslagen mit wenigem auszukommen.
Johannes Greber – Phil 4,11
Ich sage das nicht, als ob ich Mangel gelitten hätte; denn ich habe gelernt, mir mit dem, was ich habe, genügen zu lassen. Spr 15,16; 16,8; 1Tim 6,6; Heb 13,5.
Tafelbibel mit hinzugefügten Sachparallelstellen – Phil 4,11
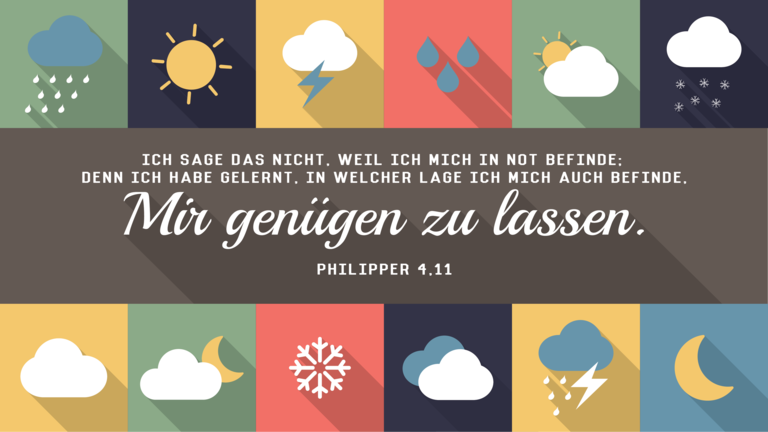
Aus der Freude, die die Sendung der Philipper Paulus machte, sollten sie nicht schließen, er klage über seine Lage oder stelle an die Gemeinde Ansprüche. Er ist ein völlig freier Mann und beherrscht jede Lage; er braucht niemand, sondern reicht mit dem aus, was er hat. Von selbst fällt niemand eine solche Selbständigkeit zu. Ich habe sie gelernt, sagt Paulus, in langer Übung und mancher Erfahrung. Nun aber geht er in jeder Lage fest und sicher seinen Weg. Muss er entbehren, so erschüttert und lähmt ihn dies nicht; er meint nicht, er habe durch sein Botenamt oder durch seinen Glauben einen Anspruch an ein behagliches Leben im Überfluss. Stehen ihm reiche Mittel zur Verfügung, so machen sie ihn nicht zum Knecht der Begehrlichkeit und von Gott los; sie ziehen ihn nicht von seiner Arbeit ab. Seine Stärke, die ihn in allem frei macht, verdankt Paulus Jesus, der ihm beständig mit seiner Kraft zur Seite steht. Er gibt es ihm, dass er für alles danken und Gott mit völliger Liebe dienen kann, so dass ihn die äußeren Dinge nie an seinem Lauf hindern. Dadurch verliert aber die Gabe der Gemeinde für ihn ihren Wert nicht. Die Entbehrung drückt, und Paulus dankt denen, die sie ihm abnehmen.
Schlatter – Erläuterungen zum Neuen Testament
Paulus, dessen Leben und Werk in unserer Zeit mehr und mehr die Aufmerksamkeit vieler Kreise auf sich ziehen, hat in seinen Schriften verschiedene Male ein Wort gebraucht, das in den Kriegsjahren auf wirtschaftlichem Gebiet eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Es ist das Wort «Autarkie», womit man das Streben andeuten wollte, das Land selbständig zu machen, unabhängig von allen andern. Damit wird also ein Sichbegnügen mit dem Vorhandenen zum Ausdruck gebracht.
Halte fest 1958
Aber lange vor unserer Zeit schon wurde dieses Wort von den Griechen viel gebraucht, wohl in dem Sinn: Der Mensch soll seine Gemütsverfassung nicht durch die Umstände beeinflussen lassen. Er muss über ihnen stehen. Er soll sich begnügen mit dem, was er ist und hat.
Dieses Wort und diesen Gedanken hat Paulus in das christliche Leben herübergenommen. Wer wirklich auf Gott, auf den lebendigen Gott vertraut, muss sich nicht durch die äusseren Lebensumstände beeinflussen lassen, sondern kann allezeit guten Mutes sein.
Es ist aber wahrlich nicht leicht, dies in die Praxis umzusetzen, wenn alles, was uns umgibt, gegen uns zu sein scheint. Darum teilt Paulus den Philippern mit, dass er diese Lektion auch selber habe lernen müssen (Phil 4,11). Er sagt nicht, hochmütig und von sich selbst eingenommen, er habe sich zu diesem hohen Standpunkt hinaufgearbeitet, nein, mit einem niedriggesinnten Herzen bekennt er, dass er durch Lebenserfahrung gelernt habe, sich zu begnügen. Ich habe einen Lehrmeister, so sagt er, der mich in allem unterwiesen hat: den Überfluss nicht zu missbrauchen oder auch mit frohem Herzen mich in den Mangel zu schicken. Dieses Sichbegnügen war das Geheimnis seines christlichen Lebens, in das er durch Christus eingeweiht worden war, der ihm gleichzeitig auch die Kraft dazu darreichte. Da der Apostel nun diese Lektion gelernt hatte, konnte er auch andere in dieser Tugend unterweisen. War er in dieser Lebenskunst nicht selber ein Vorbild? Im Gefängnis zu Rom schrieb er unter andern diesen Brief an die Philipper, der vom Anfang bis zum Ende von echter Freude zeugt, und worin er sich am Schluss vorstellt als einer, der nichts nötig hat, weil er alles empfangen hat. Timotheus unterweist er, dass «wenn wir Nahrung und Bedeckung haben», wir uns daran genügen lassen sollen, und dass die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ein grosser Gewinn sei.
Die griechischen Moralphilosophen priesen unter dem Einfluss des Gedankengutes der Stoa die Menschen, die mit wenigem ebenso zufrieden waren wie mit vielem. (Die Kyniker achteten, um ihre Zufriedenheit mit wenigem beweisen zu können, eigens darauf, immer nur das Nötigste zu besitzen.) Es hieß, dass der Weise keinen Menschen brauche außer sich selbst, also absolut autark sei. Paulus gibt hier zwar der Zufriedenheit in allen Lebensumständen Ausdruck (V. 11-12 ), wie sie von den Philosophen der Stoa und anderen gefordert wurde, den Gedanken der Standhaftigkeit und Geduld um Gottes willen (V. 13 ) hatten jedoch bereits die alttestamentlichen Propheten, die jüdischen Märtyrer und andere Diener Gottes in ihrem Leben verwirklicht.
Craig Keener – Kommentar zum Umfeld des Neuen Testaments
Der »Überfluss« des Apostels war nach modernen Maßstäben wohl eher bescheiden; Kunsthandwerker hatten zwar ein besseres Auskommen als die Armen, doch ihr Lebensstandard lag weit unter dem, der der heutigen Mittelschicht der westlichen Welt bzw. der Oberschicht der Antike selbstverständlich ist bzw. war. (»Mäßigung« – der Mittelweg zwischen zwei Extremen – war ein Hauptaspekt der griechischen Tugendvorstellung, vor allem bei Aristoteles , der auch in die Ethik der jüdischen Diaspora Eingang fand. Paulus strebt keinen solchen Mittelweg an; wie die besten der griechischen Philosophen ist er in jeder Lage zufrieden. Seine Formulierungen in dieser Passage erinnern deshalb eher an die Philosophie der Stoa und der Kyniker als an die der [aristotelischen] Peripatetiker. Im Gegensatz zu denen, die völlige Autarkie anstrebten, gründet sich seine »Selbstgenügsamkeit« jedoch ganz und gar auf Christus, der in ihm wirkt).
Heute sieht man diese pharisäische Lehre in jenen Kreisen, die das Konzept des „positiven Bekenntnisses“ oder des „name-it-and-claim-it“ lehren, bei dem die Leute herumgehen und Dinge wie Cadillacs oder Mercedes oder Millionen-Dollar-Häuser für sich beanspruchen. Es ist klar, dass ihr Gott in Wirklichkeit der Mammon ist, nicht Jeschua der Messias. Wenn ihr Gott der Herr Jesus wäre, würden sie in allen Dingen zufrieden sein, wie Paulus es war (Philipper 4:11). Ob er nun reich oder arm war, Paulus war ganz zufrieden in dem Wissen, dass alles, was er vom Herrn erhielt, der vollkommene Wille Gottes für ihn zu dieser Zeit war. Er war bereit, alles für den Messias aufzugeben.
Arnold Fruchtenbaum – Mammon der Ungerechtigkeit
Aber wenn wir darauf bestehen, dass Reichtum ein Zeichen der göttlichen Gunst ist, wie es leider einige bekannte religiöse Führer getan haben, wird das bei uns das Gleiche bewirken wie bei den Pharisäern. Wir werden anfangen, auf die materiellen Dinge zu achten und uns dem Reichwerden hingeben, weil das ein Zeichen der göttlichen Gunst ist. Am Ende werden wir nicht mehr Gott dienen, sondern dem Mammon.
Paulus hat es für seine Person grundsätzlich abgelehnt, sich von den Gemeinden unterhalten zu lassen. In jener Zeit zahlreicher und oft recht zweifelhafter Wanderredner (s.o.S.132) wollte er seine Verkündigung von vornherein gegen jeden Verdacht eigennütziger Hintergründe schützen. Darum erarbeitete er sich das Wenige, das er zum Leben brauchte, mit eigener Hand. Entbehrungen, Armut und Leiden gehörten ihm unabtrennbar zum apostolischen Dienst (1 Kor 4,9ff.; 2 Kor 6,4ff.). Nur den Philippern erlaubte er es, eine „Rechnung auf Gegenseitigkeit“ („Abrechnung des Gebens und Nehmens“ ist der damalige geschäftliche Fachausdruck dafür) aufzumachen. Ja, so wurden die Philipper „Teilhaber“ in seinem „Geschäft“! Sonst bleiben die Gemeinden allein die Empfangenden und Paulus allein der Gebende, so klar Paulus das Recht der Boten auf Erhaltung durch die Gemeinden betonte (1 Kor 9,4-14). Welche Gründe Paulus dazu veranlassten, bei den Philippern eine Ausnahme zu machen, erfahren wir nicht. Es wird das mit zu der besonderen Herzlichkeit der Liebe gehören, die wir im ganzen Brief von Anfang an spüren. Eben darum ist es so lieb ausgedrückt, wenn Paulus diese Bevorzugung seiner Geliebten in das Bild vom „Geschäft“ fasst: Ihr allein tratet in das Geschäft mit gegenseitiger Abrechnung mit ein! Für uns aber ist es wichtig, dass Paulus trotz seiner Beharrlichkeit in dieser Sache den Korinthern gegenüber (2 Kor 11,7-12; 12,13) kein Mann bloßer „Prinzipien“ war, sondern die Freiheit des Handelns behielt. So haben die Philipper ihn schon in Thessalonich „ein-, zweimal“ unterstützt. Diese Mitteilung legt übrigens nahe, dass wir uns ein falsches Bild machen, wenn wir aus Apg 17,2 schließen, Paulus sei nur drei Wochen in Thessalonich geblieben; sein Aufenthalt muss doch wohl etwas länger gedauert haben, wenn in dieser Zeit mehrfach eine Unterstützung aus Philippi an ihn gelangte. Paulus bezeichnet jene Tage als „Anfang des Evangeliums“. Hier ist wieder wie in Phil 4, 3 das Wort „Evangelium“ nicht nur für den Inhalt der Botschaft, sondern auch für ihr Wirksamwerden benutzt, so dass geradezu die Bestimmung einer „Zeit“ daraus wird (s. o. S. 141). In ähnlicher Weise könnte etwa ein Vater seinem Sohn schreiben: „Im Anfang der Studien riet ich Dir …“ (Ewald). Aus 2 Kor 11,8.9 geht hervor, dass die Philipper ihre Unterstützung auch während der Arbeit des Paulus in Korinth fortgesetzt haben.
Wuppertaler Studienbibel
Aber nun hatte Paulus lange nichts mehr von der Gemeinde erhalten. Darum freut er sich „mächtig“ – er braucht hier ein Wort, das stärker ist als unser abgegriffenes „sehr“ -, dass Epaphroditus eine erhebliche Gabe mitbrachte. Die Philipper ließen das „Denken an ihn“ – es ist das Wort „Denken“, „Bedacht sein“, das in unserm Brief oft vorkam und hier das „Sorgen für ihn“ bezeichnet – wieder „aufblühen“ oder „aufgrünen“. Benutzt ist das Bild der Pflanze, die nach der Winterzeit wieder „ausschlägt“ oder „aufblüht“. Auf das „Denken an ihn“ waren sie freilich immer bedacht, das weiß Paulus. Aber es fehlte ihnen der „kairos“, die geeignete Zeit, die Gelegenheit zum Helfen. Schon 2 Kor 8,2 hatte Paulus die in der Kollektensache säumigen Korinther an die Armut der Mazedonier im Zusammenhang mit schweren Bedrängnissen der Gemeinde erinnert. So waren sie zur Unterstützung des Apostels nicht in der Lage. Nun hat Paulus wieder eine reiche Gabe bekommen, die Epaphroditus aus Philippi mitbrachte (s.o. S. 16). Über ihre tatsächliche Höhe erfahren wir nichts. Paulus bescheinigt, „alles erhalten zu haben“, und versichert, nun „Überfluss zu haben“ und „erfüllt“ zu sein. Das sind freilich sehr relative Begriffe! Der an Mangel und Entbehrung Gewöhnte hält für „Überfluss“ und „Fülle“, was dem Verwöhnten recht bescheiden vorkommen mag. Die Liebe eines Paulus hat die „Größe“ der Gabe sicher mehr an der Armut der Geber als an dem Umfang seiner Bedürfnisse gemessen.
Aber ihm liegt überhaupt nicht an der „Gabe“ als solcher, auch wenn er sich „mächtig“ an ihr freuen kann. Ihm liegt an der „Frucht“. Der Mensch ist von Natur gierig oder doch wenigstens ängstlich im Festhalten seines Besitzes. Wenn er zu geben vermag, und dies noch aus eigener schwieriger Lage heraus (die Gemeinde stand noch immer im Kampf 1,27-30), dann zeigt sich darin die Wirkung des Wortes, das den Menschen zum Vertrauen auf den lebendigen Gott gebracht und das Herz zur Liebe befreit hat. Solche „Frucht“ begehrt Paulus. Wir sahen es mehrfach in unserm Brief, wie er nicht nur eine Gnade kennt, die als verheißungsvoller Bogen über einem unverändert grauen Lebe steht, sondern eine solche, die das wirkliche Leben umwandelt und für Gott tatsächlich fruchtbar macht. Er hat eben das geschäftliche Bild verwendet. So gebraucht er es nun gleich noch einmal und sagt: Diese wachsende Frucht kommt „auf eure Rechnung“. Euer Konto steigt dadurch. In feiner Weise verbindet Paulus den Dank für das große Geschenk mit der vollen Unabhängigkeit den Philippern gegenüber: Sie erhöhen nur ihren eigenen Kontostand, wenn sie die Frucht bringen, die von einer Pflanzung des Evangeliums erwartet werden darf. Der eigentliche Grund der Freude des Apostels liegt nicht in der Hilfe, die er selbst erfährt, sondern in dem Gedeihen der Gemeinde, das in solchen Gaben zum Ausdruck kommt.
Denn für seine Person hat Paulus gelernt, „in der Lage, in der er ist, selber auszukommen“. Und nun beschreibt er eine Lebenshaltung, die wieder mit manchem „griechischen“ oder „philosophischen“ Ideal verwandt erscheint, die aber in Wahrheit diese „Ideale“ weit unter sich lässt und selber nicht ein „Ideal“, sondern einfache Wirklichkeit ist. Wenn der Mensch sein „Menschsein“ entdeckt, dann werden ihm seine Triebe zur Not, die ihn zum bloßen Naturwesen stempeln und hart an die Verhältnisse binden. Wird er wahrhaft „Mensch“ nicht erst dann, wenn er die Triebe möglichst abtötet und sich aus der Knechtschaft der Verhältnisse befreit? „Frei“ ist der Mensch erst, wenn er die „Autarkie“ besitzt, die Fähigkeit, sich selbst zu genügen, „selber auszukommen.“ Aber nur der „Genügsame“ hat sie! Darum kommt der Philosoph stoisch-kynischer Richtung zur „Askese“, zur möglichst armen und primitiven Lebensgestalt.
Zufriedenheit:-
The Biblical Illustrator: Philipper
I. IHRE NATUR. 1. Sie ist der Unzufriedenheit entgegengesetzt, und indem sie sich den Härten des Lebens unterwirft, entzieht sie ihnen die Hälfte ihrer Macht. Sie ist zu vernünftig, um nach Unmöglichkeiten zu streben oder die Unzulänglichkeiten des Lebens durch Verdrießlichkeit zu vergrößern. Ein gerechter Geist ist dazu notwendig, einer, der die Dinge sieht, wie sie sind, statt durch das verzerrende Medium eines verbitterten Auges. Die Ungerechtigkeit des Geistes, die mit Stolz einhergeht, erzeugt Verdrießlichkeit, und die, die mit Ehrgeiz einhergeht, Launenhaftigkeit. 2. Es ist jedoch nicht Gleichgültigkeit oder Dummheit, obwohl diese manchmal als solche durchgehen. Ein Verstand, der zu träge ist, um zu denken, ein Herz, das zu gefühllos ist, um zu fühlen, eine Seele, die zu selbstsüchtig ist, um beides zu tun, hat weder Sensibilität noch Sinn, um sich zu beschweren. Aber die Zufriedenheit kann fühlen, hoffen, seufzen; aber ihre Gefühle dürfen nicht in Verdrossenheit ausarten, und ihre Seufzer werden oft gegen Lächeln ausgetauscht. Wenn sie nicht haben kann, was sie möchte, wird sie nicht über ihre Enttäuschungen grübeln, sondern sie durch süße Unterwerfung aufhellen. 3. Es hat keine Verwandtschaft mit Fatalismus. Wenn die Rufe der Pflicht mit dem Verlangen nach gehegter Sündhaftigkeit in Konflikt geraten, ist es nicht ungewöhnlich, dass ein törichter Sünder sagt, dass seine Pläne und Handlungen nichts ändern können; er ist zu faul, um überhaupt zu planen oder zu handeln; so nennt er sein Laster fälschlicherweise die Tugend der Zufriedenheit. Paulus‘ Zufriedenheit aber bestand darin, zu arbeiten, zu planen, zu beten. Er fügte sich nicht vorher, weil er es nicht vorher wusste; aber als das Ereignis kam, sagte er: „Ich bin zufrieden“, d.h. mit dem festgestellten Willen seines Meisters.
II. DIE ART UND WEISE DER ERLANGUNG. „Ich habe gelernt“, d.h. als eine Lektion, und auch mit Schwierigkeiten. Wenn wir seinen Erfahrungen nachgehen, finden wir: 1. eine Sensibilität für die göttliche Hand. Er sah Gott in seinen Prüfungen und sagte: „Dein Wille geschehe.“ Es ist etwas ganz anderes, sich unter die Übel des Lebens zu fügen, weil man ihre göttliche Bestimmung erkennt, als sich aus Verdrossenheit oder Dummheit zu fügen. Sieh also in ihnen den Gott aller Weisheit und Güte. 2. Er hoffte auf Gott. Ohne Hoffnung kann kein Mensch zufrieden sein. Diese führt zur Zufriedenheit in der sicheren Erwartung der Befreiung, wenn nicht hier, so doch in der Zukunft. „Ich weiß, wem ich geglaubt habe“, &c. 3. Er hatte seinen Schatz im Himmel; und wenn wir den haben, können wir sagen: „Unsere leichte Bedrängnis, die nur für einen Augenblick ist“, &c., und so zufrieden sein. Und selbst im Wohlstand ist dieser Trost nötig; denn inmitten von überreichem Reichtum gibt es Unzufriedenheit. Etwas mehr ist nötig. 4. Er hatte Erfahrungen, die ihn prüften. Seine Zufriedenheit ergab sich nicht aus dem Unterricht, dem Glauben, der Hoffnung, der himmlischen Gesinnung, allein oder zusammen. Seine schmerzlichen Erfahrungen gaben seiner Zufriedenheit Kraft, und machten die folgenden Prüfungen leichter und bereitwilliger. Sie lehrten ihn zu sagen: „Wenn ich schwach bin, bin ich stark; ich vermag alles durch Christus“, &c.
III. DIE GRÜNDE, DIE IHN BESTÄRKEN. 1. Die Macht, die unseren Zustand zugewiesen hat. Gott regiert. Eine unergründliche Weisheit und übergeordnete Vorsehung ist am Werk. Wie unvernünftig ist es dann, sich zu beklagen, wenn Schwierigkeiten kommen. Es ist entweder eine verdiente Strafe oder eine heilsame Disziplinierung. Unzufriedenheit ist eine Ungerechtigkeit in hohen Kreisen. Nimm also deinen glücklichen Platz ein, es ist die Bestimmung deines himmlischen Vaters in Liebe. 2. Zufriedenheit ist Sicherheit. Wie viele haben unwiederbringlich gelitten, weil sie von dem ihnen zugewiesenen Weg abgewichen sind, oder weil sie es sich wünschten und danach strebten. Die bescheidenste Hütte ist besser als ein vom Fieber befallener oder erdbebengeschüttelter Palast. 3. Zufriedenheit steigert unsere Freude und vermindert unser Elend. Übel werden durch geduldiges Ausharren leichter, und Vorteile werden durch Unzufriedenheit vergiftet. 4. Das Elend des Lebens ist tief und umfangreich genug, ohne dass man es noch vergrößern muss. 5. Zufriedenheit ist das Mittel, um neue Lektionen über Gott zu erhalten. (I. S. Spencer, D.D.) Zufriedenheit bedeutet Selbstgenügsamkeit. Hier ist es nicht unbedingt so zu verstehen, als ob es Unabhängigkeit in der Natur lehrte, nichts außerhalb von sich selbst zu wollen. Paulus wollte Gott oder seine Vorsehung nicht ausschließen, sondern unterstellte sie – „nicht als ob wir aus uns selbst genügten, sondern unsere Genügsamkeit ist von Gott.“ Er wünschte oder vermisste nicht mehr als das, womit Gott ihn versorgt hatte. Sein Wille entsprach seinem Zustand, sein Verlangen überstieg nicht seine Kraft. Das Ziel der Zufriedenheit ist also der gegenwärtige Zustand der Dinge, was auch immer es sein mag, in den Gott uns gesetzt hat. Diejenigen, die das größte Vermögen haben, sind am meisten geneigt, die kleinsten Dinge zu respektieren, während ein armer Stand leicht durch den Zuwachs von wenig getröstet wird. Der formale Gegenstand mag ein Zustand sein, der unserem Sinn widerspricht – aber da alle Menschen mehr oder weniger in einem solchen Zustand sind, kann jeder Zustand der Gegenstand der Zufriedenheit sein, und Prinz und Bauer müssen diese Lektion gleichermaßen lernen. Wenden wir uns nun den Handlungen zu, in denen die Praxis bestand.
I. WAS UNSERE MEINUNGEN UND URTEILE BETRIFFT. Zufriedenheit erfordert, dass-1. wir glauben sollten, dass unser Zustand, wie auch immer er sein mag, von Gott bestimmt ist, oder zumindest, dass er ihn nach seinem Wohlgefallen zulässt. 2. Daher sollten wir alles, was geschieht, als durch und durch gut und Gottes Bestimmung würdig beurteilen und keine harten Gedanken über ihn hegen. 3. Wir sollten sogar in unserem Geist davon überzeugt sein, dass nach Gottes Absicht alle Ereignisse nicht nur zum Wohl der Dinge im Allgemeinen, sondern auch zu unserem im Besonderen beitragen. 4. Daher sollen wir glauben, dass unser gegenwärtiger Zustand alles in allem der beste ist – besser, als wir es uns selbst hätten ausdenken können.
II. WAS DIE ABLAGERUNGEN DES WILLENS UND DER ZUNEIGUNG BETRIFFT. 1. Wir sollten alle Vorkommnisse, wie schlimm sie auch sein mögen, mit völliger Unterwerfung unter den Willen Gottes betrachten. 2. Wir sollten alle Dinge mit beständiger Ruhe und Gelassenheit des Geistes ertragen und jene Exzesse der Leidenschaft unterdrücken, die der Sinn für Dinge, die uns widerwärtig sind, zu erregen pflegt. 3. Wir sollten die schlimmsten Ereignisse mit süßem Frohsinn ertragen und nicht der Entmutigung erliegen. „Wie ein Trauernder und doch immer fröhlich.“ 4. Wir sollten uns mit Glauben und Hoffnung auf Gott verlassen und auf die Beseitigung oder Erleichterung unserer Bedrängnisse warten, oder ihm die Gnade anvertrauen, sie gut zu ertragen. „Warum bist du niedergeschlagen“, &c. 5. Wir sollten nicht in Ohnmacht fallen oder schmachten. Keine Widrigkeit soll die Kräfte unserer Vernunft oder unseres Geistes beeinträchtigen, unseren Mut entkräften oder unseren Fleiß erlahmen lassen. „Wenn du in der Not ohnmächtig wirst, ist deine Kraft gering.“ 6. Wir sollten unseres Zustandes nicht überdrüssig werden oder lästige Sehnsüchte nach Veränderungen haben, sondern mit einer stillen Gleichgültigkeit und Bereitschaft darunter liegen, solange es Gott gefällt, in Anbetracht dessen, „der solche Widersprüche von Sündern gegen sich selbst ertragen hat.“ 7. Wir sollten durch widrige Unfälle in unseren eigenen Augen demütig werden, sanftmütig in unserem Gemüt und sensibel für unsere eigene Unwürdigkeit. „Seid demütig unter der mächtigen Hand Gottes.“ „Auf diesen Mann will ich sehen“, &c. 8. Es wird von uns verlangt, dass wir trotz aller Härte in unserem Zustand freundlich zu anderen sind, zufrieden und erfreut über ihren wohlhabenderen Zustand. 9. Zufriedenheit bedeutet Freiheit von Angst in Bezug auf die Versorgung mit unseren Bedürfnissen, „unsere Last auf den Herrn werfen.“ 10. Sie verlangt, dass wir unsere Begierden zügeln und nicht mehr an Quantität oder besserer Qualität anstreben, als unsere Natur oder unser Zustand erfordern. „Derjenige“, wie Sokrates sagte, „ist den Göttern (die nichts brauchen) am nächsten, der am wenigsten Dinge braucht.“ 11. Es bedeutet, dass, was auch immer unser Zustand ist, unser Geist und unsere Zuneigung dementsprechend ausgerichtet sein sollten. Wenn wir reich sind, sollten wir ein freigebiges Herz haben; wenn wir arm sind, sollten wir genügsam sein; wenn wir hoch in der Würde sind, sollten wir gut ballastiert sein; wenn wir niedrig sind, sollten wir sanftmütig und beständig sein.
III. Daraus sollte sich die KORRESPONDENTE EXTERNE DEMEANOUR ergeben. 1. Wir sollten unsere Zungen von allen ungebührlichen Ausdrücken zurückhalten, die Unmut über Gottes Vorsehung andeuten. „Warum klagt ein lebender Mensch?“ „Sei still und erkenne, dass ich Gott bin.“ 2. Wir sollten unsere Zufriedenheit mit Gottes Handeln bekunden, seine Weisheit, Gerechtigkeit und Güte anerkennen und ihn für alles segnen. 3. Wir sollten uns aller ungesetzlichen Maßnahmen zur Behebung unserer Nöte enthalten und lieber still in ihrer Gegenwart verweilen, als uns gewaltsam Erleichterung zu verschaffen. 4. Wir sollten trotz aller Widrigkeiten unsere Angelegenheiten mit Eifer, Mut und Fleiß angehen und nicht zulassen, dass uns der Kummer lustlos oder träge macht. Aktivität ist ein gutes Mittel zur Ablenkung und der schnellste Weg, um viele Übel zu beseitigen. 5. Wir sollten uns fair und freundlich gegenüber den Werkzeugen unseres Unglücks verhalten, „geschmäht werden“ sollten wir „segnen“, &c. (I. Barrow, D.D.)
Christliche Zufriedenheit:-
I. IHR UMFANG. Sie wird unter verschiedenen Umständen ausgeübt. 1. Inmitten von Kompetenz, in welchem Fall sie das Streben des Ehrgeizes und das neidische Murren wegen der Erfolge anderer unterdrückt. 2. Unter aufgeschobener Hoffnung, in welchem Fall sie ein geduldiges Warten auf Gottes Zeit als die beste lehrt. 3. Unter dem Druck des Unglücks, aus dem es in dieser Welt kein Entrinnen gibt; in diesem Fall unterdrückt es Mürrischkeit und eine törichte Anklage gegen Gott.
II. SEINE QUALIFIKATIONEN UND ILLUSTRATIONEN. 1. Es war sein Anteil an weltlichen Gütern, mit dem der Apostel zufrieden war – nicht mit seinem geistlichen Zustand. Das wäre Sünde gewesen. Damit sollten wir unzufrieden sein. Das ist auch nicht unvereinbar mit der Dankbarkeit für die empfangene Gnade. Die Zufriedenheit eines unerneuerten Menschen ist eine große Verschlimmerung seiner Sündhaftigkeit. Aber während du unzufrieden bist wegen der Bosheit deines eigenen Herzens, sei nicht unzufrieden mit dem langsamen Wirken der heiligmachenden Gnade Gottes, so dass du dich ärgerst und ärgerst, dass du nicht schon vollkommen bist. 2. Die Zufriedenheit mit unserem weltlichen Zustand ist nicht unvereinbar mit dem Bestreben, ihn zu verbessern. (1) Zum ärmsten Menschen sagt das Christentum: „Sei zufrieden“, aber auch: „Sei fleißig in den Geschäften“ (1. Kor. 7,21). Die gebotene Zufriedenheit gilt für die Gegenwart. Der Mann ist heute arm, und für diesen Tag gebietet ihm der Glaube, zufrieden zu sein. Aber die Befreiung von der Armut kann am besten für den morgigen Tag sein, und deshalb arbeitet er für seine Befreiung. Vielleicht gelingt es ihm nicht, aber er sagt, dass es am besten erscheint, wenn die Armut noch einen weiteren Tag andauert, und so macht er weiter, bis die Erlösung kommt. (2) Einige Personen mit einem zarten, aber falschen Gewissen haben das Gefühl, als wäre es eine Sünde, zu versuchen, sich zu erheben. Das ist töricht. Es ist unsere gebotene Pflicht, uns zu bemühen, unsere Umstände zu verbessern, nur dürfen wir nicht murren, wenn es uns nicht gelingt. (3) Es gibt solche, die sich anmaßen, Menschen anzuprangern, wenn sie sich für die Aufhebung schlechter Gesetze einsetzen – und die christliche Pflicht der Zufriedenheit predigen. Dass die Zufriedenheit ein Teil der Pflicht ist, wird zugegeben. Eine ungerechte Gesetzgebung ist ebenso ein erlaubtes Urteil Gottes wie eine Hungersnot, und während der Zeit ihrer Verhängung müssen wir uns demütigen. Aber in beiden Fällen ist ein Mensch ein Verbrecher, der nicht alle Mittel zur Beseitigung des Fluches einsetzt. Was wäre unser Zustand ohne einen edlen christlichen Patriotismus gewesen. 3. Diese Zufriedenheit ist relativ zu unserem gegenwärtigen Zustand, und nicht absolut in Bezug auf die gesamten Anforderungen unserer Natur. Der Christ ist mit seinen Vorräten als Pilger zufrieden. Mit der Welt als Heimat zufrieden zu sein, ist sündhaft. Sie ist gut genug als ein Land zum Reisen, aber ich erwarte etwas Besseres.
III. DIE ART UND WEISE, WIE SIE GEPFLEGT WERDEN SOLL. 1. Lasst uns bedenken, dass, was auch immer unsere Umstände sind, sie die Anordnung der Vorsehung Gottes sind, der ein souveränes Recht hat, über uns zu verfügen. „Lass die Scherben mit den Scherben der Erde streiten, aber wehe dem, der mit seinem Schöpfer streitet.“ 2. Es ist notwendig, dass wir uns angewöhnen, sowohl die günstige als auch die ungünstige Seite zu sehen. Wenn du arm bist, hat Gott dir deine Gesundheit gegeben; wenn er dir zwei deiner Kinder genommen hat, hat er ein drittes verschont; einigen deiner Nachbarn geht es schlechter; im schlimmsten Fall hast du deine Bibel und deinen Heiland. 3. Angenommen, unser ganzes Leben wäre Trübsal, so würden wir doch Schlimmeres verdienen. 4. Gott plant unseren Vorteil in jedem Unglück. Die christliche Hoffnung ist das Geheimnis der christlichen Zufriedenheit. (W. Anderson, LL.D.)
Hilfen zur Zufriedenheit:-
I. BETRACHTUNG. 1. Über die besondere Materie davon. (1) Wer ordnet den Staat, und wie ist er geordnet? (Ps. 31:15). Gott ordnet die Dinge a) unwiderstehlich (Jes. 43:13; Pred. 8:3; Eph. 1:11); b) gerecht (1. Mose 18:25; Ps. 145:17; Offb. 15:3); c) weise (Ps. 104:24); d) gnädig (Ps. 25:10). (2) Der Zustand selbst. (a) Er ist gemischt – das Gute mehr als das Böse; das Böse ist unsere Wüste und das Gute der Gnade. b) Er ist allgemein (1. Kor. 10,13; 1. Petr. 5,9). (c) Es gehört zu diesem gegenwärtigen Leben, das nur eine Pilgerreise ist. (d) Es könnte schlimmer sein. (3) Der Zustand der Genügsamkeit. (a) Es ist eine gnädige Haltung. (b) Es ist ein Zustand, der Gott höchst angenehm ist. (c) Es ist ein Zustand, der für uns selbst sehr vorteilhaft ist. Sie erfüllt uns mit Trost, macht uns fit für die Pflicht, verschafft uns die Gnade, die wir uns wünschen, oder etwas Besseres, versüßt jeden Kelch. Wohingegen Unzufriedenheit ein trauriger Eingang zur Sünde ist; eine Vorbereitung zu allen Versuchungen; beraubt das Glück; setzt es dem Gericht aus (Ps 106,24-27; 1Kor 10,10). 2. Von besonderen Fällen, in denen Rücksicht zu nehmen ist, um Zufriedenheit zu erlangen. (1) Niedrigkeit des Vermögens. Liegt extreme Armut vor? Dann bedenke: (a) Der Herr macht arm und reich (1. Sam. 2,7). (b) Niemand ist so arm, der nicht mehr hat, als er verdient. (c) Bis jetzt hat der Herr für uns gesorgt, und wenn wir ihm vertrauen, wird er immer noch für uns sorgen (Psalm 73,3; Matthäus 6,25; Hebräer 13,5). (d) Ein wenig mit Gottes Segen wird weit gehen und gut tun (2. Mose 23,25; 1. Könige 17,12). (e) Das Wenige des Heiligen ist besser als das Ganze des Sünders (Spr 15,16; Ps 37,16). (f) Niemand kann Gottes Liebe oder Hass nach diesen Dingen beurteilen (Pred. 9:1; Mt. 8:20; 2. Kor. 8:9). (g) Gott hält dich in irdischen Dingen gering, aber wie ist es mit dir in höheren und besseren Dingen (Offb. 2,9; Jak. 2,5; 1. Tim. 6,18; Lk. 12,21). (h) Du denkst, Gott ist knapp mit dir in zeitlichen Dingen, aber ist er nicht überreichlich gnädig in geistlichen Dingen? (2) Es gibt einige, mit denen es viel besser ist. Bedenke in deinem Fall: (a) Wie groß die Sünde der Unzufriedenheit bei dir ist, mehr als bei den Personen, von denen vorher die Rede war. (b) Wie dankbar würden viele sein, wenn sie in deiner Lage wären. (c) Christen sollen ihre Begierden an die Dinge unter der Erde binden (Jer. 45,5; 1. Tim. 6,8; Mt. 6,11). (d) Ein wenig genügt der Natur, weniger der Gnade; aber die Begierde wird nie befriedigt. (e) Ein großes Anwesen ist nicht das beste Anwesen (Spr 30,8) für die Pflicht (Prediger 5,13); für die Sicherheit – je höher das Gebäude, desto gefährdeter; für den Komfort. (f) Der Zufriedene ist nie arm, mag er noch so wenig haben; der Unzufriedene ist nie reich, mag er noch so viel haben. (g) Was sind irdische Schätze, dass wir nach ihnen gierig sein sollten? (1. Tim. 6:17; Spr. 23:5). (h) Je weniger wir haben, desto weniger werden wir zu verantworten haben. (3) Es gibt Menschen, die verloren haben, was sie hatten. Bedenken Sie: (a) Gottes Hand ist im Verlust (Hiob 1,21). (b) Etwas ist weg, aber möglicherweise ist nicht alles verloren. (c) Haben Sie sie wirklich gebraucht? (1. Petr. 1,6). (d) Angenommen, alles ist verloren, dann ist es wenig (1. Korinther 7,31). (e) Wenn du ein Kind Gottes bist, ist das Beste sicher. 3. Die Art und Weise, wie die Rücksichtnahme gehandhabt werden soll. Sie muss sein: (1) Häufig. (2) Zügig. (3) Ernsthaft.
II. GÖTTLICHKEIT. Dies erzeugt Zufriedenheit. 1. Sie richtet die verschiedenen Fähigkeiten der Seele auf. (1) Sie richtet den Verstand auf, indem sie die natürliche Finsternis vertreibt und ein erlösendes Licht aufrichtet. (2) Sie richtet den Willen auf, indem sie ihn dazu bringt, dem Willen Gottes zu entsprechen. (3) Sie richtet die Gefühle auf, indem sie ihre Unmäßigkeit gegenüber irdischen Dingen beseitigt und sie in wahren Grenzen hält. (4) Sie macht das Gewissen gut (Spr 15,15). 2. Sie macht den Menschen zu einem starken Sinn für Gottes Herrlichkeit, so dass er immer in ihr als seinem höchsten und wünschenswertesten Gut ruht. 3. In der allgemeinen Gewohnheit der Gnade gibt es besondere Gnaden, die die Genügsamkeit fördern. (1) Demut. (2) Glaube. (3) Beharrlichkeit. (4) Himmlische Gesinnung. (5) Selbstverleugnung.
III. GEBET. Hiervon hängen die beiden anderen ab. Es fördert die Zufriedenheit. 1. Weil es dem Geist in der Not Luft verschafft. 2. Weil es Gnade und Kraft von Gott erhält. (T. Jacomb, D.D.)
Lernen, zufrieden zu sein: – Diese Worte bedeuten, wie man Zufriedenheit erlangen kann. Sie ist keine uns angeborene Begabung, sondern ein Produkt der Disziplin – „ich habe gelernt“. Es war eine Frage von Plato, ob Tugend erlernt werden kann. Der heilige Paulus löst sie eindeutig durch das Zeugnis seiner Erfahrung. Sie erfordert jedoch große Entschlossenheit und Fleiß bei der Überwindung unserer Begierden; daher ist sie eine Kunst, die nur wenige studieren.
I. GEGEN GOTT können wir in Betracht ziehen, dass die Gerechtigkeit verlangt, die Dankbarkeit fordert und die Vernunft gebietet, dass wir zufrieden sein sollen; oder dass wir uns, wenn wir unzufrieden sind, unwürdig und unwürdig verhalten, sehr ungerecht, undankbar und töricht gegen Ihn sind. 1. Der Punkt der Gerechtigkeit betrachtet, nach der Regel des Evangeliums: „Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will?“ 2. Der Punkt der Dankbarkeit, da wir kein Recht oder Anrecht auf irgendetwas haben; alles, was wir haben, kommt aus Gottes reiner Freigebigkeit und ist zu unserem Wohl bestimmt. 3. Die der Vernunft, weil es am vernünftigsten ist, Gottes Entscheidung über unser Vermögen zu akzeptieren, da er unendlich weiser ist als wir, uns besser liebt als wir uns selbst und das Recht hat, über uns zu verfügen, wie es ihm gefällt.
II. IN BEZUG AUF UNS SELBST können wir viel Grund zur Zufriedenheit feststellen. 1. Als Menschen und Geschöpfe sind wir von Natur aus arm und ohnmächtig; wir haben keinen gerechten Anspruch auf irgendetwas, noch können wir irgendetwas durch unsere eigene Kraft erhalten. Deshalb ist das Wenige, was uns zugestanden wird, kein Unrecht und kein Grund zur Klage. 2. Und in moralischer Hinsicht haben wir noch weniger. (1) Als Sünder sind wir dem Zorn verhaßt und sollten uns daher über nichts beklagen. (2) Wir sind Gottes Diener, und soll ein einfacher Diener oder Sklave sich anmaßen, seinen Platz zu wählen oder seinen Rang in der Familie zu bestimmen? Ist es nicht angebracht, dass diese Dinge dem Ermessen und dem Wohlgefallen des Meisters überlassen werden? (3) Nochmals, wenn wir uns als Kinder Gottes durch Geburt und Natur oder durch Adoption und Gnade betrachten, wie können wir dann mit irgendetwas unzufrieden sein?
III. WENN WIR UNSEREN ZUSTAND betrachten, wie auch immer er sein mag, können wir keinen vernünftigen Grund für Unzufriedenheit haben. 1. Unser Zustand kann, wenn er richtig betrachtet und gut verwaltet wird, nicht unerträglich sein. Der Mangel an manchen Dingen wird durch andere Genüsse ausgeglichen. Wenn wir einige Dinge hoch schätzen, so ist es kein Wunder, dass unser Zustand unangenehm ist, wenn sie uns fehlen; und wenn wir andere für mächtige Übel halten, so können wir, wenn sie über uns kommen, kaum entgehen, dass wir unzufrieden sind; aber wenn wir alle Dinge nach den Geboten der wahren Vernunft einschätzen, so werden wir finden, dass weder das Fehlen des einen noch das Vorhandensein des anderen beklagenswert ist. 1) Nehmen wir die Armut, d.h. das Fehlen einiger überflüssiger Dinge, die eher unsere Phantasie erfreuen als unser Bedürfnis befriedigen, und ohne die die Natur leicht zufrieden zu stellen ist. (2) Nimm den Fall, der von der Ehre in die Verachtung gefallen ist; das kann nur eine Änderung in der Meinung der Leichtsinnigen sein, das Zerplatzen einer Seifenblase, die Veränderung des Windes. (3) Nimm den, der verleumdet wird; ist nicht jeder Mensch dem unterworfen? und der größte und weiseste dem am meisten ausgesetzt? Oder ist dein Vorwurf gerecht? Dann verbessere diesen Umgang und mache ihn heilsam. (4) Nimm den, der in seinen Unternehmungen enttäuscht und gekreuzt ist. Warum bist du in dieser Hinsicht beunruhigt? Hast du viel Erwartung auf Ungewissheit aufgebaut? Hast du nicht die Möglichkeit vorausgesehen, dass dein Vorhaben scheitern könnte? Und wenn ja, warum bist du nicht bereit, das Geschehene anzunehmen? (5) Nimm einen, der von seinen Freunden mit Unfreundlichkeit und Undankbarkeit konfrontiert wurde. Solches Fehlverhalten ist aber mehr ihr Unglück als unseres. Der Verlust von schlechten Freunden ist kein Schaden, sondern ein Vorteil. (6) Nehmen wir den, der den Tod von Freunden betrauert. Kann er denn seinen besten Freund verlieren? Es ist auch nicht der Verlust, den er beklagt, sondern nur die Trennung für eine kurze Zeit. Er ist nur weg, als wenn er eine kleine Reise tut. Aber…(7) Es mag uns vielleicht missfallen, dass der Lauf dieser Welt nicht richtig oder nach unserem Sinn verläuft; dass die Gerechtigkeit nicht gut verteilt wird, die Tugend nicht gebührend berücksichtigt, der Fleiß nicht ausreichend belohnt wird; aber Gunst, Parteilichkeit, Plattheit, List und Korruption tragen alles vor sich her. Doch warum sollte dir das missfallen? Bist du schuldig, dazu beizutragen? dann ändere es selbst; wenn nicht, dann ertrage es; denn so ist es immer gewesen, und so wird es immer sein. Und doch ist Gott beauftragt, für uns zu sorgen. Gott beobachtet diesen Lauf der Dinge, und doch lässt er ihn zu. Aber er hat ein Gericht für das Jenseits bestimmt. 2. Wie es hier keinen Zustand gibt, der vollkommen und rein gut ist, so gibt es auch keinen, der so durch und durch schlecht ist, dass er nicht etwas Angenehmes und Bequemes in sich hätte. Selten oder nie verlassen alle guten Dinge einen Menschen auf einmal, und in jedem Zustand gibt es einen gewissen Ausgleich für das Böse. Wir sollten uns nicht über kleine Unannehmlichkeiten aufregen und die Vorteile übersehen. Das hindert uns daran, in allen anderen Dingen Zufriedenheit zu ernten. 3. Ist unser Zustand so extrem schlecht, dass er nicht schlimmer sein könnte? Sicherlich nicht. Gottes Vorsehung wird es nicht zulassen. Es gibt immer Hilfen gegen Extreme – unser eigener Verstand und Fleiß; das Mitleid und die Hilfe anderer. Wenn alles vorbei ist, dürfen wir den unschätzbaren Segen eines guten Gewissens bewahren, auf Gott hoffen und seine Gunst genießen. Warum sind wir dann unzufrieden? 4. Dann betrachte den Nutzen des Unglücks – die Schule der Weisheit, den läuternden Ofen der Seele, Gottes Methode, Sünder zurückzufordern, die Vorbereitung auf den Himmel. Wer wurde jemals groß oder weise oder gut ohne Widrigkeiten. 5. Was auch immer unser Zustand sein mag, er kann nicht von Dauer sein. Die Hoffnung liegt auf dem Grund des schlimmsten Zustandes, der sein kann. „Sorgt nicht für den morgigen Tag.“ Beachten Sie die Verheißungen, dass keiner, der auf Gott hofft, enttäuscht wird. Und dann wird der Tod alles beenden und der Himmel für alle irdischen Übel entschädigen.
IV. BETRACHTEN WIR DIE WELT UND DEN ALLGEMEINEN ZUSTAND DER MENSCHEN HIER. 1. Betrachte die Welt, wie sie im Allgemeinen von den Menschen verwaltet wird. Bist du unzufrieden, dass du darin nicht gedeihst? Wenn du weise bist, wirst du dich nicht grämen, denn vielleicht hast du weder die Fähigkeit noch die Veranlagung dazu. Diese Welt ist für Weltlinge. 2. Wir sind in der Tat sehr geneigt, zu den wenigen aufzublicken, die uns an vermeintlichen Vorteilen des Lebens zu übertreffen scheinen, und uns über ihr Glück zu beklagen; aber selten werfen wir unsere Augen auf die zahllosen guten Menschen herab, die in allen Arten von Unterkünften unter uns liegen; während wir, wenn wir den Fall der meisten Menschen betrachten würden, reichlich Grund sehen würden, mit unserem eigenen zufrieden zu sein. 3. Wenn wir sogar darauf achten würden, unseren Zustand mit dem der Menschen zu vergleichen, die wir am meisten bewundern und beneiden, würde uns das oft Trost und Zufriedenheit geben. 4. Es kann uns dazu bringen, zufrieden zu sein, wenn wir bedenken, was gemeinhin das Los der guten Menschen in der Welt gewesen ist. In der Heiligen Schrift wird kaum eine Person erwähnt, die sich durch Güte auszeichnete und die nicht auch Not und Bedrängnis zu spüren bekam – sogar unser Herr. Haben denn alle diese, „deren die Welt nicht würdig war“, alle Arten von Unannehmlichkeiten erlitten, indem sie „arm, geplagt, gequält“ waren; und sollen wir es verachten oder bereuen, in solcher Gesellschaft zu sein?
V. BETRACHTE DIE ART DER PFLICHT SELBST. 1. Sie ist das souveräne Heilmittel für alle Armut und Leiden; sie beseitigt sie oder mildert das Unheil, das sie uns zufügen können. 2. Ihr Glück ist besser als jedes, das aus weltlichem Wohlstand entsteht. Die Befriedigung, die aus vernünftiger Zufriedenheit und tugendhafter Gesinnung entspringt, ist edler, solider und dauerhafter, als jede Frucht weltlicher Güter es sein kann. 3. 3. Zufriedenheit ist der beste Weg, unseren Zustand zu verbessern, uns zu veranlassen, Vorteile zu nutzen, wenn sie auftreten, und Gottes Segen zu sichern (Isaac Barrow, D.D.) Die beste Lektion (Kinderpredigt): Die Welt ist eine Schule, und wir müssen unsere Lektionen in ihr lernen. Die beste Lektion, die wir lernen können, ist Zufriedenheit.
I. WARUM ES DIE BESTE LEKTION IST. 1. Weil sie diejenigen, die sie lernen, glücklich macht. Nichts auf der Welt kann einen unzufriedenen Menschen glücklich machen. Es war einmal ein Junge, der wollte nur eine Murmel; als er die Murmel hatte, wollte er nur einen Ball; als er einen Ball hatte, wollte er nur einen Kreisel; als er einen Kreisel hatte, wollte er nur einen Drachen; und als er Murmel, Ball, Kreisel und Drachen hatte, war er nicht glücklich. Es war einmal ein Mann, der wollte nur Geld; als er Geld hatte, wollte er nur ein Haus; als er ein Haus hatte, wollte er nur Land; als er Land hatte, wollte er nur eine Kutsche; aber als er Geld, Haus, Land und Kutsche hatte, wollte er mehr denn je. Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, las ich eine Fabel über eine Maus, die mit einem Sieb zu einer Quelle ging, um etwas Wasser hineinzutragen. Er tauchte das Sieb in das Wasser, aber sobald er es anhob, lief natürlich das ganze Wasser durch. Er versuchte es wieder und wieder, aber immer noch blieb kein Wasser im Sieb. Die arme Maus hatte nicht genug Verstand, um zu wissen, wo das Problem lag. Sie dachte nicht an die Löcher im Sieb. Die Fabel besagt, dass, während die Maus noch vergeblich versuchte, etwas Wasser in das Sieb zu bekommen, um es nach Hause zu tragen, ein kleiner Vogel kam und sich auf einen Ast des Baumes setzte, der in der Nähe der Quelle wuchs. Er sah den Ärger, in dem die arme Maus steckte, und sang ihr freundlicherweise einen kleinen Rat in diesen einfachen Worten vor:
„Stopfe es mit Moos und schmiere es mit Lehm, dann kannst du alles wegtragen.“

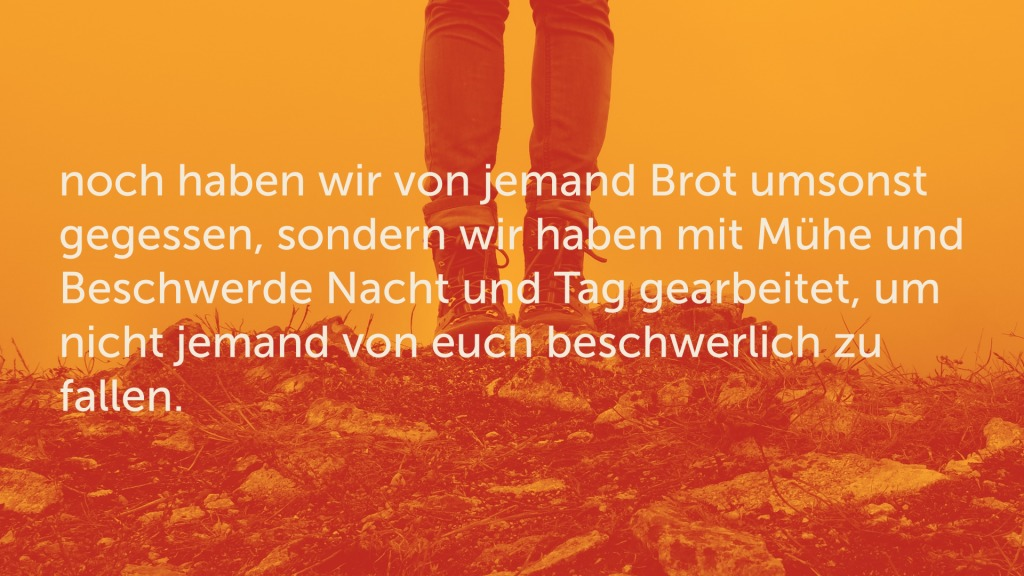








Neueste Kommentare