Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen, und durch die Sünde der Tod, und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil (Eig auf Grund dessen, daß) sie alle gesündigt haben;
Elberfelder 1871 – Römer 5,12
Deshalb gilt: Wie die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt kam, so auch die Überwindung der Sünde. Die Sünde dieses einen brachte den Tod mit sich, und alle verfielen dem Tod, weil sie auch alle selbst sündigten.
Gute Nachricht Bibel 2018 – Römer 5:12
Wir können nun einen Vergleich ´zwischen Christus und Adamziehen. Durch einen einzigen Menschen – ´Adam – hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt.
Neue Genfer Übersetzung 2013 – Röm 5,12
Deshalb: Genauso wie nur über einen Menschen die Verirrung in die Welt hineingelangt ist und über die Verfehlung der Tod, ist auch auf dieselbe Weise der Tod auf alle Menschen übergegangen, unter der Bedingung, dass sich alle versündigt haben.
Gottes Agenda – Röm 5:12
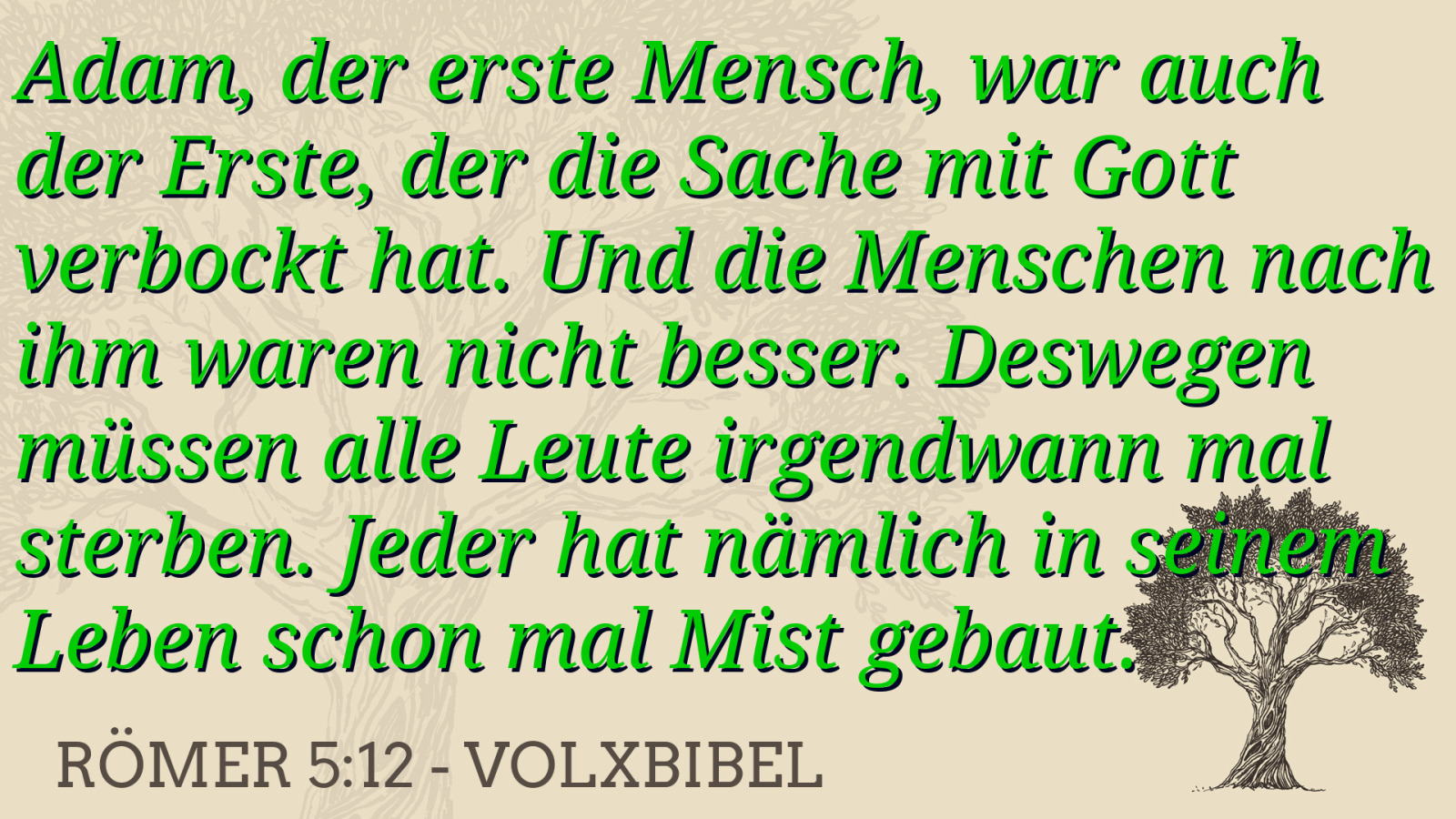
Damit schließt Paulus seine Auseinandersetzung mit dem Thema der Gerechtigkeit, die Gott auf der Grundlage des Opfertodes Christi für die Menschen bereithält, und die sie durch den Glauben erlangen können. Nur noch eines bleibt ihm jetzt zu tun – er muß den Gegensatz zwischen dem Werk Jesu Christi (und der Rechtfertigung und Versöhnung, die Christus herbeiführte) und dem Tun eines anderen Menschen, Adam (das in Sünde und Tod mündete) herausarbeiten. Er setzt zu einem Vergleich an: Deshalb (vgl. Röm 4,16), wie durch …, kommt dann aber vom Thema ab und kehrt erst in Röm 5,15 zu der Parallele zwischen Adam und Jesus zurück. Der dazwischenliegende Exkurs führt aus, daß die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist (eisElthen) und der Tod durch die Sünde (vgl. 1Mo 2,16-17). Der geistliche und physische Tod (vgl. Röm 6,23; Röm 7,13), den Adam und Eva und ihre Nachkommen erlitten und erleiden, war die Strafe für die Sünde. In Röm 5,12 – 21 geht es um den äußerlich sichtbaren, physischen Tod.
Die Bibel erklärt und ausgelegt – Walvoord Bibelkommentar
Paulus schließt: So ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen (diElthen). EisElthen, „in die Welt gekommen“, bedeutet, daß die Sünde die Welt gewissermaßen durch die Vordertür (die Sünde Adams) betrat; diElthen, „durchgedrungen“, bedeutet, daß der Tod die ganze Menschheit ereilte, wie ein giftiges Gas, das sich überall ausbreitet. Der Grund dafür, daß der Tod alle trifft, ist, wie Paulus erklärt, die Tatsache, daß alle gesündigt haben. Alle drei Verben in diesem Vers stehen im Präteritum (Aorist). Damit ist die gesamte Menschheit in die Sünde, die Adam beging, einbezogen (vgl. „sie sind allesamt Sünder“ in Röm 3,23 ,ebenfalls Vergangenheitsform). Die Theologen haben zwei Erklärungsansätze für die Teilhabe der Menschheit an der Sünde Adams vorgelegt: die Erbsünde im Sinne einer Kollektivschuld, die von Adam auf die ganze Menschheit überging, und die Lehre von der „angeborenen“ Erbsünde. (Eine dritte These ist, daß die Menschen Adam nur nachahmten, daß er eine Art schlechtes Beispiel für sie war, doch diese Interpretation wird Röm 5,12 nicht gerecht.)
Die These, daß die Erbsünde als Kollektivschuld auf den Menschen lastet, geht davon aus, daß Adam, der erste Mensch, der Stellvertreter der ganzen Menschheit war, die von ihm abstammt. Gott sah in der Sünde Adams eine Handlung, die von allen Menschen ausging, und daher wurde die Todesstrafe, die über ihn verhängt wurde, auf die übrige Menschheit ausgedehnt.
Die These, daß die Erbsünde „angeboren“ ist, geht dagegen davon aus, daß in Adam, dem ersten Menschen, bereits die ganze Menschheit physisch enthalten war und daher vor Gott an der Sünde, die Adam beging, teilhatte, und auch die Strafe, die ihn ereilte, mittragen muß. Nun müssen zwar auch die Anhänger der These von der Kollektivschuld zugeben, daß Adam der natürliche Stammvater aller Menschen ist. Hier geht es jedoch in erster Linie um die geistige Verwandtschaft. Die biblischen Belege stützen eher die zweite These, die „angeborene“ Erbsünde. Als der Verfasser des Hebräerbriefs von der priesterlichen Überlegenheit Melchisedeks über Aaron sprach, argumentierte er, daß Levi, das Haupt der Priesterschaft, „der selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden (ist). Denn er sollte seinem Stammvater ja erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging“ (Hebräer 7,9-10).
Die Abhandlung des Apostels tritt in diesem Vers in eine neue Phase. In einem gewissen Sinn hat er das Werk Christi bereits in Verbindung mit dem Problem der Sünde behandelt, doch von hier an bis zum Ende von Kap. 8 beschäftigt er sich mit der Wurzel der Sünde. Es geht nicht so sehr um das, was wir getan haben, als vielmehr darum, was wir von Natur aus sind. Nachdem wir die Vergebung der Sünden erfahren haben und uns viele weitere Segnungen zugesichert wurden, sind viele erstaunt, daß sie die bittere Wurzel der Sünde immer noch in sich finden. Viele sind in Klöster geflohen und haben es mit einem Leben der Abgeschiedenheit versucht, um der Wurzel der Sünde zu entfliehen. Doch all solche Versuche waren vergebliche Mühe. Die Sünde ist überall. Nichts und niemand ist von ihr ausgenommen. Alle haben die gefallene Natur Adams geerbt.
Benedikt Peters – Was die Bibel lehrt
Wäre es möglich, die eigene Abstammung über all die Jahrhunderte zurückzuverfolgen, würden wir schließlich alle bei Adam angelangen. Über Adam schreibt Paulus: »Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen.« Das 1. Buch Mose ist in diesem Punkt völlig unmißverständlich. Die Konsequenz der Sünde dieses Menschen wird genannt: Der Tod kam in die Welt, »und also ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen«. Der Bericht in 1 Mose zeugt hier wiederum von der Wahrhaftigkeit dieser Behauptung. Die drei Worte »und er starb« finden sich immer wieder hinter jedem Namen, der in der Geschichte der Menschheit auftaucht. Dann wird der abschließende Beweis für Paulus‘ Behauptung gegeben, daß der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist: »weil sie alle gesündigt haben«. Diese Aussage deckt die ganze Menschheit ab. Ungeachtet von Rasse oder Stellung »haben alle gesündigt«.
Als Adam im Zustand der Unschuld erschaffen wurde, war er frei vom Tod. Der Tod kam erst als Folge seines Ungehorsams. Das Gebot Gottes war unmißverständlich: »Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn welches Tages du davon ißt, wirst du gewißlich sterben« (1.Mo. 2,17). Der körperliche und geistliche Tod wurden Adams Los, weil er die Warnung in den Wind geschlagen hatte. Als er seine Schuld zugab, fügte er hinzu: »Das Weib, das du mir beigegeben hast, sie gab mir von dem Baum, und ich aß« (1.Mo. 3,12). So wurde Adam zum Träger einer gefallenen Natur. Er war ein Sünder und seine Nachkommen erbten seine gefallene Natur. Für das Haupt war es unmöglich, sündlose Nachkommen hervorzubringen, wenn er selbst gesündigt hatte und somit ein Sünder war. Er konnte nur Sünder in die Welt setzen, und somit war die ganze Menschheit betroffen; alle wurden in Sünde geboren.
Es ist bedeutsam, daß Paulus in seiner Argumentation nirgends Eva erwähnt. Da sie in der Bibel als »Mutter aller Lebendigen« bezeichnet wird (1.Mo. 3,20), hätte man meinen können, daß auch sie als Ahne des Menschengeschlechts betrachtet wird. Der Apostel sagt jedoch nicht, »gleichwie durch eine Frau die Sünde in die Welt kam«, wenngleich das in gewissem Sinne richtig wäre. An anderer Stelle schreibt Paulus: »Und Adam wurde nicht betrogen, das Weib aber wurde betrogen und fiel in Übertretung« (1.Tim. 2,14). Wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann hätte Eva die Strafe allein getragen. Obwohl sie es war, die verführt wurde, kam die Sünde in die Welt, als Adam das Gebot übertrat, das Gott ihm gegeben hatte. So stürzte Adam seine Nachkommenschaft ins Verderben. Das Gebot, welches das Essen der Frucht von dem bestimmten Baum untersagte, war nicht Eva gegeben worden, sondern Adam als repräsentativem Menschen auf der Erde.
Adam war das Haupt des Geschlechts, das folgen sollte, und er war deshalb vor Gott verantwortlich für das, was er als erster Mensch tat. Die Bibel bestätigt seine führende Position: »Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva« (1.Tim. 2,13). Für eine kurze Zeit war Adam noch unschuldig, während Eva es nicht mehr war. Er war das Haupt, Eva nicht, wenngleich sie »ein Fleisch« waren. Er war der repräsentative Mensch, und so verweist Paulus in Römer 5 acht Mal auf Adams Verstoß. Außerdem war Adam als Haupt eines Geschlechts ein Typus auf Christus hin, obwohl hier über ihn gesagt wird: »Gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist.« Eva hätte diese Stellung niemals einnehmen können, deshalb konzentriert sich die gesamte Argumentation auf Adam.
Über den Ausdruck in 1.Tim. 2,14, »wurde nicht betrogen«, schreibt Vincent: »Ausleger haben in vielfacher Weise versucht, diesen Ausdruck zu erklären, entweder indem sie prôtos (‚zuerst‘) zufügen, oder indem sie sagen (wie z.B. Bengel), daß die Frau den Mann nicht verführte (‚betrog‘), sondern ihn überredete. Oder sie fügen ‚durch die Schlange‘ hinzu.« Er fährt fort und sagt, daß die AV die Aussage schwächt (sie übersetzt: » war in Übertretung«) und spricht sich für »fiel in Übertretung« aus. Es ist jedoch klar, daß Eva, die verführt wurde, die Übertretung eingeführt hat (Luther12). Adam war schuldig, Gott ungehorsam gewesen zu sein.
Das Christusgeschehen hat eine kosmische Weite, eine die Zeit und alles Geschaffene umgreifende Dimension. In diesem folgenden Abschnitt weitet Paulus deshalb den Blickwinkel aus. War in 5, 1–11 der einzelne Christ und die Gemeinde Thema, wie sich Gott ihnen in Jesus Christus zuwendet, so wird nun der Christus Gottes in den kosmischen Rahmen hineingestellt. Der ganze „Kosmos“ (so „Welt“ im Griechischen, das Weltall eigentlich), biblisch in der Regel die Benennung für die ganze Menschheit, steht unter dem Christusgeschehen. Paulus zieht hier die großen Linien des Heilshandeln Gottes aus. Die Botschäft des Evangeliums ist ganz gewiß nicht kleinkariert. Sie wird verringert, wenn sie nur auf mein persönliches Heil eingegrenzt wird. Nein, der Heilsplan Gottes geht in die unbegrenzte Weite zu „allen“. Deshalb gehören Evangelium und Weltmission untrennbar zusammen (vgl. Mt 28, 18–20).
Edition C Bibelkommentar
„Derhalben“, und das heißt: aus den vorigen Versen, folgt dieses Weite. Und nun wird die Geschichte der Menschheit von Anfang an auf gerollt: Durch einen Menschen ist die Sünde in den Kosmos gekommen. Paulus redet hier ganz gezielt. Die Sünde wird nicht auf eine irgendwie geartete Macht zurückgeführt und so zum Schicksal oder zum unentrinnbaren Verhängnis des Menschen erklärt, sondern die Verantwortung des Menschen wird eindeutig festgestellt. Auch die Schlange soll ja in 1. Mose 3 nicht den Menschen entlasten und das Böse von ihm wegerklären (vgl. Bibelarbeit zu Röm 3, 1–8), sondern gerade sie spricht Adam als Freien, seiner selbst Mächtigen an. Nirgendwo spekuliert die Bibel über den Ursprung des Bösen, sondern sie behaftet immer den Menschen als den Sünder: „Du bist der Mann!“ (2 Sam 12, 7). Adam ist das Eingangstor für die Sünde in die Menschenwelt; das ist seine Schuld. Und „durch“ = wegen oder infolge der Sünde kam der Tod. War Adam unsterblich im Paradies? Auch hier können wir nicht spekulieren. Gott vertrieb ihn aus dem Paradies, daß er nicht vom Baum des Lebens „esse und lebe ewiglich“ (1 Mo 3, 22). Doch war die paradiesische Gemeinschaft mit Gott der Schutzwall gegen den Tod. Wir kennen zwar nicht seine „Natur“ im Paradies, wohl aber hören wir die Worte Gottes, die ihn vor dem Tod warnen – er ist also noch nicht Wirklichkeit (vgl. 1 Mo 2, 17). Die Sünde hat den Tod im Gefolge, denn der Tod ist der Sünde Sold (Röm 6, 23). Durch Adam sind Sünde und Tod in die Menschheit hineingekommen, und „so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen“. Durch den einen kam er hinein, und nun geht er unaufhaltsam durch die Reihen der Menschheit. Aus Adams Tun entsteht das Verhalten und Schicksal der Menschheit. Alle stehen seit Adam unter der vernichtenden Macht des Todesverhängnisses. Doch ist es gewiß nicht unverdientes Schicksal. Paulus schreibt ausdrücklich: „weil sie alle gesündigt haben“.
Alle haben gesündigt, es ist ihr eigenes Tun, das sie in den Untergang hineinreißt. Seit Adam sind eben nicht zwei Gruppen in der Welt: die einen etwa, die sündigen, und die anderen, die weiterhin in paradiesischer Sündlosigkeit verharren. Nein, „da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer“ (Ps 14, 3). Keiner kann sich aus seiner Verantwortung stehlen.
Der mit „derhalben“ begonnene Gedanke des Paulus bricht hier ab, bleibt noch unvollendet. Eigentlich müßte er mit dem Lob der Tat Jesu Christi weitergehen: „…so ist auch durch einen die Gerechtigkeit in die Welt gekommen und durch die Gerechtigkeit das Leben; und das Leben wird zu allen Menschen hindurchdringen, wo sie sich rechtfertigen lassen. “ Doch Paulus läßt den Satz so stehen, um die Macht der Sünde näher auszuführen.
In diesem Abschnitt lehrt uns der Apostel das biblische Verständnis von Geschichte. Gewöhnlich verstehen wir die Menschheitsgeschichte als ein rein innerweltliches Geschehen, das bestimmt wird von innerweltlichen Kräften und Personen. Hier sehen wir, dass die Geschichte des Menschen nur verstanden werden kann als ein von Gott gewirktes und gelenktes Geschehen. Sie hängt an einem zweimaligen Eingreifen Gottes: Bei seinem ersten Eingreifen schuf Gott den Menschen; bei seinem zweiten Eingreifen wurde er selbst Mensch. Die Erschaffung Adams und die Menschwerdung Christi, das sind die beiden Angelpunkte, an denen die gesamte Menschheitsgeschichte aufgehängt ist. Wenn wir die nicht kennen und berücksichtigen, werden wir die Geschichte des Menschen nie verstehen. Damit ist auch gesagt, dass die ganze Geschichte in zwei scharf voneinander geschiedene Zeitalter zerfällt: in das Zeitalter Adams und das Zeitalter Christi, oder: in das Zeitalter des ersten Menschen und das Zeitalter des zweiten Menschen. Diese beiden Zeitalter sind nicht bestimmt durch ihre Dauer, sondern durch das jeweilige Verhältnis des Menschen zu Gott; darum ist der Ausdruck »Zeitalter« nicht so glücklich, weshalb einige dafür das griechische Wort »Äon« verwenden, in welchem der Begriff »Zeit« nicht enthalten ist. Weil dieser Begriff wiederum gerne von Irrlehrern verwendet wird, verwenden wir am besten das gute deutsche Wort »Ordnung«. Die erste Ordnung ist von Adam und seinem gebrochenen Verhältnis zu Gott bestimmt. Der erste Mensch, Adam, erlag der Sünde, und damit wurde seine Ordnung zur Ordnung des Todes, der ohne Ausnahme über alle herrscht (5,14). Der zweite Mensch, Christus, überwand die Sünde, und damit eröffnete er die Ordnung des Lebens. Und wiederum anders, als der Ausdruck »Zeitalter« suggeriert, finden diese beiden Ordnungen kein Ende in der Zeit. Die Ordnung Adams mündet in die ewige Gottesferne; die Ordnung Christi mündet in die ewige Gottesgemeinschaft. Und weil diese beiden Ordnungen nie aufhören, bestehen seit dem Ersten Kommen Christi beide nebeneinander. Wir stehen als Menschen im Fleisch noch in der alten Ordnung, und gleichzeitig gehören wir als Erlöste in Christus bereits zur neuen Ordnung.
Benedikt Peters – Der Brief an die Römer
Daher müssen wir im vorliegenden Zusammenhang »Tod« und »Leben« in ihrem biblisch umfassenden Sinn verstehen. Dass alle, die zur Ordnung Adams gehören, sterben, heißt nicht lediglich, dass ihre Lebensspanne begrenzt ist, sodass eines Tages der Tod eintritt, sondern es heißt auch: In Adam sind alle, und zwar vom Tag ihrer Geburt an, unter der absoluten Herrschaft des Todes – tot in Sünden, tot für Gott, dem wahren Leben entfremdet, gefangen in der Gottesferne, versklavt ohne Aussicht auf Befreiung. Wenn sie sterben, verfallen sie in einer totalen Weise dem Tod, den sie noch nicht empfinden, solange sie noch in dieser Welt mit ihren Augen die liebe Sonne sehen.
In Vers 12 geht es um die Zurechnung von Adams Sünde: Wie nun durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist auch der Tod zu allen Menschen gekommen, denn sie haben alle gesündigt. Das griechische Wort für „deshalb“, dia, bedeutet „durch“, „wegen“ und „wegen“. Er verbindet die vorangegangene Passage mit dem, was folgt. Unter der Annahme, dass sowohl die Rechtfertigung als auch die Versöhnung wahr sind, weist Paulus darauf hin, was wir daraus lernen können. Adam war das föderale (oder repräsentative) Haupt des Menschengeschlechts. Gott gab ihm die Vollmacht, im Namen der gesamten Menschheit zu handeln. Adam war nicht der erste Sünder; das war Satan. Aber Adam war derjenige, der das menschliche Leben der Macht der Sünde aussetzte. Außerdem hat auch Eva vor Adam gesündigt, aber sie wird in diesem Vers nicht einmal erwähnt, weil Adam das Haupt des Menschengeschlechts war, nicht Eva. Daher fiel die Verantwortung auf ihn. Was die menschliche Sphäre betrifft, so kam die Sünde mit seinem Fall in die Welt. In diesem Vers geht es nicht darum, wer zuerst gesündigt hat oder wie die Sünde entstanden ist, sondern wie sie universell wurde.
Arnold G. Fruchtenbaum – Ariel’s Bibelkommentar: Römer
In den vorangegangenen Abschnitten befasste sich Paulus vor allem mit den Sünden im menschlichen Leben, für die das Heilmittel die Rechtfertigung durch den Glauben ist. In Vers 12 begann er von einer Sünde zu sprechen und bezog sich damit auf die Sündennatur. Die Sündennatur ist das Prinzip, nach dem der Mensch funktioniert und das ihn dazu bringt, Sünden zu begehen. Paulus erklärt weiter, dass der Tod (gemeint ist der physische Tod) durch die Sünde in die menschliche Sphäre kam. Auf diese Weise kam der Tod zu allen Menschen, weil alle gesündigt haben. In Römer 3,23 erklärt Paulus: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Es gibt einen kleinen Unterschied in der Übersetzung des griechischen Ausdrucks pantes hēmarton, der sowohl in 3,23 als auch in 5,12 vorkommt. Die ASV übersetzt 3,23 mit „gesündigt haben“ und 5,12 mit „sündigen“. Der Unterschied in der Übersetzung weist auf einen kleinen Bedeutungsunterschied hin. Während 3:23 mit „wir haben in der Vergangenheit gesündigt und werden auch weiterhin sündigen“ umschrieben werden kann, bedeutet 5:12, dass alle die eine Sünde Adams begangen haben. Alle sind zu Sündern geworden, weil sie die Sündennatur geerbt haben, die von Adam vererbt wurde.
Ein weiteres Prinzip, das in Vers 12 erwähnt wird, ist das der Zurechnung. Charles Ryrie, Professor für Systematische Theologie am Dallas Theological Seminary (DTS), erklärt in seiner Grundlagentheologie: „Zurechnen bedeutet, jemandem etwas zuzuschreiben oder anzurechnen oder zuzurechnen. Im Mittelpunkt des Konzepts steht nicht die bloße Beeinflussung, sondern die Beteiligung.“ Da Adam stellvertretend für die gesamte Menschheit stand, wird jeder Mensch, der von ihm abstammt, als Teilnehmer an der von ihm begangenen Sünde betrachtet. Jeder Mensch leidet unter den Folgen von Adams Sünde, und das ist der physische Tod. Das ist das Prinzip der Zurechnung. Die Sünde Adams wurde allen seinen Nachkommen zugerechnet, und deshalb müssen sie alle sterben. Es ist sehr wichtig, dieses Prinzip zu verstehen. Die Sündennatur, die die Menschheit von Adam geerbt hat, führt dazu, dass ein Mensch Sünden begeht. Die zugerechnete Sünde ist jedoch etwas anders. Die zugerechnete Sünde führt dazu, dass Gott alle Menschen so ansieht, als hätten sie an der Sünde teilgenommen, die Adam im Garten Eden begangen hat. Folglich erntet jeder Mensch die Folgen dieser einen Sünde: den Tod. Ryrie fasst es kurz und bündig zusammen: „Der physische Tod ist die besondere Strafe, die mit der zugerechneten Sünde verbunden ist (Röm 5,13-14).“ Robert Lightner, der wie Ryrie Professor für Systematische Theologie an der DTS war, liefert eine etwas längere Erklärung:
Da der Tod nicht vor Adams Übertretung existierte, sondern eine Folge und Strafe für seine Sünde war, und da nach Adam Menschen starben, die nicht auf genau dieselbe Weise gesündigt hatten, kann daraus nur folgen, dass diejenigen, die auf diese Weise starben, dies taten, weil sie an Adams Sünde beteiligt und daher Empfänger seiner nachfolgenden Strafe waren.
Die Menschen sterben nicht wegen ihrer persönlichen Sünden. Sie sterben, weil sie in Adam zum Tod verurteilt sind. Eine einfache Erklärung dieses Prinzips kann man am Tod eines Babys sehen. Wenn Säuglinge sterben, haben sie noch keine Sünden begangen. Deshalb sterben sie nicht wegen ihrer eigenen Sünden, sondern weil sie Nachkommen Adams sind. Als solche sind sie zum Tod verurteilt. Die Sünde Adams wurde ihnen zugerechnet.
Eine Ausnahme von diesem Prinzip der Sündenanrechnung und ihren Folgen kann nur durch göttliches Eingreifen erfolgen, und historisch gesehen geschah dies nur bei Henoch und Elia. Keiner der beiden Männer erlebte den Tod. Eine weitere Ausnahme werden in Zukunft die Heiligen sein, die zur Zeit der Verzückung noch am Leben sind. Auch sie werden dem physischen Tod entgehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jeder Mensch eine persönliche Sünde hat, was bedeutet, dass er Sünden begeht. Der Grund für die persönliche Sünde ist die Sündennatur, die von Adam geerbt wurde. Die Quelle sowohl der persönlichen Sünde als auch der Sündennatur ist die zugeschriebene Sünde. Jeder Mensch hat aus Gottes Sicht an der Sünde Adams teil, weil ihm die Sünde Adams zugerechnet worden ist
Wer noch tiefer in diesen Vers eintauchen möchte: in dem Buch Biblische Glaubenslehre: Zentrale Themen der Bibel systematisch erklärt gibt es einen ganzen Abschnitt, der auch Wortstudien mit einberzieht!

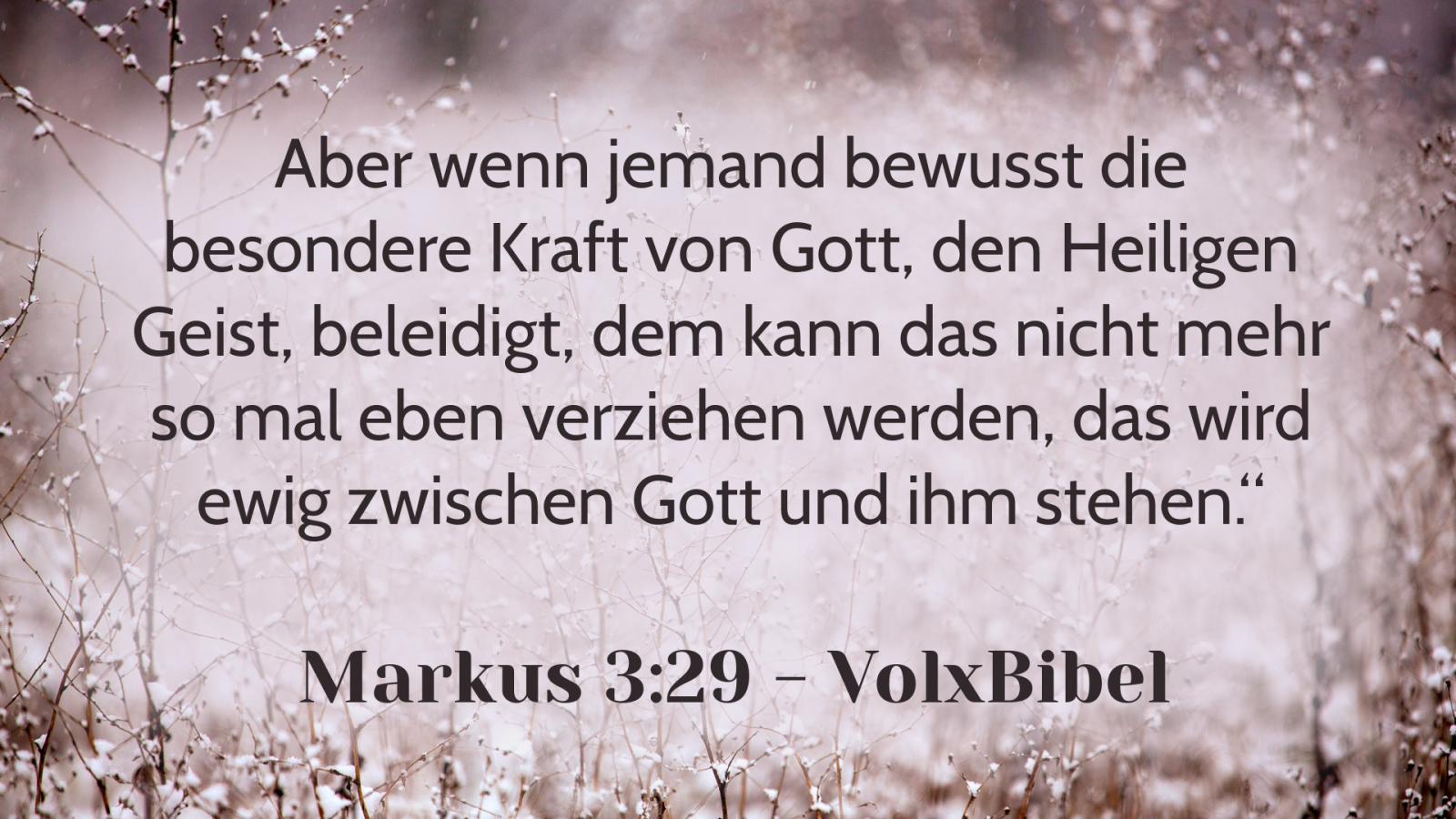
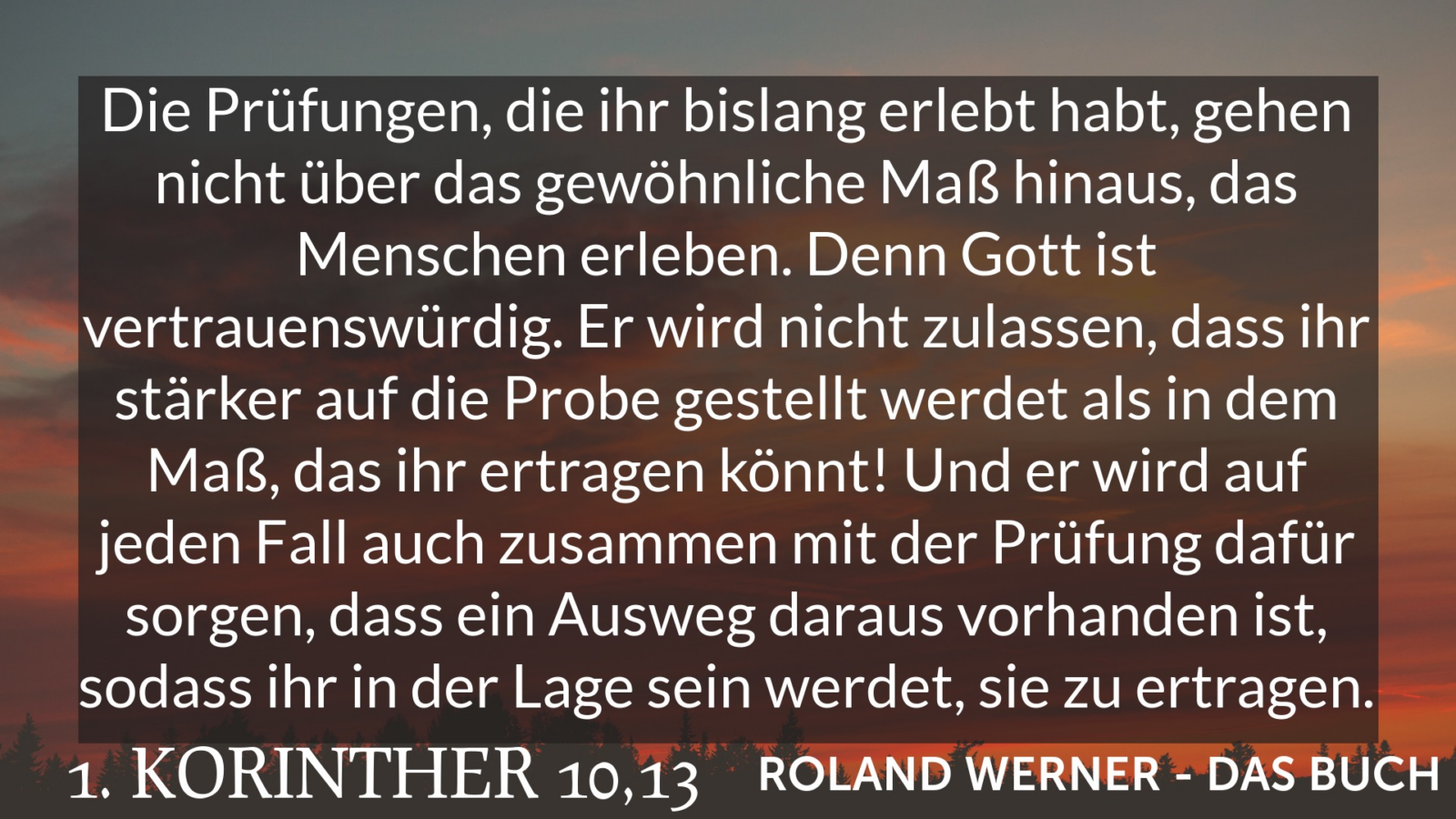
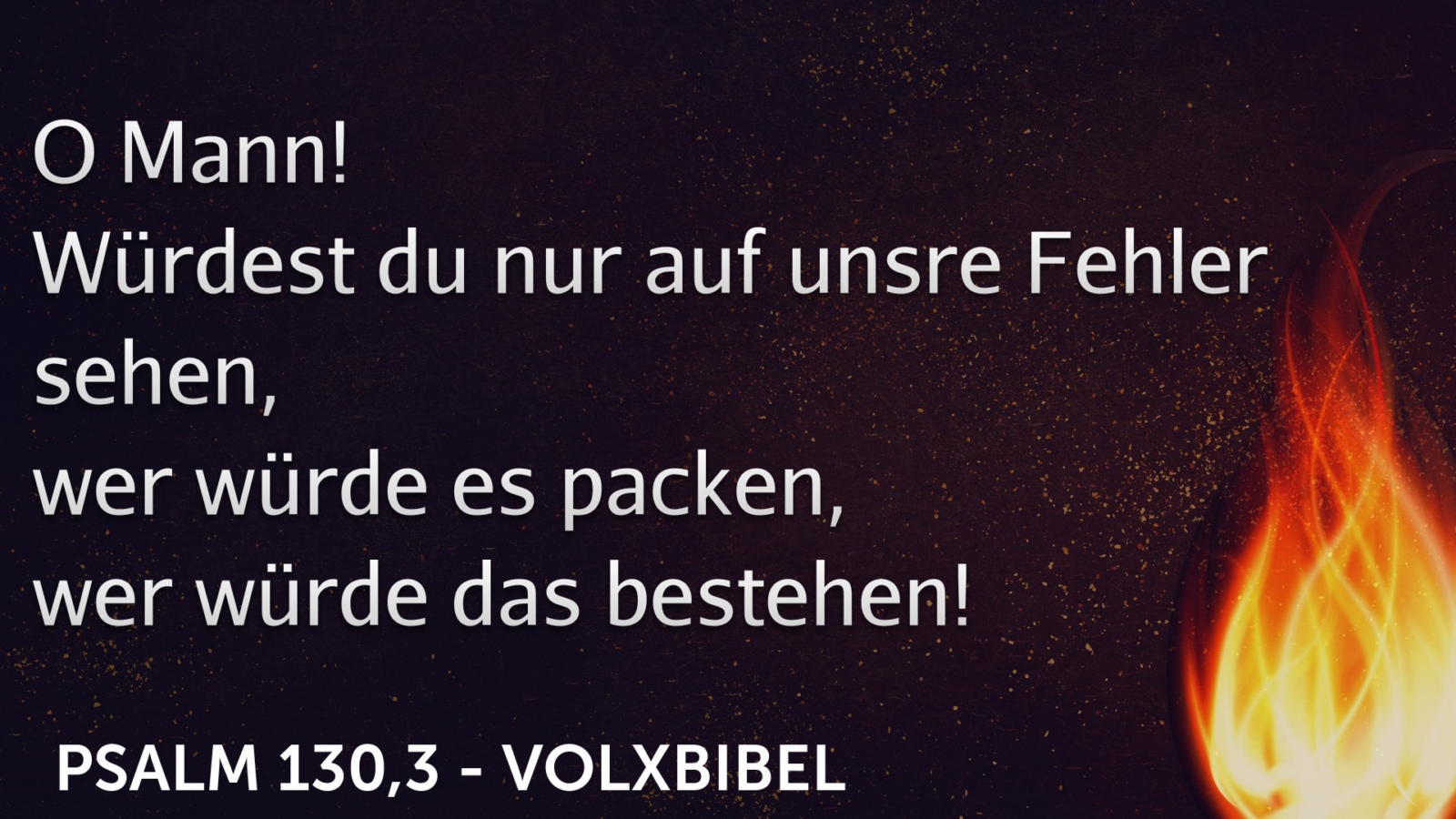
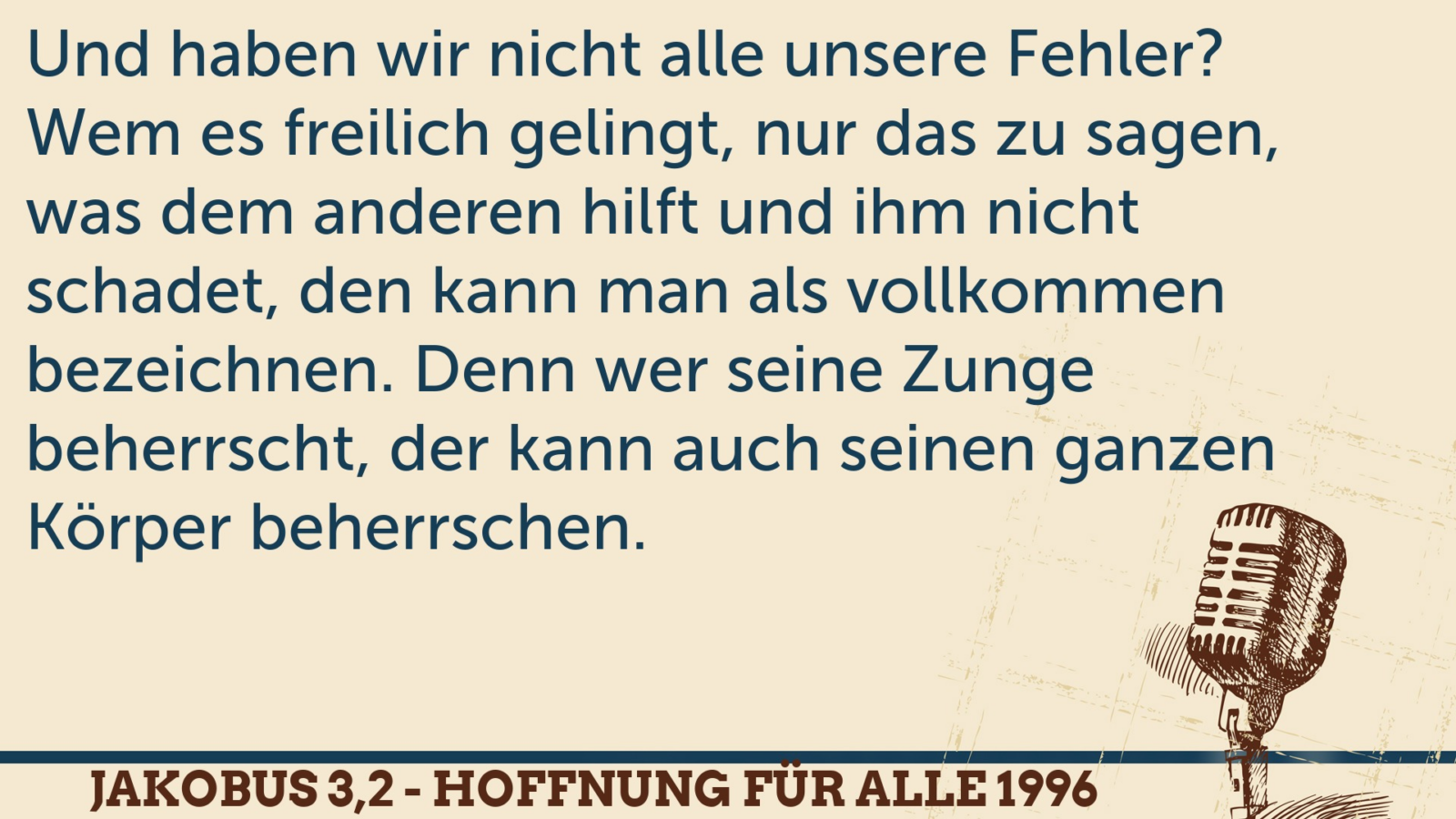

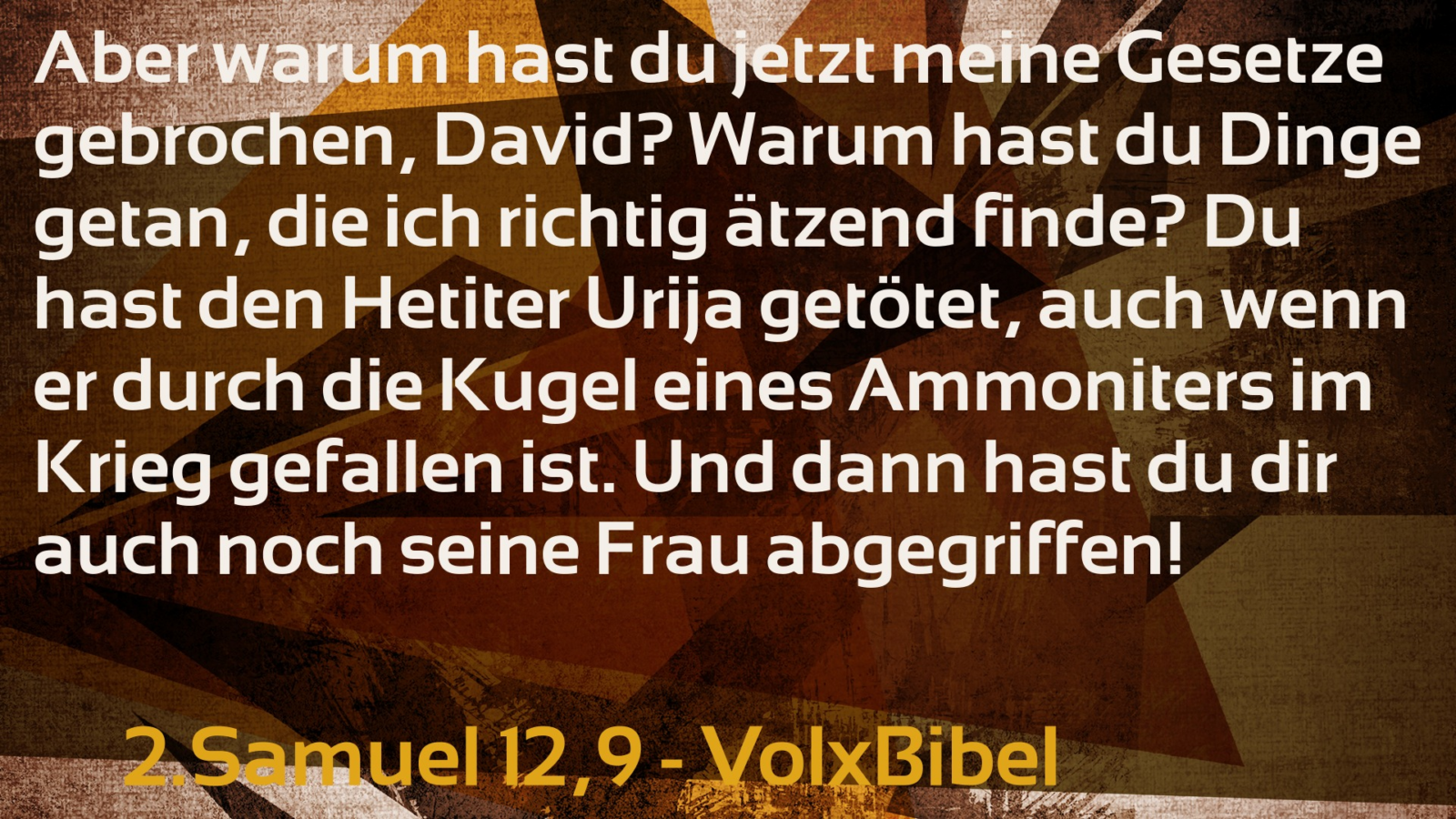
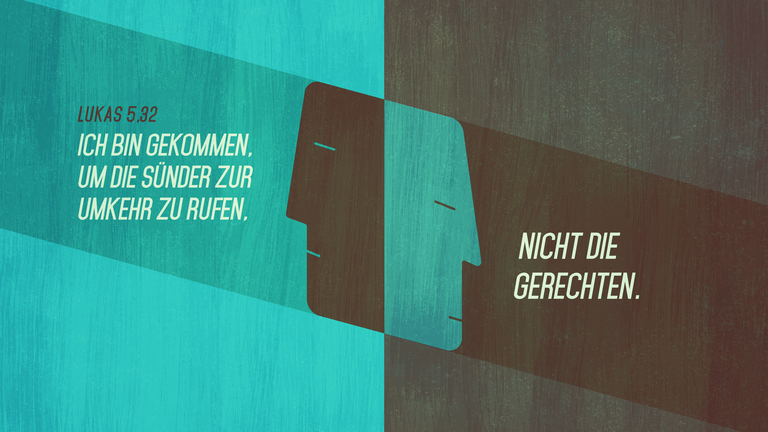
Neueste Kommentare