(Matthäus 21,23-27; Markus 11,27-33; Lukas 20,1-8; Matthäus 22,15-22; Markus 12,13-17; Lukas 20,20-26; Matthäus 22,41-46; Lukas 21,1-4; Johannes 12,20-50).
Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten
DER Bericht über diesen dritten Tag ist so dicht gedrängt, die Akteure auf der Szene sind so zahlreich, die Ereignisse so vielfältig und die Übergänge so schnell, dass es mehr als gewöhnlich schwierig ist, alles in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Wir brauchen uns darüber nicht zu wundern, wenn wir uns daran erinnern, dass dies sozusagen der letzte Arbeitstag Christi war – der letzte Tag Seiner öffentlichen Mission für Israel, soweit es den aktiven Teil betraf; der letzte Tag im Tempel; der letzte Tag der Belehrung und Warnung an Pharisäer und Sadduzäer; der letzte Tag Seines Aufrufs zur nationalen Umkehr.
Dass das, was folgt, zu einem Tag gerechnet werden muss, geht aus dem Umstand hervor, dass sein Beginn von St. Markus ausdrücklich im Zusammenhang mit der Mitteilung über das Verdorren des Feigenbaums erwähnt wird, während sein Ende nicht nur in den letzten Worten der Reden Christi, wie sie von den Synoptikern berichtet werden, angegeben wird,sondern der Beginn eines anderen Tages danach ebenso deutlich gekennzeichnet ist.
In Anbetracht der Vielzahl der Ereignisse ist es besser, sie in Gruppen zusammenzufassen, als ihrer genauen Reihenfolge zu folgen. Dementsprechend wird dieses Kapitel den Ereignissen des dritten Tages der Passionswoche gewidmet sein.
Wie gewöhnlich begann der Tag mit einer Belehrung im Tempel. Wir entnehmen dies der Formulierung: „als er ging“, d.h. in einer der Vorhallen, wo, wie wir wissen, eine große Freiheit der Versammlung, des Gesprächs oder sogar der Belehrung erlaubt war. Es sei daran erinnert, dass die Obrigkeit am Vortag Angst gehabt hatte, sich mit ihm anzulegen. Schweigend hatten sie mit ohnmächtiger Wut die Vertreibung ihrer Händler miterlebt, schweigend hatten sie seiner Lehre zugehört und seine Wunder gesehen. Erst als das Hosanna der kleinen Knaben – vielleicht die Kinder der Leviten, die im Tempel als Chorsänger tätig waren1 – sie aus der Betäubung ihrer Ängste aufweckte, wagten sie eine schwache Gegenrede, in der vergeblichen Hoffnung, dass er sie zu einer Versöhnung bewegen könnte. Aber mit der Nacht und dem Morgen waren andere Ratschläge gekommen. Außerdem waren die Umstände etwas anders. Es war noch früh am Morgen, die Zuhörer waren neu, und der wundersame Einfluss seiner Worte hatte sie noch nicht in seinen Willen eingeweiht. Aus der förmlichen Art und Weise, in der „die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten“ vorgestellt werden,und aus dem Umstand, dass sie Christus so unmittelbar nach seinem Eintritt in den Tempel begegneten, können wir kaum bezweifeln, dass eine, wenn auch informelle,2 Versammlung der Autoritäten stattgefunden hatte, um Maßnahmen gegen die wachsende Gefahr abzustimmen. Dennoch war ihr Vorgehen sowohl von Feigheit als auch von Gerissenheit geprägt. Sie wagten es nicht, sich Ihm direkt zu widersetzen, sondern versuchten, indem sie Ihn in dem einen Punkt angriffen, in dem Er sich angreifbar zu machen schien, sich den Anschein strenger Legalität zu geben und so das Volk gegen Ihn aufzubringen.
Denn es gab keinen Grundsatz, der durch allgemeinen Konsens fester verankert war als der, dass eine autoritative Lehre3 eine vorherige Genehmigung erfordert. Dies ergab sich in der Tat logisch aus dem Prinzip des Rabbinismus. Jede Lehre muss autoritativ sein, da sie traditionell und von der Autorität gebilligt war und von Lehrer zu Schüler weitergegeben wurde. Die höchste Ehre eines Gelehrten bestand darin, dass er einer gut verputzten Zisterne glich, aus der kein Tropfen von dem, was hineingegossen worden war, ausgetreten war. Die letzte Instanz in Diskussionsfällen war immer eine große Autorität, sei es ein einzelner Lehrer oder ein Erlass des Sanhedrins. Auf diese Weise hatte der große Hillel als erster seinen Anspruch geltend gemacht, der Lehrer seiner Zeit zu sein und die damals anhängigen Streitigkeiten zu entscheiden. Eine von der Autorität abweichende Entscheidung war entweder das Zeichen einer unwissenden Anmaßung oder das Ergebnis einer gewagten Rebellion, die in beiden Fällen mit dem „Bann“ geahndet wurde. Und dies war zumindest ein Aspekt der Kontroverse zwischen den obersten Behörden und Jesus. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sich mit einem einfachen Haggadisten – einem populären Erklärer, Prediger oder Legendenerzähler – anzulegen. Aber um autoritär zu lehren, bedurfte es einer anderen Rechtfertigung. In der Tat gab es eine regelmäßige Ordination (Semicha) für das Amt des Rabbiners, Ältesten und Richters, denn die drei Funktionen waren in einem vereint. Nach der Mischna saßen die „Jünger“ in drei Reihen vor dem Sanhedrin, wobei die Mitglieder des Sanhedrins nacheinander aus der ersten Reihe der Gelehrten rekrutiert wurden. Zunächst soll es üblich gewesen sein, dass jeder Rabbi seine eigenen Jünger akkreditierte. Später wurde dieses Recht jedoch auf den Sanhedrin übertragen, mit der Maßgabe, dass dieser nicht ohne die Zustimmung seines Oberhauptes ordinieren durfte, während letzterer dies ohne die Zustimmung des Sanhedrins tun konnte. b Dieses Privileg wurde jedoch später aufgrund von Missbräuchen zurückgenommen. Obwohl wir keine Beschreibung der frühesten Art der Ordination haben, deutet schon der Name – Semicha – auf die Handauflegung hin. In den ältesten Aufzeichnungen, die zweifelsohne bis in die Zeit Christi zurückreichen, war für die Ordination die Anwesenheit von mindestens drei ordinierten Personen erforderlich. In einer späteren Zeit wurde die Anwesenheit eines ordinierten Rabbiners mit der Beisitzerschaft von zwei anderen, auch nicht ordinierten, als ausreichend angesehen. d Im Laufe der Zeit wurden bestimmte Formalitäten hinzugefügt. Der zu Ordinierende musste einen Diskurs halten; Hymnen und Gedichte wurden vorgetragen; der Titel „Rabbi“ wurde dem Kandidaten förmlich verliehen, und ihm wurde die Vollmacht erteilt, zu lehren und als Richter zu handeln [zu binden und zu lösen, schuldig oder frei zu erklären]. Nein, es scheint sogar verschiedene Ordnungen gegeben zu haben, je nach der Autorität, die dem Ordinierten verliehen wurde. Die Formel für die Verleihung der vollen Ordination lautete: „Er soll lehren, er soll lehren, er soll richten, er soll in Fragen der Erstgeburt entscheiden, soll entscheiden, er soll richten! Es gab eine Zeit, in der die Ordination nur im Heiligen Land stattfinden konnte. Diejenigen, die ins Ausland gingen, nahmen ihre „Ordinationsbriefe“ mit.
Zu welchen Zeiten auch immer einige dieser Praktiken eingeführt worden sein mögen, es ist zumindest sicher, dass es zur Zeit unseres Herrn niemand gewagt hätte, ohne entsprechende rabbinische Genehmigung zu lehren. Die Frage, mit der die jüdische Obrigkeit Christus bei seiner Lehre konfrontierte, hatte also eine sehr reale Bedeutung und appellierte an die Gewohnheiten und Gefühle der Menschen, die Jesus zuhörten. Auch sonst war sie listig formuliert. Denn sie forderte ihn nicht nur zum Lehren auf, sondern fragte auch nach seiner Autorität in dem, was er tat; sie bezog sich nicht nur auf sein Werk im Allgemeinen, sondern vielleicht besonders auf das, was am Vortag geschehen war. Sie waren nicht da, um sich ihm zu widersetzen; aber wenn ein Mensch das tat, was er im Tempel getan hatte, war es ihre Pflicht, seine Legitimation zu überprüfen. Schließlich scheint die alternative Frage, von der Markus berichtet: „oder“ – „wenn Du nicht die richtige rabbinische Vollmacht hast“ – „wer hat Dir diese Vollmacht gegeben, diese Dinge zu tun?“ eindeutig auf ihre Behauptung hinzuweisen, dass die Macht, die Jesus ausübte, ihm von niemand anderem als Beelzebul übertragen worden war.
Der Punkt in der Antwort unseres Herrn scheint von den Kommentatoren seltsam übersehen worden zu sein. So wie seine Worte im Allgemeinen verstanden werden, wären sie nur darauf hinausgelaufen, seine Fragesteller zum Schweigen zu bringen – und das in einer Weise, die unter normalen Umständen kaum als fair oder einfallsreich angesehen werden würde. Sie hätten die Frage einfach gegen sich selbst gerichtet und damit wiederum Vorurteile in der Bevölkerung geweckt. Aber die Worte des Herrn bedeuteten etwas ganz anderes. Er antwortete zwar auf ihre Frage, aber er entlarvte auch die List und Feigheit, die ihr zugrunde lagen. Auf die Infragestellung seiner Autorität und den dunklen Hinweis auf das Wirken des Satans antwortete er mit einem Appell an den Täufer. Dieser hatte volles Zeugnis für die Sendung Christi vom Vater gegeben, und „alle Menschen zählten Johannes, dass er wirklich ein Prophet war“. Waren sie zufrieden? Was hielten sie von der Taufe als Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi? Nein? Sie wollten oder konnten nicht antworten! Wenn sie sagten, der Täufer sei ein Prophet gewesen, so bedeutete dies nicht nur die Genehmigung der Sendung Jesu, sondern auch die Aufforderung, an ihn zu glauben. Andererseits hatten sie Angst, Johannes öffentlich zu verleugnen! Und so traten ihre Gerissenheit und Feigheit offen zutage, als sie sich auf Unwissenheit beriefen – ein Vorwand, der so grob und offenkundig unehrlich war, dass Christus, nachdem er das gegeben hatte, was alle als vollständige Antwort empfunden haben mussten, eine weitere Diskussion mit ihnen über diesen Punkt ablehnen konnte.
Nachdem ihr Versuch, ihn mit den kirchlichen Behörden in Konflikt zu bringen, gescheitert war, versuchten sie als Nächstes den viel gefährlicheren Versuch, ihn mit den zivilen Behörden in Konflikt zu bringen. Wenn wir uns an die stets wachsame Eifersucht Roms, die rücksichtslose Tyrannei des Pilatus und die niederträchtigen Machenschaften des Herodes erinnern, der sich zu jener Zeit in Jerusalem aufhielt,spüren wir instinktiv, dass selbst der kleinste Kompromiss Jesu in Bezug auf die Autorität des Cäsars absolut verhängnisvoll gewesen wäre. Hätte man aufgrund unbestreitbarer Zeugenaussagen beweisen können, dass Jesus sich auf die Seite der so genannten „nationalistischen“ Partei gestellt oder sie sogar unterstützt hätte, wäre er wie Judas von Galiläa schnell untergegangen. a Die jüdischen Führer hätten so ihr Ziel leicht erreicht, und die Unbeliebtheit wäre nur auf die verhasste römische Macht zurückgefallen. Wie groß die Gefahr war, die Jesus drohte, geht daraus hervor, dass trotz seiner klaren Antwort der Vorwurf gegen ihn vor Pilatus erhoben wurde, er habe das Volk verführt, indem er es verboten habe, Cäsar Tribut zu zahlen.
Das Komplott, um das es sich handelte,war äußerst raffiniert ausgeheckt. Das Ziel war, seine innersten Gedanken „auszuspionieren“,d und ihn, wenn möglich, in seine Rede zu „verwickeln“. Zu diesem Zweck kamen nicht die alten Pharisäer, die er kannte und denen er misstraut hätte, sondern einige ihrer Jünger – offenbar frische, ernsthafte, eifrige und gewissenhafte Männer. Zu ihnen gesellten sich einige der „Herodianer“ – natürlich keine Sekte oder religiöse Schule, sondern eine politische Partei jener Zeit. Wir wissen verhältnismäßig wenig über die tieferen politischen Bewegungen in Judäa, nur so viel, wie Josephus aufzeichnen konnte. Aber wir können nicht viel falsch machen, wenn wir die Herodianer als eine Partei betrachten, die das Haus des Herodes als Inhaber des jüdischen Throns ehrlich akzeptierte. Im Unterschied zum extremen Teil der Pharisäer, die Herodes hassten, und zu den „Nationalisten“ könnte es sich um eine mittlere oder gemäßigte jüdische Partei gehandelt haben – halb römisch und halb nationalistisch. Wir wissen, dass Herodes Antipas bestrebt war, ganz Palästina wieder unter seiner Herrschaft zu vereinen; aber wir wissen nicht, welche Intrigen zu diesem Zweck sowohl mit den Pharisäern als auch mit den Römern geschmiedet worden sein mögen. Es ist auch nicht das erste Mal in dieser Geschichte, dass wir die Pharisäer und die Herodianer zusammenfinden. 1 Herodes mag in der Tat nicht gewillt gewesen sein, sich unbeliebt zu machen, indem er persönlich gegen den großen Propheten von Nazareth vorging, zumal er sich noch lebhaft daran erinnert haben muss, was ihn der Mord an Johannes gekostet hatte. Vielleicht hätte er sich, wenn es ihm möglich gewesen wäre, gerne seiner bedient und ihn als den volkstümlichen Messias gegen die Volksführer ausgespielt. Aber so, wie die Dinge gelaufen waren, muss er darauf bedacht gewesen sein, sich eines möglicherweise gefährlichen Rivalen zu entledigen, während seine Partei gleichzeitig gerne mit den Pharisäern zusammenarbeiten würde, um sich deren Dankbarkeit und Gefolgschaft zu sichern. So oder ähnlich mögen die Motive gewesen sein, die zu diesem seltsamen Bündnis von Pharisäern und Herodianern führten.
Sie gaben sich als Gerechte aus und traten nun mit honigsüßen Worten an Jesus heran, um nicht nur sein Misstrauen zu zerstreuen, sondern ihn durch einen Appell an seine Furchtlosigkeit und die Einzigartigkeit seines moralischen Willens dazu zu bewegen, sich vorbehaltlos zu verpflichten. War es für sie rechtmäßig, Cäsar Tribut zu zahlen oder nicht? Sollten sie die Kopfsteuer von einer Drachme zahlen oder sie verweigern? Wir wissen, wie das spätere Judentum auf eine solche Frage geantwortet hätte. Es stellt den Grundsatz auf, dass das Münzrecht die Befugnis zur Erhebung von Steuern einschließt und in der Tat einen solchen Beweis für eine faktische Regierung darstellt, dass es die Pflicht ist, sich ihr unbedingt zu unterwerfen. Dies wurde so sehr empfunden, dass die Makkabäer und im letzten jüdischen Krieg Bar Kokhabh, der falsche Messias, eine Münze herausgaben, die auf die Befreiung Jerusalems zurückging. Wir können daher nicht daran zweifeln, dass dieses Prinzip der Münzprägung, der Besteuerung und der Regierung in Judäa allgemein akzeptiert wurde. Andererseits gab es im Land eine starke Partei, mit der nicht nur politisch, sondern auch religiös viele der edelsten Geister sympathisierten, die behauptete, dass die Zahlung von Tributgeld an Cäsar praktisch bedeutete, seine königliche Autorität anzuerkennen und damit diejenige Jehovas zu verleugnen, der allein Israels König war. Sie würden argumentieren, dass all das Elend des Landes und des Volkes auf diese nationale Untreue zurückzuführen sei. Dies war in der Tat das Grundprinzip der nationalistischen Bewegung. Die Geschichte hat viele ähnliche Bewegungen aufgezeichnet, in denen sich starke politische Gefühle auf seltsame Weise mit religiösem Fanatismus vermischt haben und die in ihren Reihen zusammen mit skrupellosen Parteigängern nicht wenige aufrichtige Patrioten oder ernsthafte Religiöse zählten. In einem früheren Teil dieses Buches wurde angedeutet, dass die nationalistische Bewegung auf einige der früheren Anhänger Jesu eine wichtige vorbereitende Wirkung gehabt haben könnte, vielleicht zu Beginn ihrer Nachforschungen, so wie im Westen die alexandrinische Philosophie für viele eine Vorbereitung auf das Christentum war. 1 Auf jeden Fall hätte der von diesen Männern geäußerte Skrupel, wenn er echt wäre, Sympathie hervorgerufen. Aber was war die Alternative, die sich Christus hier bot? Hätte er „Nein“ gesagt, hätte er zur Rebellion aufgefordert; hätte er einfach „Ja“ gesagt, hätte er tiefe Gefühle schmerzlich verletzt und in gewisser Weise in den Augen des Volkes seinen eigenen Anspruch, Israels Messias-König zu sein, Lügen gestraft!
Aber der Herr entkam dieser „Versuchung“, denn da er wahrhaftig war, stellte sie für ihn keine wirkliche Versuchung dar. Ihre Tücke und Heuchelei hat er sofort erkannt und entlarvt, indem er auch auf ihre Berufung, „wahrhaftig“ zu sein, reagierte. Noch einmal und mit Nachdruck müssen wir die Vorstellung zurückweisen, dass die Antwort Christi eher ein Ausweichen vor der Frage war als eine Antwort. Es war eine sehr wirkliche Antwort, als er auf das Bild und die Inschrift auf der Münze2 hinwies, nach der er gerufen hatte, und sagte: „Was Cäsar gehört, gehört Cäsar, und was Gott gehört, gehört Gott. „Das war weit mehr als eine Zurechtweisung ihrer Heuchelei und Anmaßung; es beantwortete nicht nur diese ihre Frage für alle ernsthaften Menschen jener Zeit, wie sie sich ihnen stellen würde, sondern es legt für alle Zeiten und für alle Umstände den Grundsatz fest, der ihr zugrunde liegt. Das Reich Christi ist nicht von dieser Welt; eine wahre Theokratie ist nicht unvereinbar mit der Unterwerfung unter die weltliche Macht in Dingen, die wirklich ihre eigenen sind; Politik und Religion schließen einander weder ein noch aus: sie sind nebeneinander in verschiedenen Bereichen. Der Staat ist göttlich sanktioniert, und die Religion ist göttlich sanktioniert – und beide sind gleichermaßen von Gott verordnet. Nach diesem Prinzip regelte die apostolische Autorität die Beziehungen zwischen Kirche und Staat, auch wenn letzterer heidnisch war. Die Frage nach den Grenzen der beiden Provinzen ist von Sektierern auf beiden Seiten heftig diskutiert worden, die sich auf den Ausspruch Christi berufen haben, um das eine oder das andere Extrem zu unterstützen, das sie vertreten haben. Und doch scheint es für den einfachen Sucher nach der Pflicht nicht so schwierig zu sein, den Unterschied zu erkennen, wenn es uns nur gelingt, uns von logischen Finessen und belastenden Schlussfolgerungen zu befreien.
Es war eine Antwort, die nicht nur äußerst wahrheitsgetreu, sondern auch von wunderbarer Schönheit und Tiefe war. Sie hob die Kontroverse in eine ganz andere Sphäre, in der es keinen Konflikt zwischen dem, was Gott und dem Menschen zusteht, gab – ja, überhaupt keinen Konflikt, sondern göttliche Harmonie und Frieden. Auch sprach sie nicht hart über die nationalistischen Bestrebungen, noch plädierte sie für die Sache Roms. Sie sagte nicht, ob die Herrschaft Roms richtig war oder dauerhaft sein sollte, sondern nur, was alle als göttlich empfunden haben müssen. Und so gingen sie, die gekommen waren, um ihn zu „verstricken“, „weg“, nicht überzeugt noch bekehrt, sondern höchst erstaunt.
Wenn wir nun von den Spitzfindigkeiten der Sadduzäer und den Widersprüchen der Schriftgelehrten absehen, kommen wir unerwartet zu einem jener süßen Bilder – einer historischen Miniatur, wie sie sich uns darbietet -, die dem Auge inmitten der grellen Umgebung eine echte Erleichterung verschaffen. Von der bitteren Bosheit Seiner Feinde und dem über sie vorhergesagten Gericht wenden wir uns der stillen Anbetung derjenigen zu, die alles gegeben hat, und den Worten, mit denen Jesus dies anerkennt, was ihr unbekannt ist. Sie kommt uns umso willkommener vor, als sie in der Tat zeigt, was Christus zu jenen Heuchlern gesagt hatte, die darüber diskutierten, ob der Tribut, der Cäsar gegeben wurde, nicht Gott dessen beraubte, was ihm gehörte. Wahrlich, hier war eine, die in der Einfachheit ihrer demütigen Anbetung dem Herrn gab, was Sein war!
Des Streites überdrüssig, hatte der Meister diejenigen, zu denen er gesprochen hatte, in den Vorhallen zurückgelassen und war, während die Menge über seine Worte oder seine Person stritt, die Treppe hinaufgestiegen, die von der „Terrasse“ in das Tempelgebäude führte. Von diesen Stufen aus – ob sie nun zum „Schönen Tor“ oder zu einem der Seitentore führten – konnte Er den „Hof der Frauen“, zu dem sie führten, vollständig einsehen. Auf diesen Stufen oder innerhalb des Tores (denn an keinem anderen Ort war es erlaubt) setzte Er sich nieder und beobachtete die Menge. Die Zeit des Opfers war vorbei, und die, die sich noch aufhielten, waren zur privaten Andacht, zu privaten Opfern oder zur Entrichtung ihrer Gelübde und Opfergaben geblieben. Obwohl die Topographie des Tempels, insbesondere dieses Teils, nicht unproblematisch ist, wissen wir, dass unter den Kolonnaden, die den „Hof der Frauen“ umgaben, aber in der Mitte noch Platz für mehr als 15.000 Gläubige ließen, Vorkehrungen für die Entgegennahme religiöser und wohltätiger Spenden getroffen wurden. Entlang dieser Kolonnaden befanden sich die dreizehn trompetenförmigen Kästen (Shopharoth); irgendwo hier müssen wir auch zwei Kammern lokalisieren:die der „Stummen“, für Geschenke, die im Geheimen an die Kinder der frommen Armen verteilt wurden, und die, in der Votivgefäße deponiert wurden. Vielleicht gab es hier auch eine besondere Kammer für Opfergaben. c Diese „Trompeten“ trugen jeweils Inschriften, die den Gegenstand der Spende kennzeichneten – ob zur Wiedergutmachung vergangener Versäumnisse, zur Bezahlung bestimmter Opfer, zur Bereitstellung von Weihrauch, Holz oder anderen Gaben.
Während sie zu dieser oder jener Schatztruhe gingen, muss es besonders an diesem Tag von großem Interesse gewesen sein, die Geber zu beobachten. Einige kamen mit dem Anschein von Selbstgerechtigkeit, einige sogar mit Prahlerei, andere als fröhliche Erfüller einer glücklichen Pflicht. Viele, die reich waren, gaben viel – ja, sehr viel, denn die Tendenz war so groß, dass (wie bereits erwähnt) ein Gesetz erlassen werden musste, das es verbot, mehr als einen bestimmten Teil seines Besitzes für den Tempel zu spenden. Und die Höhe solcher Beiträge kann man erahnen, wenn man sich den Umstand vergegenwärtigt, dass zur Zeit von Pompeius und Crassus die Tempel-Kasse, nachdem sie alle möglichen Ausgaben verschwenderisch bestritten hatte, fast eine halbe Million an Geld und kostbare Gefäße im Wert von fast zwei Millionen Pfund Sterling enthielt.
Und als Jesus so auf diesen Stufen saß und auf das sich ständig verändernde Panorama blickte, wurde sein Blick von einer einsamen Gestalt gefesselt. Die einfachen Worte des heiligen Markus skizzieren eine Geschichte von einzigartigem Pathos. Es war eine arme Witwe. Wir sehen sie allein kommen, als ob sie sich schämte, sich unter die Menge der reichen Geber zu mischen; sie schämte sich, dass ihre Gabe gesehen wurde; sie schämte sich vielleicht, sie zu bringen; eine „Witwe“ im Gewand einer verzweifelten Trauernden; ihr Zustand, ihr Aussehen und ihre Haltung waren die einer „Armen“. Er beobachtete sie genau und las sie richtig. Sie hielt nur die kleinsten Münzen in der Hand: „zwei Perutahs“ – und es sollte bekannt sein, dass es nicht erlaubt war, einen geringeren Betrag zu spenden. Diese zwei Perutahs ergaben zusammen einen Quadrans, was dem sechsundneunzigsten Teil eines Denars entsprach, der wiederum einen Wert von etwa sieben Pence hatte. Aber es war „ihr ganzer Lebensunterhalt“ (βίος), vielleicht alles, was sie aus ihrer spärlichen Haushaltskasse hatte retten können; wahrscheinlicher ist, dass es alles war, wovon sie für diesen Tag leben musste, bis sie sich mehr zu schaffen machte. Und davon brachte sie nun Gott ein demütiges Opfer dar. Er sprach ihr keine Worte der Ermutigung zu, denn sie wandelte im Glauben; er versprach ihr keine Gegenleistung, denn ihr Lohn war im Himmel. Sie wusste nicht, dass es jemand gesehen hatte, denn das Wissen um die Augen, die sich auf sie richteten, selbst die seinen, hätte die reinen Wangen ihrer Liebe mit Scham erröten lassen, und jedes Wort, jede bewusste Bemerkung oder jedes Versprechen hätte den aufsteigenden Weihrauch ihres Opfers getrübt und beiseite geschoben. Aber für alle Zeiten ist es in der Kirche geblieben, wie der Duft von Marias Alabaster, der das Haus erfüllte, diese Tat des selbstverleugnenden Opfers. Mehr, weit mehr als die großen Gaben ihres „Überflusses“, die die Reichen einwarfen, war und ist für alle Zeiten die Gabe der absoluten Selbsthingabe und des Opfers, das die einsame Trauernde zitternd darbrachte. Und obwohl Er nicht zu ihr sprach, muss der Sonnenschein Seiner Worte in die dunkle Trostlosigkeit ihres Herzens gefallen sein; und obwohl sie vielleicht nicht wusste, warum, muss es ein glücklicher Tag, ein Tag des reichen Festes im Herzen gewesen sein, als sie „ihr ganzes Leben“ Gott übergab. Und so ist vielleicht jedes Opfer für Gott umso gesegneter, wenn wir nicht wissen, wie gesegnet es ist.
Wäre diese Lektion doch für alle Zeiten von der Kirche nicht theoretisch, sondern praktisch beherzigt worden! Wie viel reicher wäre ihre „Schatzkammer“ gewesen: doppelt gesegnet an Gaben und Gebern. Aber so ist die Legende nicht geschrieben. Wäre es eine Geschichte, die zu einem bestimmten Zweck erfunden oder mit Flitter geschmückt worden wäre, hätten sich der Heiland und die Witwe nicht so getrennt – sie hätten sich nicht auf der Erde, sondern im Himmel getroffen und gesprochen. Sie hätte angebetet, und er hätte etwas Großes gesagt oder getan. Ihr Schweigen war ein Stelldichein für den Himmel.
Ein weiteres Ereignis von feierlicher, freudiger Bedeutung bleibt an diesem Tag festzuhalten. Aber es ist so eng mit dem verbunden, was der Herr danach sprach, dass die beiden nicht getrennt werden können. Es wird nur vom heiligen Johannes berichtet, der es, wie bereits erklärt1 , als eine von mehreren aufeinanderfolgenden Offenbarungen des Christus erzählt: zuerst bei seinem Einzug in die Stadt und dann im Tempel – nacheinander bei den Griechen, durch die Stimme vom Himmel und vor dem Volk.
So wertvoll jeder Teil und jeder Vers hier für sich genommen ist, so schwierig ist es, sie zusammenzufügen und ihren Zusammenhang und ihre Bedeutung zu zeigen. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass wir in der Erzählung des Evangeliums nur einen kurzen Bericht haben, sozusagen Überschriften, Zusammenfassungen, Umrisse, und nicht einen Bericht. Auch kennen wir die Begleitumstände nicht. Die Worte, die Christus nach der Bitte der Griechen, in seine Gegenwart eingelassen zu werden, sprach, mögen auch einen besonderen Hinweis auf den Zustand der Jünger und ihre mangelnde Bereitschaft enthalten, in seine vorausgesagten Leiden einzutreten und sie zu teilen. Und dies könnte wiederum mit der Vorhersage Christi und seiner Rede über „die letzten Dinge“ zusammenhängen.Denn die Stellung der Erzählung im Johannesevangelium scheint anzudeuten, dass es sich um das letzte Ereignis jenes Tages, ja um den Abschluss des öffentlichen Wirkens Christi handelt. In diesem Fall würden die Worte und Ermahnungen, die sonst in ihrem Zusammenhang etwas rätselhaft sind, eine neue Bedeutung erhalten.
Es war damals, wie wir vermuten, der Abend eines langen und ermüdenden Tages der Lehre. Während die Sonne sich ihrem Untergang in Rot näherte, hatte Er von jenem anderen Sonnenuntergang gesprochen, bei dem der Himmel im Gericht glühte, und von der Dunkelheit, die folgen würde – aber auch von dem besseren Licht, das in ihr aufgehen würde. Und in diesen Tempelgängen hatten sie ihn gehört – sie sahen ihn gestern in seinem Wunderwirken und hörten ihn an diesem Tag in seiner Wunderrede -, diese „Männer in anderen Sprachen“. Sie waren Proselyten“, gebürtige Griechen, die sich ihren Weg zur Vorhalle des Judentums gebahnt hatten, gerade als die ersten Lichtstrahlen auf den Altar fielen. Sie müssen in ihrem Innersten aufgewühlt gewesen sein; sie spürten, dass Er gerade für solche wie sie und zu ihnen sprach; dass dies das war, was sie im Alten Testament erahnt, vorausgesehen, schwach gehofft hatten, wenn sie es auch nicht gesehen hatten – sein großer Glaube, seine große Hoffnung, seine große Wirklichkeit. Nicht einer nach dem anderen und fast heimlich sollten sie von nun an zum Tor kommen, sondern die Pforten sollten weit aufgerissen werden, und als das goldene Licht auf den Weg strömte, stand Er da, jene strahlende göttliche Persönlichkeit, die nicht nur der Sohn Davids, sondern der Menschensohn war, um ihnen den Willkommensgruß des Vaters für das Königreich zu überbringen.
Und so hätten sie ihn, als sich die Schatten um den Tempelhof und die Vorhallen verdichteten, gerne gesehen, nicht aus der Ferne, sondern aus der Nähe: mit ihm gesprochen. Sie waren „Proselyten der Gerechtigkeit“ geworden, sie würden Jünger „des Herrn, unserer Gerechtigkeit“ werden; als Proselyten waren sie nach Jerusalem gekommen, „um anzubeten“, und sie würden lernen, zu loben. Doch in der schlichten, selbstvergessenen Bescheidenheit ihrer religiösen Kindheit wagten sie es nicht, direkt zu Jesus zu gehen, sondern kamen mit ihrer Bitte zu Philippus von Bethsaida. Wir wissen nicht, warum sie sich an ihn wandten: ob es familiäre Verbindungen waren, oder ob seine Ausbildung oder frühere Umstände Philippus mit diesen „Griechen“ verbanden, oder ob irgendetwas in seiner Position im apostolischen Kreis oder etwas, das sich gerade ereignet hatte, ihre Wahl beeinflusste. Und auch er – so unwissend waren die Apostel über die innerste Bedeutung ihres Meisters – wagte es nicht, direkt zu Jesus zu gehen, sondern ging zu seinem eigenen Stadtbewohner, der sein früherer Freund und Mitschüler gewesen war und nun der Person des Meisters so nahe stand – Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Gemeinsam kamen die beiden zu Jesus, Andreas offenbar als erster. Die Antwort Jesu deutet darauf hin, was wir auf jeden Fall erwartet hätten, dass die Bitte dieser heidnischen Bekehrten erfüllt wurde, obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird, und es ist äußerst schwierig zu bestimmen, ob und welcher Teil seiner Worte an die Griechen und welcher an die Jünger gerichtet war. Vielleicht sollten wir die einleitenden Worte so betrachten, dass sie sich auf die Bitte der Griechen beziehen und daher in erster Linie an die Jünger gerichtet sind,aber auch als Einleitung zu den folgenden Worten dienen, die in erster Linie zu den Griechen gesprochen wurden,b in zweiter Linie aber auch zu den Jüngern, und die sich auf das schreckliche, immer nahe Geheimnis seines Todes und ihrer Taufe in ihn beziehen.
Indem wir diese „Griechen“ herankommen sehen, scheint sich der Anfang der Geschichte Christi an ihrem Ende zu wiederholen. Nicht mehr im Stall von Bethlehem, sondern im Tempel huldigen „die Weisen“, die Vertreter der heidnischen Welt, dem Messias. Aber das Leben, das damals begonnen hatte, lag nun hinter ihm – und doch in gewissem Sinne vor ihm. Die Stunde der Entscheidung war gekommen. Nicht nur als Messias Israels, sondern in seiner weltweiten Rolle als „Menschensohn“ sollte er verherrlicht werden, indem er die Huldigung der heidnischen Welt empfing, deren Symbol und Erstlingsfrucht er nun vor sich hatte. Aber nur auf eine Weise konnte er so verherrlicht werden: indem er für die Erlösung der Welt starb und so allen Gläubigen das Himmelreich eröffnete. Auf tausend Hügeln sollte die herrliche Ernte im goldenen Sonnenlicht erbeben; aber das Weizenkorn, das in die Erde fällt, muss, während es fällt, sterben, seine Hüllen sprengen und so in ein sehr vielfältiges Leben eintreten. Sonst wäre es allein geblieben. Dies ist das große Paradoxon des Reiches Gottes – ein Paradoxon, das sein Symbol und seine Entsprechung in der Natur hat und das auch fast zum Gesetz des Fortschritts in der Geschichte geworden ist: dass das Leben, das nicht aus dem Tod hervorgegangen ist, allein bleibt und wirklich der Tod ist, und dass der Tod das Leben ist. Ein Paradoxon also, das seinen letzten Grund darin hat, dass die Sünde in die Welt gekommen ist.
Und wie der Meister, der Fürst des Lebens, so auch die Jünger, die das Leben hervorbringen. Wenn er in dieser Welt der Sünde wie das Samenkorn in die Erde fallen und sterben muss, damit viele aus ihm hervorgehen, so müssen auch sie ihr Leben hassen, damit sie es für das ewige Leben bewahren. Indem sie ihm dienen, müssen sie ihm nachfolgen, damit auch sie dort sind, wo er ist; denn der Vater wird die ehren, die den Sohn ehren.
Es ist uns nun hinreichend klar, dass unser Herr in erster Linie zu diesen Griechen und in zweiter Linie zu seinen Jüngern über die Bedeutung seines bevorstehenden Todes, über die Notwendigkeit, ihm darin treu zu sein, und über den damit verbundenen Segen gesprochen hat. Dennoch war Er sich der schrecklichen Realitäten, die damit verbunden waren, nicht unbewusst. Er war ein wahrer Mensch, und Seine menschliche Seele war angesichts dessen beunruhigt:1 Wahrer Mensch, deshalb fühlte Er es; wahrer Mensch, deshalb sprach Er es aus, und so sympathisierte Er auch mit ihnen in ihrem kommenden Kampf. Wahrhaftig Mensch, aber auch wahrhaftig mehr als Mensch – und daher sowohl der ausgesprochene Wunsch als auch gleichzeitig der Sieg über diesen Wunsch: „Was soll ich sagen? „Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber um dieser Sache willen bin ich zu dieser Stunde gekommen!“ Und der scheinbare Zwiespalt wird aufgelöst, indem sowohl das Menschliche als auch das Göttliche im Sohn – der Glaube und das Sehen – in herrlicher Übereinstimmung zusammenkommen: „Vater, verherrliche Deinen Namen!
Eine solche Bitte und ein solches Gebet, das unter solchen Umständen vorgebracht wurde, hätte nicht ungehört bleiben können, wenn er der Messias, der Sohn Gottes, gewesen wäre. Wie bei seiner Taufe, so kam auch bei dieser Taufe der Selbsterniedrigung und der absoluten Unterwerfung unter das Leiden eine Stimme vom Himmel, die für alle hörbar war, deren Worte aber nur für ihn verständlich waren: „Ich habe es verherrlicht und werde es wieder verherrlichen“ Worte, die das göttliche Siegel der Bestätigung für das ganze bisherige Werk Christi trugen und es für das kommende versicherten. Die Worte der Bestätigung konnten nur für ihn selbst gelten; „die Stimme“ war für alle. Was machte es schon aus, dass einige von ihr wie von einem Donnerschlag an einem Frühlingsabend sprachen, während andere mit mehr Verstand an Engelsstimmen dachten? Für Ihn trug sie die Gewissheit, die die ganze Zeit über der Grund Seiner Ansprüche gewesen war, wie sie auch der Trost in Seinen Leiden war, dass, so wie Gott sich in der Vergangenheit im Sohn verherrlicht hatte, dies auch in der Zukunft in der Vollendung des Werkes geschehen würde, das Ihm zu tun gegeben war. Und das sagte er nun, als er diese Griechen als Sinnbild und Erstlingsgabe des in seinem Leiden vollendeten Werkes betrachtete und die Mühen seiner Seele sah und zufrieden war. Von beidem redete Er in der prophetischen Gegenwart. Seiner Ansicht nach war das Gericht bereits über diese Welt gekommen, da sie in der Macht des Bösen lag, da der Fürst dieser Welt aus seiner gegenwärtigen Herrschaft vertrieben worden war. Und an seiner Stelle zog der gekreuzigte Christus, „aus der Erde erhöht“ – im doppelten Sinne -, als Ergebnis seines Werkes mit souveräner, siegreicher Macht „alles“ zu sich und mit sich hinauf.
Die Juden, die es hörten, verstanden Ihn so weit, dass sich Seine Worte auf Seine Entfernung von der Erde oder Seinen Tod bezogen, da dies eine übliche jüdische Ausdrucksweise war (סלק מן העולם). 4 Aber sie verstanden nicht Seine besondere Bezugnahme auf die Art und Weise davon. Und doch war es angesichts des besonders schändlichen Kreuzestodes von größter Wichtigkeit, dass er immer auch darauf hinwies. Aber selbst in dem, was sie verstanden, hatten sie eine Schwierigkeit. Sie verstanden Ihn so, dass Er von der Erde genommen werden würde; und doch waren sie immer von der Heiligen Schrift1 gelehrt worden, dass der Messias, wenn er sich vollständig offenbart hatte, für immer bleiben sollte, oder, wie die Rabbiner es ausdrückten, dass auf seine Herrschaft die Auferstehung folgen sollte. Oder bezog er sich mit dem Ausdruck „Menschensohn“ auf einen anderen? Auf den kontroversen Teil ihrer Frage ging der Herr nicht ein, und es wäre auch nicht angebracht gewesen, dies in dieser „Stunde“ zu tun. Aber auf ihre Frage antwortete er ausführlich, und zwar mit einer so ernsten, liebevollen Ermahnung, wie es seine letzte Ansprache im Tempel war. Ja, so war es! Aber eine kleine Weile würde das Licht unter ihnen sein. Sie sollen sich beeilen, es zu nutzen,3 damit sie nicht von der Finsternis eingeholt werden – und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Oh, dass seine Liebe sie hätte aufhalten können! Solange sie noch „das Licht“ hatten, sollten sie lernen, an das Licht zu glauben, damit sie Kinder des Lichts würden!
Es waren seine letzten Worte des Appells an sie, bevor er sich zurückzog, um seinen Seelensabbat vor dem großen Wettkampf zu verbringen. Und der Schreiber des vierten Evangeliums fasst in einem Epilog den großen Gegensatz zwischen Israel und Christus zusammen. b Obwohl er so viele Wunder getan hatte, glaubten sie nicht an ihn – und dieser ihr vorsätzlicher Unglaube war die Erfüllung der alten Prophezeiung des Jesaja über den Messias. dererseits war ihr vorsätzlicher Unglaube auch das prophezeite Gericht Gottes. d Wer den Verlauf dieser Geschichte verfolgt hat, muss vor allem dies gelernt haben: Die Verwerfung Christi durch die Juden war kein isolierter Akt, sondern das Ergebnis und die direkte Folge ihrer gesamten bisherigen religiösen Entwicklung. Angesichts der klarsten Beweise haben sie nicht geglaubt, weil sie nicht glauben konnten. Der lange Verlauf ihres Widerstands gegen die prophetische Botschaft und ihre Pervertierung derselben war selbst eine Verhärtung ihres Herzens, wenn auch gleichzeitig ein von Gott verhängtes Urteil über ihren Widerstand. Weil sie nicht glauben wollten – durch diese ihre geistige Verdunkelung, die als göttliches Gericht über sie kam, obwohl sie im natürlichen Verlauf ihrer selbstgewählten religiösen Entwicklung lag -, deshalb glaubten sie trotz aller Beweise nicht, als Er kam und solche Wunder vor ihnen tat. Und all dies in Übereinstimmung mit der Prophezeiung, als Jesaja in einer fernen Vision die helle Herrlichkeit1 des Messias sah und von ihm sprach. So weit Israel als Nation. Und obwohl es selbst unter den „Obersten“ viele gab, die an Ihn glaubten, wagten sie es nicht, sich zu Ihm zu bekennen, aus Furcht, dass die Pharisäer sie aus den Synagogen hinauswerfen würden, mit all den schrecklichen Folgen, die das mit sich brachte. Für eine solche Kapitulation waren sie nicht bereit, deren Verstand zwar überzeugt, aber deren Herz nicht bekehrt war – die „den Ruhm der Menschen mehr liebten als den Ruhm Gottes“.
Das war Israel. Andererseits, was war die Zusammenfassung des Wirkens Christi? Sein Zeugnis erhob sich nun so laut, dass es von allen gehört werden konnte („Jesus schrie“). Dieses Zeugnis hatte von Anfang bis Ende von ihm selbst zum Vater hinaufgeführt. Sein Inhalt war die Realität und die Verwirklichung dessen, was das Alte Testament Israel und durch Israel der Welt allmählich offenbart hatte: die Vaterschaft Gottes. Der Glaube an ihn war in Wirklichkeit nicht der Glaube an ihn, sondern der Glaube an den, der ihn gesandt hat. Eine Stufe höher: Christus zu sehen, bedeutete, den zu sehen, der ihn gesandt hatte. b Um diese beiden zu verbinden: Christus war als Licht in die Welt gekommen, Gott hatte ihn als die Sonne der Gerechtigkeit gesandt, damit die Menschen durch den Glauben an ihn als den von Gott Gesandten sittliche Schau erlangen – nicht mehr „in der Finsternis bleiben“, sondern in dem hellen geistigen Licht, das aufgegangen war. Was aber die anderen betrifft, so gab es solche, die seine Worte hörten und sich nicht daran hielten2 , und wiederum solche, die ihn verwarfen und seine Worte nicht annahmen. Weder in dem einen noch in dem anderen Fall gab es eine Kontroverse zwischen seinen Worten und den Menschen. Was die eine Klasse betrifft, so war er mit dem Wort des Heils in die Welt gekommen, nicht mit dem Schwert des Gerichts. Was seine offenen Feinde anbetrifft, so hat er den Streit so lange aufgeschoben, bis der Beweis für sein Wort in dem schrecklichen Gericht des Jüngsten Tages erscheint.
Noch einmal, und nachdrücklicher als je zuvor, war der letzte Aufruf des Vaters zu seiner Sendung. Von Anfang bis Ende war es nicht sein eigenes Werk: Was er sagen und was er reden sollte, hatte ihm der Vater „selbst“ befohlen. Nein, dieses Gebot und das, was Er darin sprach, war nicht bloße Lehre oder Gesetz: es war ewiges Leben. Und so ist es und wird es immer sein, dank der Liebe dessen, der gesandt hat, und der Gnade dessen, der gekommen ist: was Er redete, redete Er, wie der Vater es Ihm gesagt hatte.
Diese beiden Dinge sind also die abschließende Zusammenfassung der Geschichte des Christus in seinem öffentlichen Wirken durch den Apostel. Einerseits zeigt er uns, wie Israel, verstockt in der selbstgewählten Richtung seiner religiösen Entwicklung, nicht glauben konnte und trotz der klarsten Beweise nicht glaubte. Andererseits stellt er uns den Christus vor Augen, der sich absolut hingibt, um den Willen und das Werk des Vaters zu tun; der vom Vater bezeugt wird; der den Vater offenbart; der als das Licht der Welt kommt, um ihre moralische Finsternis zu vertreiben; Er spricht zu allen Menschen, bringt ihnen das Heil, nicht das Gericht, und überlässt die Rechtfertigung seines Wortes seiner Offenbarung am Jüngsten Tag; und schließlich als der Christus, dessen jede Botschaft von Gott befohlen ist und dessen jedes Gebot ewiges Leben ist – und der deshalb und so spricht, wie der Vater zu ihm gesagt hat.
Diese beiden Dinge: die Geschichte Israels und sein notwendiger Unglaube und der Christus als von Gott gesandter, von Gott bezeugter, von Gott geoffenbarter, Licht und Leben bringender, vom Vater geschenkter und befohlener Mensch – der Christus, der sich dieser Mission absolut hingibt und sie verkörpert – sind die Summe der Evangelien-Erzählungen. Sie erklären ihren Sinn, legen ihren Gegenstand und ihre Lehren dar.

(Mt 22,23-33; Mk 12,18-27; Lk 20,27-39; Mt 22,34-40; Mk 12,28-34; Mt 22,41-46; Mk 12,35-40; Lk 20,40-47; Mt 23).
DER letzte Tag im Tempel sollte nicht ohne andere „Versuchungen“ ablaufen als die der Priester, die seine Autorität in Frage stellten, oder die der Pharisäer, die ihn mit List in seiner Rede zu verwickeln suchten. In der Tat hatte Christus bei dieser Gelegenheit eine andere Position eingenommen; er hatte die höchste Autorität beansprucht und damit die Führer Israels herausgefordert. Aus diesem Grund und weil wir am Ende Angriffe von allen seinen Feinden erwarten, sind wir auf die Auseinandersetzungen dieses Tages vorbereitet.
Wir erinnern uns, dass Christus in der ganzen vorangegangenen Geschichte nur ein einziges Mal in einen öffentlichen Konflikt mit den Sadduzäern geraten war, als sie bezeichnenderweise von ihm „ein Zeichen vom Himmel“ verlangten.Ihr Rationalismus würde sie dazu verleiten, die ganze Bewegung als nicht ernst zu nehmen, als Ergebnis eines unwissenden Fanatismus zu betrachten. Als Jesus jedoch eine solche Position im Tempel einnahm und das Volk offensichtlich so sehr beeinflusste, sollten sie, wenn auch nur, um ihre Position zu wahren, nicht länger tatenlos zusehen. Möglicherweise haben auch die Enttäuschung und die Ohnmacht der Pharisäer ihren Einfluss gehabt. Auf jeden Fall entsteht der Eindruck, dass diejenigen von ihnen, die jetzt zu Christus gingen, Abgeordnete waren und dass die Frage, die sie stellten, gut geplant war.
Ihr Ziel war sicherlich nicht, ernsthaft zu argumentieren, sondern die viel gefährlichere Waffe des Spottes einzusetzen. Die Bevölkerung hätte die Verfolgung vielleicht übel genommen; zu offenem Widerstand wären alle bereit gewesen; aber mit eisiger Höflichkeit und philosophischer Gelassenheit zu kommen und durch eine gut gestellte Frage den berühmten galiläischen Lehrer zum Schweigen zu bringen und die Absurdität seiner Lehre aufzuzeigen, wäre ein höchst schädlicher Schlag für seine Sache gewesen. Bis zum heutigen Tag sind solche Appelle an den groben gesunden Menschenverstand das Haupthandelsgut jener groben Ungläubigkeit, die, indem sie sowohl die Forderungen des höheren Denkens als auch die Tatsachen der Geschichte ignoriert, so oft, leider! wirkungsvoll, an den ungeschulten Verstand der Menge appelliert, und – sollen wir es nicht sagen? Hätten die Sadduzäer Erfolg gehabt, so hätten sie gleichzeitig einen bedeutenden Triumph für ihre Lehren errungen und zusammen mit dem galiläischen Lehrer ihre eigenen pharisäischen Gegner besiegt. Das Thema des Angriffs sollte die Auferstehung1 sein – dasselbe, das immer noch das Lieblingsthema für die Appelle der gröberen Formen der Ungläubigkeit an den „gesunden Menschenverstand“ der Massen ist. Wenn man die unterschiedlichen Umstände berücksichtigt, könnte man fast meinen, wir hörten einem unserer modernen Redner des Materialismus zu. Und in jenen Tagen litt die Verteidigung des Auferstehungsglaubens unter einer doppelten Schwierigkeit. Er war noch eine Sache der Hoffnung, nicht des Glaubens: etwas, auf das man sich freuen, nicht zurückblicken konnte. Die vereinzelten Ereignisse, die im Alten Testament aufgezeichnet wurden, und die Wunder Christi – vorausgesetzt, dass sie anerkannt wurden – waren eher Beispiele für Wiederbelebung als für Auferstehung. Die große Tatsache der Geschichte, für die es kein besseres Zeugnis gibt – die Auferstehung Christi -, hatte noch nicht stattgefunden und war noch nicht einmal für alle klar vor Augen. Außerdem waren die Äußerungen des Alten Testaments zum Thema „Jenseits“, wie es dem Stand der Offenbarung und dem Verständnis der Adressaten entsprach, alles andere als klar. Im Licht des Neuen Testaments tritt es in den schärfsten Proportionen hervor, wenn auch als eine weit entfernte alpine Höhe; aber damals war jenes Licht noch nicht über ihm aufgegangen.
Außerdem ließen die Sadduzäer keine Berufung auf die hochpoetische Sprache der Propheten zu, denen sie jedenfalls weniger Autorität beimaßen, sondern verlangten Beweise aus jenem klaren und präzisen Buchstaben des Gesetzes, den die Pharisäer bis ins kleinste Detail für ihre lehrhaften Schlussfolgerungen ausnutzten und aus dem sie sie allein ableiteten. Auch hier war es die Nemesis des Pharisäertums, dass die Postulate ihres Systems es angreifbar machten. Vergeblich beriefen sich die Pharisäer auf Jesaja, Hesekiel, Daniel oder die Psalmen. Auf ein Argument wie die Worte „dieses Volk wird auferstehen „a würden die Sadduzäer mit Recht erwidern, dass der Kontext die Anwendung auf die Auferstehung verbietet; auf das Zitat aus Jesaja 26,19 würden sie antworten, dass diese Verheißung geistlich zu verstehen ist, wie die Vision der dürren Gebeine in Hesekiel; während ein Verweis wie dieser, „die Lippen der Entschlafenen zum Reden zu bringen „kaum einer ernsthaften Widerlegung bedarf. c Ähnlich wäre das Argument, das sich aus der Verwendung eines besonderen Wortes wie „Rückkehr“ in 1. Mose 3,19 ergibt,oder das Argument, das sich aus der zweifachen Erwähnung des Wortes „ausgerottet“ im Original von Num 15,31 ergibt, das eine Bestrafung in der gegenwärtigen und in der zukünftigen Dispensation impliziert. Kaum überzeugender wäre die Berufung auf Stellen wie Dtn 32,39: „Ich töte und mache lebendig „oder die Feststellung, dass eine Verheißung immer dann, wenn sie in der Form vorkommt, die im Hebräischen das Futur darstellt,2 einen Hinweis auf die Auferstehung bedeutet. Vielleicht befriedigender, wenn auch nicht überzeugend für einen Sadduzäer, dessen besonderes Anliegen es war, auf Beweisen aus dem Gesetz zu bestehen,wäre eine Berufung auf solche Stellen wie Dan. 12:2, 13,oder auf die Wiederherstellung des Lebens durch bestimmte Propheten, mit dem zusätzlichen Kanon, dass Gott durch seine Propheten teilweise vorweggenommen hat, was er in der Zukunft vollständig wiederherstellen wird.
Wenn es der pharisäischen Argumentation nicht gelungen wäre, die Sadduzäer mit biblischen Argumenten zu überzeugen, wäre es schwer vorstellbar, dass selbst nach dem damaligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ein fragender Mensch wirklich geglaubt hätte, dass es einen kleinen Knochen in der Wirbelsäule gäbe, der unzerstörbar sei und aus dem der neue Mensch hervorgehen würde; oder dass es auch jetzt noch eine Art von Mäusen oder Schnecken gäbe, die sich allmählich und sichtbar aus der Erde entwickelten. i In der Tat sind hier, wie bei den meisten Themen, viele kluge Sprüche der Pharisäer in ihren Kontroversen aufgezeichnet, mit denen ein jüdischer Gegner hätte zum Schweigen gebracht werden können. Aber gerade hier muss man gespürt haben, dass eine Antwort nicht immer eine Antwort ist, und dass das Zum-Schweigen-Bringen eines Gegners nicht gleichbedeutend mit dem Beweis der eigenen Behauptung ist. Und die Zusätze, mit denen die Pharisäer die Lehre von der Auferstehung belastet hatten, würden sie nicht nur mit neuen Schwierigkeiten umgeben, sondern die einfache Tatsache ihrer großen Erhabenheit berauben. So war es ein Diskussionspunkt, ob ein Mensch in seinen Kleidern auferstehen würde, was ein Rabbi mit einem Verweis auf das Weizenkorn zu begründen versuchte, das „nackt“ begraben wurde, aber bekleidet auferstand. In der Tat vertraten einige Rabbiner die Ansicht, dass ein Mensch in genau denselben Kleidern auferstehen würde, in denen er begraben worden war, während andere dies verneinten. b Andererseits wurde sehr schön argumentiert, dass Körper und Seele schließlich gemeinsam gerichtet werden müssten, damit bei der Auseinandersetzung darüber, wem von beiden die Sünden des Menschen zuzuschreiben seien, beiden Gerechtigkeit widerfahre – oder vielmehr beiden in ihrer Kombination, da sie in ihrer Kombination gesündigt hätten.1 Wiederum wurde aus der Erscheinung Samuelsc gefolgert, dass der Auferstandene genau so aussehen würde wie im Leben – sogar dieselben körperlichen Mängel wie Lahmheit, Blindheit oder Taubheit haben würde. Es wurde argumentiert, dass sie erst danach geheilt werden sollten, damit die Feinde nicht sagen konnten, dass Gott sie nicht zu Lebzeiten, sondern erst nach ihrem Tod geheilt hatte und dass sie vielleicht nicht dieselben Personen waren. In mancher Hinsicht noch seltsamer war die Behauptung, dass es, um sicherzustellen, dass alle Frommen Israels auf dem heiligen Boden Palästinas auferstehen sollten,e unterirdische Höhlen gab, in denen der Körper rollte, bis er das Heilige Land erreichte, um dort zu neuem Leben zu erwachen.
Aber umso mehr, dass sie von Heiden, Sadduzäern und Häretikern so heftig angefochten wurde, wie aus vielen Berichten im Talmud hervorgeht, und dass sie so mit realistischen Legenden belastet war, sollten wir die Hartnäckigkeit bewundern, mit der die Pharisäer an dieser Lehre festhielten. Die Hoffnung auf die Auferstehungswelt erscheint in fast jeder religiösen Äußerung Israels. Sie ist die Frühlingsknospe am Baum, der durch den langen Winter der Enttäuschung und Verfolgung abgestreift wurde. Diese Hoffnung gießt ihren Morgengesang in das Gebet, das jeder Jude beim Aufwachen sprechen muss; sie legt ihren warmen Atem über die ältesten der täglichen Gebete, die aus der Zeit vor unserem Herrn stammen; 2 in der Formel „von Ewigkeit zu Ewigkeit“, „Welt ohne Ende“, bildet sie sozusagen die Nachhut jedes Gebets und verteidigt es gegen sadduzäische Angriffe; es ist eines der wenigen Dogmen, deren Leugnung nach der Mischna den Verlust des ewigen Lebens nach sich zieht, wobei der Talmud – fast mit den Worten Christi – erklärt, dass es sich bei der Vergeltung Gottes nur um ein „Maß nach Maß“ handelt; ja, es ist sogar in seiner Übertreibung so ehrwürdig, dass nur unsere Unwissenheit es nicht in jedem Abschnitt der Bibel wahrnimmt und in jedem Gebot des Gesetzes hört.
Aber in der Sicht Christi würde die Auferstehung notwendigerweise einen anderen Platz einnehmen als all dies. Sie war das innerste Heiligtum im Heiligtum Seiner Sendung, auf das Er unablässig zusteuerte; sie war zugleich der lebendige Eckstein jener Kirche, die Er erbaut hatte, und ihre Spitze, die wie mit erhobenem Finger alle Menschen stets zum Himmel wies. Aber über solche Gedanken, die mit seiner Auferstehung zusammenhängen, hätte Jesus nicht zu den Sadduzäern sprechen können; sie wären damals selbst für seine eigenen Jünger unverständlich gewesen. Er begegnete dem Einwand der Sadduzäer majestätisch, ernst und feierlich, mit höchst erhabenen und geistlichen Worten, die sie jedoch verstehen konnten und die sie, wenn sie sie aufgenommen hätten, weit über den Standpunkt der Pharisäer hinausgeführt hätten. Dies ist eine Lehre für uns in unseren Kontroversen.
Die Geschichte, mit der die Sadduzäer ihren Spott ausdrückten, war auch ein versteckter Angriff auf ihre pharisäischen Gegner. Die alte Vorschrift, die kinderlose Witwe eines Bruders zu heiraten,war mehr und mehr in Misskredit geraten, da ihr ursprünglicher Beweggrund an Einfluss verlor. Eine ganze Reihe von Einschränkungen schränkte den Kreis derer ein, denen diese Verpflichtung nun oblag. Dann legte die Mischna fest, dass in alten Zeiten, als die Anordnung einer solchen Ehe im Geiste des Gesetzes befolgt wurde, ihre Verpflichtung Vorrang vor der Erlaubnis der Dispensation hatte, dass sich dieses Verhältnis aber später umkehrte. b Spätere Autoritäten gingen noch weiter. Einige erklärten jede derartige Verbindung, sei es aus Schönheit, Reichtum oder anderen als religiösen Motiven, als inzestuös,während ein Rabbiner sie absolut verbot, obwohl die Meinungen zu diesem Thema weiterhin geteilt waren. Aber was uns hier am meisten interessiert, ist, dass die im Talmud so genannten „Samariter“, aber, wie wir meinen, die Sadduzäer, die Meinung vertraten, dass das Gebot, die Witwe eines Bruders zu heiraten, nur für eine verlobte Frau gelte, nicht aber für eine, die tatsächlich verheiratet war. d Dies zeigt ihre kontroverse Frage, die sie an Jesus richteten.
Ein Fall, wie sie ihn erzählten, von einer Frau, die nacheinander mit sieben Brüdern verheiratet war, könnte sich nach dem jüdischen Gesetz tatsächlich ereignet haben. Ihre spöttische Frage lautete nun, wessen Frau sie bei der Auferstehung sein würde. Dabei gingen sie natürlich von den grob materialistischen Ansichten der Pharisäer aus. Damit nahm der sadduzäische Spott in gewisser Weise bestimmte Einwände des modernen Materialismus vorweg. Er ging von der Annahme aus, dass die Beziehungen der Zeit für die Ewigkeit gelten und dass die Bedingungen der sichtbaren Dinge auch für die unsichtbaren gelten. Vielleicht ist es aber auch anders, und die Zukunft kann offenbaren, was wir in der Gegenwart nicht sehen. Die Argumentation als solche mag einwandfrei sein; aber vielleicht muss in der Zukunft etwas in das Haupt- oder Nebenfach eingefügt werden, wodurch die Schlussfolgerung eine ganz andere wird! Allen solchen Einwänden würden wir mit dem zweifachen Appell Christi an das Wort1 und an die Macht Gottes begegnen – wie Gott sich offenbart hat und wie er sich offenbaren wird – das eine ergibt sich aus dem anderen.
In seiner Argumentation gegen die Sadduzäer berief sich Christus zunächst auf die Macht Gottes. Was Gott wirken würde, war etwas ganz anderes, als sie sich vorstellten: nicht eine bloße Wiedererweckung, sondern eine Verwandlung. Die kommende Welt sollte nicht eine Reproduktion dessen sein, was vergangen war – warum hätte sie sonst vergehen sollen -, sondern eine Erneuerung und Erneuerung; und der Leib, mit dem wir bekleidet werden sollten, würde dem gleichen, den die Engel tragen. Was also in unseren gegenwärtigen Beziehungen von der Erde und von unserem gegenwärtigen Körper der Sünde und der Verderbnis ist, wird vergehen; was darin ewig ist, wird fortbestehen. Aber die Macht Gottes wird alles verwandeln – den gegenwärtigen irdischen in den zukünftigen himmlischen Leib, den Leib der Erniedrigung in einen der Erhöhung. Dies wird die Vervollkommnung aller Dinge durch jene allmächtige Kraft sein, durch die er sich am Tag seiner Macht alles unterwerfen wird, wenn der Tod vom Sieg verschlungen sein wird. Und hierin besteht auch die Würde des Menschen kraft der eingeleiteten und gleichsam beim Sündenfall begonnenen Erlösung, dass der Mensch zu einer solchen Erneuerung und Vollendung fähig ist – und hierin liegt auch „die Kraft Gottes“, dass er uns mit Christus lebendig gemacht hat, so dass die Kirche schon hier in der Taufe in Christus den Keim der Auferstehung empfängt, der nachher durch den Glauben genährt und gespeist werden soll, indem der Gläubige am Sakrament der Gemeinschaft mit seinem Leib und Blut teilnimmt. 2 Auch sollen hier nicht Fragen auftauchen wie dunkle Wolken, etwa nach der Dauerhaftigkeit jener Beziehungen, die uns auf Erden nicht nur so kostbar, sondern auch so heilig sind. Gewiss, sie werden bestehen bleiben, wie alles, was von Gott und gut ist; nur das Irdische in ihnen wird vergehen oder vielmehr mit dem Leib verwandelt werden. Nein, und wir werden uns auch gegenseitig erkennen, nicht nur an der Gemeinschaft der Seele; sondern wie jetzt schon der Geist den Zügen seinen Stempel aufdrückt, so wird dann, wenn alles ganz wahr ist, die Seele gleichsam mit ihrem Körper hervortreten und sich voll auf die äußere Erscheinung auswirken, und wir werden dann zum ersten Mal diejenigen voll erkennen, die wir jetzt voll erkennen werden – mit allem Irdischen, das in ihnen zurückgeblieben war, und mit allem Göttlichen und Guten, das voll entwickelt und zur Vollkommenheit der Schönheit gereift ist.
Aber es genügte nicht, den fadenscheinigen Vorwurf beiseite zu schieben, der nur unter der Annahme einer grob materialistischen Auffassung von der Auferstehung Bedeutung hatte. Unser Herr wollte nicht nur antworten, er wollte den Sadduzäern antworten; und nie ist ein großartigerer oder edlerer Beweis für die Auferstehung angeboten worden als der, den er gab. Natürlich blieb Er, als Er zu den Sadduzäern sprach, auf dem Boden des Pentateuch; und doch berief Er sich nicht nur auf das Gesetz, sondern auf die ganze Bibel, ja, auf das, was der Offenbarung selbst zugrunde lag: die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nicht nur diese oder jene isolierte Stelle beweist die Auferstehung; derjenige, der sich nicht nur historisch, sondern im wahrsten Sinne des Wortes der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt, kann sie nicht tot lassen. Die Offenbarung bedeutet nicht nur eine Tatsache der Vergangenheit – wie die Vorstellung, die der Traditionalismus damit verbindet -, einen toten Buchstaben, sondern eine lebendige Beziehung. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn alle leben für ihn.
Die Sadduzäer verstummten, die Menge staunte, und selbst einigen Schriftgelehrten wurde unwillkürlich ein Geständnis abgerungen: ‚Lehrer, Du hast schön gesagt.‘ Ein Punkt verlangt jedoch noch unsere Aufmerksamkeit. Es ist merkwürdig, dass der Rabbinismus in Bezug auf diese beiden Argumente Christi sehr ähnliche Aussagen macht. So wird als einer der häufigen Aussprüche eines späteren Rabbiners aufgezeichnet, dass es in der kommenden Welt weder Essen noch Trinken, weder Fruchtbarkeit noch Wachstum, weder Geschäft noch Neid, weder Hass noch Streit geben wird, sondern dass die Gerechten mit Kronen auf ihren Häuptern sitzen und sich an der Herrlichkeit der Schechinah erfreuen werden. Dies liest sich wie eine rabbinische Adaption des Spruches von Christus. Was den anderen Punkt betrifft, so berichtet der Talmud von einer Diskussion über die Auferstehung zwischen „Sadduzäern“ oder vielleicht jüdischen Häretikern (jüdisch-christlichen Häretikern), bei der Rabbi Gamaliel 2. seine Gegner schließlich mit einem Appell an die Verheißung zum Schweigen bringt, „dass ihr lange in dem Land bleiben könnt, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben“ – „ihnen“, betont der Rabbi, „nicht euch“.Obwohl dies fast völlig an der spirituellen Bedeutung vorbeigeht, die in der Argumentation Christi zum Ausdruck kommt, ist es unmöglich, seinen christlichen Ursprung zu verkennen. Gamaliel 2. lebte nach Christus, aber zu einer Zeit, als es einen regen Verkehr zwischen Juden und Judenchristen gab; und schließlich haben wir reichlich Beweise dafür, dass der Rabbi die Aussprüche Christi kannte und an der Kontroverse mit der Kirche teilnahm. 2 Andererseits leugneten die Christen seiner Zeit – es sei denn, es handelte sich um häretische Sekten – weder die Auferstehung, noch hätten sie so mit dem jüdischen Patriarchen gestritten; die Sadduzäer hingegen existierten nicht mehr als eine Partei, die sich aktiv an der Kontroverse beteiligte. Aber wir können leicht erkennen, dass der Verkehr zwischen Juden und solchen häretischen Judenchristen wahrscheinlicher ist, die behaupten, die Auferstehung sei vergangen und nur geistig. Dieser Punkt ist höchst interessant. Er eröffnet weitere Fragen wie diese: Was haben die Judenchristen im ständigen Verkehr mit den Juden gelernt? Und gibt es nicht vieles im Talmud, das nur eine Aneignung und Anpassung dessen ist, was aus dem Neuen Testament abgeleitet worden war?
Die Antwort unseres Herrn war nicht ohne weitere Folgen. Wie wir uns vorstellen können, befanden sich unter den Zuhörern des kurzen, aber entscheidenden Wortwechsels zwischen Jesus und den Sadduzäern einige „Schriftgelehrte“ – Sopherim oder, wie sie auch genannt werden, „Juristen“, „Gesetzeslehrer“, Experten, Ausleger, Praktiker des jüdischen Gesetzes. Einer von ihnen, vielleicht derjenige, der ausgerufen hat: Schön gesagt, Lehrer!“, eilte zu der Gruppe von Pharisäern, die an jenem Tag im Tempel versammelt waren und mit rastloser, stets vereitelter Bosheit jede Bewegung des Erlösers beobachteten, ohne dass man sich ein Bild von ihnen machen müsste. Als „der Schriftgelehrte“ zu ihnen kam, erzählte er, wie Jesus die Sadduzäer buchstäblich „geknebelt“ und „mundtot gemacht „hatte – so wie wir nach dem Willen Gottes „die Unwissenheit der Unverständigen durch gutes Tun knebeln“ sollen. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Bericht gemischte Gefühle hervorrufen würde, wobei das vorherrschende Gefühl wäre, dass Jesus zwar die Sadduzäer in Verlegenheit gebracht haben könnte, aber nicht in der Lage wäre, mit anderen Fragen fertig zu werden, wenn sie nur von pharisäischer Gelehrsamkeit richtig gestellt würden. Und so können wir verstehen, wie einer von ihnen, vielleicht derselbe Schriftgelehrte, sich freiwillig meldete, um das Amt zu übernehmen; und wie seine Frage, wie Matthäus berichtet, in gewissem Sinne wirklich dazu bestimmt war, Jesus zu „versuchen“.
Wir verwerfen hier die bekannten rabbinischen Unterscheidungen von „schweren“ und „leichten“ Geboten, denn der Rabbinismus erklärte die „leichten“ für ebenso verbindlich wie „die schweren, die der Schriftgelehrten für „schwerer“ (oder verbindlicher) als die der Schrift,c und dass ein Gebot nicht als lohnender und daher sorgfältiger zu beachten sei als ein anderes. Dass der Fragesteller nicht an solche Gedanken dachte, sondern an das große allgemeine Problem – wie auch immer er es beantwortet haben mag -, geht schon aus der Form seiner Anfrage hervor: „Welches [qualis] ist das große – „erste“ – Gebot im Gesetz? So herausgefordert, konnte der Herr nicht zögern, zu antworten. Nicht um ihn zum Schweigen zu bringen, sondern um die absolute Wahrheit auszusprechen, zitierte er die wohlbekannten Worte, die jeder Jude in seiner Andacht wiederholen musste und die ihm, ob er lebte oder starb, als innerster Ausdruck seines Glaubens immer auf den Lippen liegen sollten: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einziger Herr“. Und dann wiederholte er das Gebot der Liebe zu Gott, das die Folge dieses Bekenntnisses ist. Aber hier stehen zu bleiben, hieße, eine theoretische Abstraktion ohne konkrete Realität zu vertreten, eine bloße pharisäische Anbetung des Buchstabens. Wie Gott die Liebe ist – seine Natur offenbart sich so -, so ist die Liebe zu Gott auch die Liebe1 zum Menschen. Und so ist dieses zweite „wie“ das „erste und große Gebot“. Es war eine vollständige Antwort an den Schriftgelehrten, als er sagte: „Es gibt kein anderes Gebot, das größer ist als dieses.
Aber es war mehr als eine Antwort, ja sogar die tiefste Belehrung, als er, wie der heilige Matthäus berichtet, hinzufügte: „An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten „Es ist für unseren Zweck wenig von Belang, wie die Juden damals diese beiden Gebote verstanden und interpretierten. 2 Sie wüssten, was es bedeutet, dass das Gesetz und die Propheten an ihnen „hängen“, denn das ist ein jüdischer Ausdruck (תלוין). Er lehrte sie nicht, dass ein Gebot größer oder kleiner, schwerer oder leichter sei als ein anderes – dass man es beiseite legen oder vernachlässigen könne, sondern dass alle von diesen beiden als ihrer Wurzel und ihrem Prinzip abstammten und in lebendiger Verbindung mit ihnen stünden. Es war eine ähnliche Lehre wie die von der Auferstehung: dass, wie bei den Verheißungen, so auch bei den Geboten, die ganze Offenbarung ein zusammenhängendes Ganzes sei; nicht unzusammenhängende Verordnungen, deren Buchstaben man abwägen müsse, sondern ein Leben, das aus der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen entspringt. Die Antwort war so edel, dass der Schriftgelehrte, der zuvor von der Antwort Christi an die Sadduzäer positiv beeindruckt gewesen war, für einen Moment in helle Begeisterung geriet. Zumindest für einen Augenblick verlor der Traditionalismus seine Macht, und als Christus darauf hinwies, sah er die überragende moralische Schönheit des Gesetzes. Er war nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Ob er es jemals betreten hat, steht auf der noch ungelesenen Seite seiner Geschichte.
Der Schriftgelehrte war ursprünglich mit gemischten Motiven gekommen, um seine Frage zu stellen; teilweise war er ihm aufgrund seiner Antwort an die Sadduzäer zugeneigt, aber er hatte auch die Absicht, ihn der rabbinischen Prüfung zu unterziehen. Die Wirkung, die nun auf ihn eintrat, und das Schweigen, das von diesem Augenblick an über alle seine Fragesteller hereinbrach, veranlassten Christus, den Eindruck, den er gemacht hatte, weiter zu verfolgen. Ohne jemanden besonders anzusprechen, legte er ihnen allen das vielleicht bekannteste Thema ihrer Theologie vor, nämlich die Abstammung des Messias. Wessen Sohn war er? Und als sie antworteten: „Der Sohn Davids „, verwies er sie auf die einleitenden Worte von Psalm 110, in dem David den Messias „Herr“ nennt. Das Argument ging natürlich von der doppelten Annahme aus, dass der Psalm davidisch und messianisch sei. Keine dieser beiden Aussagen wäre von der alten Synagoge in Frage gestellt worden. Aber wir könnten uns nicht mit der Erklärung zufrieden geben, dass dies für den Zweck der Argumentation Christi genügte, wenn die Grundlage, auf der sie beruhte, ernsthaft in Frage gestellt werden könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Psalm 110 Vers für Vers und konsequent auf einen der Makkabäer anzuwenden, hieße, eine kritische Aufgabe zu übernehmen, die nur durch eine Reihe unnatürlicher Erklärungen der Sprache möglich wäre. Seltsam ist auch, dass eine solche Auslegung eines zur Zeit Christi vergleichsweise jungen Werkes sowohl den Sadduzäern als auch den Pharisäern gänzlich unbekannt gewesen sein soll. Wir für unseren Teil begnügen uns damit, die messianische Auslegung auf die offensichtliche und natürliche Bedeutung der Worte im Zusammenhang mit der allgemeinen Lehre des Alten Testaments über den Messias, auf die unzweifelhafte Auslegung der alten jüdischen , auf die Autorität Christi und auf das Zeugnis der Geschichte zu stützen.
Im Vergleich dazu ist die andere Frage nach der Urheberschaft des Psalms von untergeordneter Bedeutung. Der Charakter der unendlichen, ja göttlichen Überlegenheit gegenüber jedem irdischen Herrscher und natürlich auch gegenüber David, den der Psalm in Bezug auf den Messias zum Ausdruck bringt, würde das Argument Christi hinreichend unterstützen. Aber was spielt es für eine Rolle, ob der Psalm von David komponiert oder nur in den Mund Davids (Davids oder davidisch) gelegt wurde, was unter der Annahme seiner messianischen Anwendung die einzige vernünftige Alternative ist?
Aber wir würden uns sehr irren, wenn wir dächten, dass der Herr, indem er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf diesen scheinbaren Widerspruch über den Christus lenkte, nur die Absicht hatte, die völlige Unfähigkeit der Pharisäer zu zeigen, die höheren Wahrheiten des Alten Testaments zu lehren. Das war in der Tat der Fall – und sie spürten es in Seiner Gegenwart. Aber weit darüber hinaus, wie in dem Beweis, den Er für die Auferstehung gab, und in der Ansicht, die Er über das große Gebot darlegte, wollte der Herr auf die große harmonische Einheit der Offenbarung hinweisen. Getrennt betrachtet, scheinen die beiden Aussagen, dass der Messias Davids Sohn ist und dass David ihn als Herrn anerkennt, unvereinbar. Aber in ihrer Kombination in der Person des Christus, wie harmonisch und wie lehrreich – für das alte Israel und für alle Menschen – in Bezug auf das Wesen des Reiches Christi und seines Werkes!
Von dieser Demonstration der Unfähigkeit der Lehrer Israels für das Amt, das sie beanspruchten, war es nur ein Schritt zu einer feierlichen Warnung zu diesem Thema. Und dies ist der angemessene Abschied Christi vom Tempel, von seinen Autoritäten und von Israel. Wie zu erwarten war, haben wir den Bericht darüber im Matthäus-Evangelium. Vieles davon war schon vorher gesagt worden, aber in einem ganz anderen Zusammenhang und daher mit anderer Bedeutung. Wir bemerken das, wenn wir diese Rede mit der Bergpredigt vergleichen, und noch mehr mit dem, was Christus beim Mahl im Haus des Pharisäers in Peräa gesagt hatte. c Aber hier präsentiert Matthäus eine regelmäßige Reihe von Anklagen gegen die Vertreter des Judentums, die in logischer Weise formuliert sind, einen Punkt nach dem anderen aufgreifen und mit dem Ausdruck des tiefsten Mitgefühls und der Sehnsucht nach jenem Jerusalem schließen, dessen Kinder er gerne unter seinen schützenden Flügeln vor dem Sturm des göttlichen Gerichts gesammelt hätte.
Zunächst möchte Christus sie verstehen lassen, dass er, indem er sie vor der Unfähigkeit der Lehrer Israels für das Amt, das sie innehatten, warnte, weder für sich selbst noch für seine Jünger den Platz der Autorität wünschte, den sie beanspruchten, noch das Volk zum Widerstand dagegen anstacheln wollte. Im Gegenteil, solange sie den Platz der Autorität innehatten, sollten sie – in der Sprache der Mischna – so angesehen werden, als ob sie von Moses selbst eingesetzt worden wären, als säßen sie auf Moses‘ Stuhl, und man sollte ihnen gehorchen, soweit es sich um rein äußerliche Verhaltensweisen handelte. Wir betrachten diese Anweisung nicht nur als vorübergehend, sondern als einen wichtigen Grundsatz. Aber wir erinnern uns auch daran, dass die Vorschriften, auf die sich Christus bezog, solche des jüdischen Kirchenrechts waren und nichts beinhalteten, was das Gewissen wirklich beeinflussen konnte – außer das der alten oder unserer modernen Pharisäer. Aber während sie also ihre äußeren Anweisungen befolgten, sollten sie auch den Geist, der ihre Befolgung kennzeichnete, meiden. In dieser Hinsicht wird ihnen ein zweifacher Vorwurf gemacht: mangelnder geistlicher Ernst und Liebe b und bloße Äußerlichkeit, Eitelkeit und Selbstsucht . Und hier unterbrach Christus seine Rede, um seine Jünger vor den ersten Anfängen dessen zu warnen, was zu solch furchtbaren Folgen geführt hatte, und um sie auf den besseren Weg hinzuweisen.
Dies ist der erste Teil des Auftrags Christi. Bevor wir zu den folgenden Abschnitten übergehen, können wir einige illustrative Erklärungen geben. Für die einleitende Anklage über das Binden (wahrhaftig in Knechtschaft: δεσμεύω) von schweren und schwer zu tragenden Lasten und das Auflegen auf die Schultern der Menschen kann kaum ein Beweis verlangt werden. Wie oft gezeigt wurde, stellte der Rabbinismus die Verordnungen der Tradition über die des Gesetzes,und zwar aus einer systembedingten Notwendigkeit heraus, da sie erklärtermaßen die maßgebliche Auslegung und Ergänzung des geschriebenen Gesetzes waren. f Und obwohl es eine allgemeine Regel war, dass kein Gebot schwerer sein sollte, als die Gemeinde ertragen konnte,so wurde doch (wie bereits erwähnt) zugegeben, dass die Worte des Gesetzes das enthielten, was „erleichterte“ und was „beschwerte“, während die Worte der Schriftgelehrten nur das enthielten, was „beschwerte“. h Wiederum war es ein anderer Grundsatz, dass dort, wo eine „Verschärfung“ oder Vergrößerung der Last einmal eingeführt worden war, diese auch weiterhin eingehalten werden musste. So wurden die Lasten unerträglich. Und die Schuld lag gleichermaßen bei den beiden großen rabbinischen Schulen. Denn obwohl die Schule des Hillel das Joch im Allgemeinen leichter und die des Schammai schwerer machen sollte, stimmten sie nicht nur in vielen Punkten überein,2 sondern die Schule des Hillel war nicht selten sogar strenger als die seines Rivalen. In Wahrheit scheinen ihre Meinungsverschiedenheiten nur allzu oft von einem Geist der Opposition getragen worden zu sein, so dass die ernste Angelegenheit der Religion in ihren Händen zu einer Angelegenheit rivalisierender Autorität und bloßer Zankerei wurde.
Der zweite Teil des Vorwurfs Christi ist nicht so leicht zu verstehen. Es gab in der Tat viele Heuchler unter ihnen, die, in der Sprache des Talmuds, sich selbst erleichtern und andere belasten konnten. Doch der Vorwurf, sie nicht mit dem Finger zu bewegen, konnte kaum auf die Pharisäer als Partei zutreffen – nicht einmal in dem Sinne, dass der rabbinische Einfallsreichtum meist ein Mittel fand, dem Unangenehmen auszuweichen. Aber, wie bereits erklärt,b würden wir das Wort „bewegen“ im Sinne von „in Bewegung setzen“ oder „wegbewegen“ verstehen, in dem Sinne, dass sie nicht „erleichterten“, wo sie es hätten tun können, oder mit Bezug auf ihr zugegebenes Prinzip, dass ihre Verordnungen immer schwerer, nie leichter machten – immer schwere Lasten auferlegten, aber nie, nicht einmal mit dem Finger, sie wegbewegten.
Mit diesem Vorwurf der Unwirklichkeit und Lieblosigkeit sind die Vorwürfe der Äußerlichkeit, der Eitelkeit und der Selbstsucht eng verbunden. Hier können wir nur eine Auswahl aus der Fülle der Beweise treffen, die dafür sprechen. Durch eine rein äußerliche Auslegung von Exodus 13:9, 16 und Dtn. 6:8; 11:18 wurde der Brauch des Tragens von Phylakterien oder, wie sie genannt wurden, Tephillin, „Gebetsfesseln“, eingeführt. handelte sich dabei um quadratische, mit Leder überzogene Kapseln, die auf kleinen Pergamentrollen die vier Abschnitte des Gesetzes enthielten: Exodus 13,1-10; 11-16; Dtn. 6,4-9; 11,13-21. Die Phylakterien wurden mit langen Lederriemen an der Stirn und um den linken Arm, nahe dem Herzen, befestigt. Ihnen wurde eine abergläubische Verehrung entgegengebracht, und in späteren Zeiten wurden sie sogar als Amulette verwendet. Dennoch bestätigt der Talmud selbst, dass die Praxis des ständigen Tragens von Phylakterien – oder vielleicht auch, dass man sie breiter machte und die Ränder der Gewänder vergrößerte – dazu gedacht war, „von den Menschen gesehen zu werden“. So wird uns von einem Mann berichtet, der dies tat, um seine unlauteren Praktiken bei der Aneignung des ihm anvertrauten Geldes zu verbergen. Nein, die Rabbiner mussten es mit so vielen Worten als Grundsatz festschreiben, dass die Phylakterien nicht zur Schau getragen werden sollten.
Es bedarf kaum eines ausführlichen Beweises für den Vorwurf der Eitelkeit und der Selbstsucht bei der Beanspruchung ausgeprägter äußerer Ehren, wie der obersten Plätze bei Festen und in der Synagoge, der respektvollen Begrüßung auf dem Markt, der ostentativen Wiederholung des Titels „Rabbi“ oder „Abba“, „Vater“ oder „Meister „1 oder der Auszeichnung, als „Größter“ anerkannt zu werden. Die Ernsthaftigkeit, mit der der Talmud manchmal vor solchen Motiven für das Studium oder für die Frömmigkeit warnt, belegt dies hinreichend. Aber die rabbinischen Schriften geben in der Tat genaue Anweisungen, welcher Platz den Rabbinern je nach ihrem Rang und ihren Schülern zuzuweisen ist,und wie im Kollegium die gelehrtesten, bei Festen aber die ältesten unter den Rabbinern die „oberen Plätze“ einnehmen sollen.c Die Pflicht zur ehrerbietigen Anrede mit dem Titel Rabbi war so gewichtig, dass ihre Vernachlässigung die schwerste Strafe nach sich zog. Zwei große Rabbiner werden beschrieben, die sich wörtlich darüber beklagten, dass sie den Anschein der Gelehrsamkeit verloren hätten, da sie auf dem Marktplatz nur mit „Möge euer Friede groß sein“ ohne den Zusatz „Meine Herren“ gegrüßt worden seien.
Ein paar weitere Illustrationen der Behauptungen, die der Rabbinismus bevorzugte, mögen die Worte Christi erhellen. Es liest sich wie eine erbärmliche Nachahmung des Neuen Testaments, wenn der heidnische Statthalter von Cäsarea dargestellt wird, wie er sich vor den Rabbinern erhebt, weil er „Gesichter wie von Engeln“ gesehen hat; oder wie eine Abwandlung der bekannten Geschichte über Konstantin den Großen, wenn der Statthalter von Antiochien beschrieben wird, wie er ein ähnliches Zeichen des Respekts gegenüber den Rabbinern damit rechtfertigt, dass er ihre Gesichter gesehen und durch sie in der Schlacht gesiegt habe. Von einem anderen Rabbiner sollen Lichtstrahlen sichtbar ausgegangen sein. g Einigen zufolge waren es Epikuräer, die keinen Anteil an der kommenden Welt hatten, die sich abfällig auf „diese Rabbiner“ bezogen. Einem gelehrten Mann die Mittel zu geben, um im Handel Geld zu verdienen, würde ihm einen hohen Platz im Himmel verschaffen. i Es wurde gesagt, dass nach Prov. 8:15 die Weisen wie Könige gegrüßt werden sollten; ja, in mancher Hinsicht waren sie sogar höher – denn zwischen einem Weisen und einem König wäre es Pflicht, dem ersteren bei der Erlösung aus der Gefangenschaft den Vorrang zu geben, da jeder Israelit geeignet war, ein König zu sein, aber der Verlust eines Rabbiners konnte nicht leicht wettgemacht werden. m Aber selbst das ist nicht alles. Der Fluch eines Rabbiners würde, selbst wenn er unverschuldet wäre, mit Sicherheit eintreten. Es wäre zu schmerzhaft, einige der Wunder zu wiederholen, die angeblich von ihnen oder für sie getan wurden, gelegentlich zum Schutz einer Lüge; oder ihre Streitigkeiten darüber aufzuzeichnen, wer unter ihnen der „Größte“ war, oder wie sie ihre jeweiligen Ansprüche begründeten. o Nein, ihre Selbstbehauptung reichte über dieses Leben hinaus, und ein Rabbi ging so weit, dass er anordnete, in weißen Kleidern begraben zu werden, um zu zeigen, dass er würdig war, vor seinem Schöpfer zu erscheinen. Aber der Höhepunkt der blasphemischen Selbstbehauptung wird vielleicht in der Geschichte erreicht, dass in einer Diskussion im Himmel zwischen Gott und der himmlischen Akademie über eine halachische Frage zur Reinheit ein gewisser Rabbiner – der als der Gelehrteste auf diesem Gebiet galt – gerufen wurde, um den Punkt zu entscheiden! Als seine Seele den Körper verließ, rief er: „Rein, rein“, was die Stimme aus dem Himmel auf den Zustand der Seele des Rabbiners bezog; und gleich darauf fiel ein Brief vom Himmel, um den Weisen mitzuteilen, zu welchem Zweck der Rabbiner in die himmlische Versammlung gerufen worden war, und danach ein weiterer, der eine einwöchige allgemeine Trauer um ihn anordnete, da er sonst exkommuniziert würde.
Solche kühnen Entweihungen müssen jede spirituelle Religion vernichtet und sie auf eine bloße intellektuelle Zurschaustellung reduziert haben, bei der der Rabbi immer der Chef war – hier und im Jenseits. So abstoßend solche Legenden auch sind, so helfen sie uns doch, das zu verstehen, was sonst in den Verurteilungen des Rabbinismus durch unseren Herrn hart erscheinen mag. In Anbetracht all dessen brauchen wir weder die rabbinischen Warnungen vor Stolz und Selbstsucht im Zusammenhang mit dem Studium noch ihre Ermahnungen zur Demut zu diskutieren. Denn die Frage ist hier, was der Rabbinismus bei seinen Lehrern als Stolz und was als Demut ansah. Es wird auch nicht behauptet, dass alle in dieser Angelegenheit gleich schuldig waren; und was sich herumgesprochen hat, mag die Ernsthafteren zu energischen Ermahnungen zu Demut und Selbstlosigkeit veranlasst haben. Aber kein Einfallsreichtum kann die Tatsachen, wie sie oben dargelegt wurden, erklären, und als solche Ansichten vorherrschten, wäre es fast übermenschlich gewesen, das zu vermeiden, was unser Herr als charakteristisch für den Pharisäismus anprangerte. Und in diesem Sinne, nicht mit pharisäischem, schmerzhaftem Wortsinn, sondern im Gegensatz zur rabbinischen Haltung, müssen wir die Warnung des Herrn an die Seinen verstehen, unter den Brüdern nicht den Anspruch zu erheben, „Rabbi“ oder „Abba“ oder „Führer“ zu sein.2 Das Gesetz des Königreichs, wie es wiederholt gelehrt wurde,war das Gegenteil. Was die Ziele betrifft, so sollten sie die Größe des Dienstes suchen; und was die Anerkennung betrifft, die von Gott kommen würde, so würde sie die Erhöhung der Erniedrigung sein.
Es war keine Unterbrechung der Rede,sondern eine Intensivierung, als Christus sich nun der endgültigen Anklage des Pharisäertums in seiner Sünde und Heuchelei zuwandte. c Entsprechend den acht Seligpreisungen in der Bergpredigt, mit denen sein öffentliches Wirken begann, schloss er es nun mit acht Wehklagen ab. Sie sind die Ausgießung seines heiligen Zorns, das letzte und vollste Zeugnis gegen diejenigen, deren Schuld Jerusalem in die gemeinsame Sünde und das gemeinsame Gericht hineinziehen würde. Schritt für Schritt, in logischer Abfolge und mit verstärktem Pathos wird jede Anklage vorgebracht und damit das Wehe des göttlichen Zorns angekündigt.
Das erste Wehe gegen den Pharisäismus galt der Tatsache, dass sie durch ihren Widerstand gegen Christus das Reich Gottes vor den Menschen verschlossen hatten. Alle wussten, wie exklusiv ihr Anspruch war, Frömmigkeit auf den Besitz von Wissen zu beschränken, und dass sie erklärten, es sei unmöglich, dass ein Unwissender fromm sein könne. Hätten sie die Menschen die Heilige Schrift gelehrt und ihnen den rechten Weg gezeigt, so wären sie ihrem Amt treu gewesen; aber wehe ihnen, wenn sie in ihrer Stellung als Führer selbst mit dem Rücken zur Tür des Reiches standen und anderen den Eintritt verwehrten.
Das zweite Wehe betraf ihre Habgier und Heuchelei. Sie verrichteten lange Gebete,aber wie oft deckten sie nur den schändlichsten Egoismus, bis hin zum „Verschlingen“ der Häuser von Witwen. Wir können kaum erwarten, dass der Talmud uns hier mit anschaulichen Beispielen versorgt, und doch wird zumindest ein solches aufgezeichnet; b und wir erinnern uns daran, wie oft breite Phylakterien betrügerische Gemüter verhüllten.
Das dritte Wehe betraf ihren Proselytismus, der nur dazu führte, dass ihre Bekehrten doppelt so viele Kinder der Hölle wurden wie sie selbst. Gegen diese Anklage, richtig verstanden, hat sich das Judentum vergeblich zu verteidigen versucht. Es stimmt in der Tat, dass das Judentum in seinem Stolz und seiner Ausschließlichkeit den Proselytismus zu verurteilen schien, strenge Regeln zur Prüfung der Aufrichtigkeit der Konvertiten aufstellte und ihn allgemein als „eine Plage des Aussatzes“ verachtete.bitteren Klagen der klassischen Schriftsteller,e die Aussagen von Josephus,die häufigen Anspielungen im Neuen Testament und sogar die Eingeständnisse der Rabbiner beweisen ihren Eifer, Proselyten zu machen – was in der Tat, wenn es nicht moralische Folgen gehabt hätte, weder die Verurteilung als „Wehe“ verdient noch nach sich gezogen hätte. So kommentiert der Midrasch die Worte:g „die Seelen, die sie in Haran bekommen hatten“, und bezieht sie auf die Bekehrten, die Abraham gemacht hatte, indem er hinzufügt, dass jeder Proselyt so zu betrachten sei, als sei eine Seele geschaffen worden. 3 Hinzu kommt der Stolz, mit dem das Judentum auf die 150.000 gibeonitischen Bekehrten zurückblickte, die es bei der Rache Davids für die Sünde Sauls gegeben haben soll; die Genugtuung, mit der es die Zeit des Messias als die Zeit der spontanen Bekehrung zur Synagoge erwartete; b und die nicht seltenen Fälle, in denen in jüdischen Schriften ein dem Proselytismus wohlwollender Geist zum Ausdruck kommt,wie auch ein Sprichwort wie dieses, dass Israel, wenn es dem Willen Gottes gehorsam ist, alle Gerechten der Völker als Bekehrte zum Judentum bringt, wie Jethro, Rahab, Ruth usw. c Aber könnte es nicht sein, dass der Herr nicht die Bekehrung zum Judentum im Allgemeinen gemeint hat, sondern den Proselytismus zur Sekte der Pharisäer, der zweifellos bis an die Grenzen von Meer und Land gesucht wurde?
Das vierte Wehe bezieht sich eher auf die moralische Blindheit dieser Führer als auf ihre Heuchelei. Aus der Natur der Sache heraus ist es nicht leicht, die genaue Anspielung Christi zu verstehen. Es ist wahr, dass der Talmud die seltsamste Unterscheidung macht zwischen einem Eid oder einer Beschwörung, wie „beim Himmel“ oder „bei der Erde“, die nicht bindend sein soll, und dem bei einem der Buchstaben, aus denen der göttliche Name zusammengesetzt ist, oder bei einem der Attribute des göttlichen Wesens, wenn der Eid bindend sein soll. Aber es scheint wahrscheinlicher, dass unser Herr sich auf Eide oder Beschwörungen in Verbindung mit Gelübden bezieht, wo die Kasuistik von der kompliziertesten Art war. Im Allgemeinen verurteilt der Herr hier die Willkür aller jüdischen Unterscheidungen, die, indem sie dem Buchstaben eines Eides oder Gelübdes einen übermäßigen Wert beimessen, in Wirklichkeit dazu neigen, seine Heiligkeit zu schmälern. Alle diese Unterscheidungen zeugten von Torheit und moralischer Verblendung.
Das fünfte Wehe bezog sich auf eine der bekanntesten und seltsamsten jüdischen Verordnungen, die das mosaische Gesetz des Zehnten in lästigster Kleinheit sogar auf die kleinsten Produkte des Bodens ausdehnte, die esculent waren und aufbewahrt werden konnten,wie zum Beispiel Anis. Von diesen mussten nach Meinung mancher nicht nur die Samen, sondern in bestimmten Fällen sogar die Blätter und Stängel den Zehnten entrichten. f Und das bei gleichzeitiger schmerzlicher Auslassung der gewichtigeren Dinge des Gesetzes: Gericht, Barmherzigkeit und Glaube. Wahrlich, das war „die Mücke ausreißen und das Kamel verschlucken“! Wir erinnern uns, dass diese Gewissenhaftigkeit beim Zehnten eines der Merkmale der Pharisäer war; aber wir konnten kaum auf einen solchen Fall vorbereitet sein, wie wenn der Talmud uns ernsthaft versichert, dass der Esel eines gewissen Rabbi so gut trainiert war, dass er das Korn verweigerte, von dem der Zehnte nicht genommen worden war! Und die Erfahrung, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart, hat nur zu deutlich gezeigt, dass ein religiöser Eifer, der sich auf Kleinigkeiten konzentriert, weder Raum noch Kraft für die gewichtigeren Angelegenheiten des Gesetzes übrig hat.
Der Übergang vom Zehnten zur Reinigung war ganz natürlich. Er war das zweite große Merkmal der pharisäischen Frömmigkeit. Wir haben gesehen, mit welcher Schärfe Fragen der äußerlichen Reinheit der Gefäße diskutiert wurden. Aber wehe der Heuchelei, die sich um das Äußere kümmerte und nicht darauf achtete, ob das, was den Becher und den Teller füllte, durch Erpressung erlangt oder zum Überfluss verwendet worden war. Und wehe der Blindheit, die nicht erkannte, dass die innere Reinheit die wahre Bedingung für das Äußere war!Wehe auch einer anderen Art von Heuchelei, von der in der Tat die vorhergehenden nur die Folge waren: derjenigen, die nach außen hin den Anschein von Gerechtigkeit erweckte, während Herz und Geist voller Ungerechtigkeit waren – so wie ihre alljährlich geschändeten Gräber nach außen hin so schön aussahen, aber innen voller Totengebeine und aller Unreinheit waren. Wehe schließlich der Heuchelei, die Gräber von Propheten und Gerechten baute und schmückte und sich dadurch vor der Mitschuld derer, die sie getötet hatten, zu schützen suchte. Es war nicht geistliche Reue, sondern nationaler Stolz, der sie dabei antrieb, derselbe Geist der Selbstgenügsamkeit, des Stolzes und der Unbußfertigkeit, der ihre Väter dazu gebracht hatte, die Morde zu begehen. Und waren sie nicht im Begriff, ihre Hände mit dem Blut dessen zu tränken, auf den alle Propheten hingewiesen hatten? Schnell waren sie im göttlichen Gericht dabei, das Maß ihrer Väter auszufüllen.
Und dicker und schwerer als je zuvor fiel der Hagelsturm seiner Anprangerungen, als er das sichere Verhängnis vorhersagte, das ihre nationale Unbußfertigkeit erwartete. Propheten, Weise und Schriftgelehrte würden von ihm zu ihnen gesandt werden; und nur Mord, Leiden und Verfolgungen würden sie erwarten – nicht aber die Aufnahme ihrer Botschaft und Warnungen. Und so würden sie Erben all des Blutes gemarterter Heiliger werden, von dem desjenigen, von dem die Schrift berichtet, dass er als erster ermordet wurde, bis hin zu jenem letzten Märtyrer des jüdischen Unglaubens, von dem die Überlieferung so viel spricht – Zecharias,2 der auf Befehl des Königs im Hof des Tempels gesteinigt wurde,dessen Blut, wie die Legende besagt, zwei Jahrhunderte und ein halbes Jahrtausend lang nicht versiegte, sondern immer noch auf dem Pflaster brodelte, als Nebusaradan in den Tempel eintrat und es endlich rächte.
Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten
Und doch wäre es nicht Jesus gewesen, wenn er nicht auch die leidenschaftliche Klage einer Liebe, die, selbst wenn sie verschmäht wird, mit bedauernder Sehnsucht nach dem Verlorenen verweilt, hinzugefügt hätte, während er ein bestimmtes Urteil über sie verkündete, die sich durch die Fortsetzung und Vollendung der Verbrechen ihrer Väter, durch denselben Unglauben, zu Erben all ihrer Schuld gemacht hatten. Sie alle kannten das gängige Bild von der Henne, die ihre junge Brut zum Schutz sammelt,d und sie wussten auch, was es an göttlichem Schutz, Segen und Ruhe bedeutete, wenn sie davon sprachen, unter den Flügeln der Schechina gesammelt zu sein. Gerne und oft hätte Jesus Israel, seinem Volk, diese Zuflucht, diese Ruhe, diesen Schutz und diesen Segen gegeben – aber sie wollten nicht. Wenn man sich die Tempelgebäude ansieht – dieses Haus -, wird es ihnen wüst hinterlassen! Und Er verließ seine Höfe mit den Worten, dass die Israeliten Ihn nicht wiedersehen sollten, bis sie, nachdem die Nacht ihres Unglaubens vorüber war, Seine Rückkehr mit einem besseren Hosanna begrüßen würden, als das, das Seinen königlichen Einzug drei Tage zuvor begrüßt hatte. Und dies war der „Abschied“ und der Abschied des Messias von Israel und seinem Tempel. Doch ein Abschied, der ein Wiederkommen versprach, und ein Abschied, der ein zukünftiges Willkommen eines gläubigen Volkes bei einem gnädigen, verzeihenden König bedeutete!
(Matthäus 19,30-20,16; Matthäus 21,28-32; Matthäus 21,33-46; Markus 12,1-12; Lukas 20,9-19; Matthäus 22,1-14).
Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten
AUCH wenn es nicht möglich ist, ihre genaue Abfolge zu bestimmen, so ist es doch zweckmäßig, die letzte Reihe der Gleichnisse hier zusammenzufassen. Die meisten, wenn nicht alle, wurden an jenem dritten Tag der Passionswoche gesprochen: die ersten vier zu einer allgemeineren Zuhörerschaft; die letzten drei (die in einem anderen Kapitel behandelt werden) zu den Jüngern, als er ihnen am Abend dieses dritten Tages auf dem Ölberg von den „letzten Dingen“ erzählte. Es sind die Gleichnisse vom Gericht, die in der einen oder anderen Form vom „Ende“ handeln.
Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. es vom „Ende“ handelt, gehört dieses Gleichnis offensichtlich zur letzten Reihe, obwohl es vielleicht schon vor der Passionswoche gesprochen wurde, vielleicht auf der Missionsreise in Peräa, im Zusammenhang mit der es von Matthäus aufgezeichnet wird. Auf jeden Fall steht es in einem inneren Zusammenhang mit dem, was bei dieser Gelegenheit geschah, und muss daher in diesem Zusammenhang untersucht werden.
Wir erinnern uns, dass Christus bei der Gelegenheit, als der reiche junge Fürst nicht in das Reich eintrat, dem er so nahe war, eine ernste Warnung vor der Gefahr des „Reichtums“ ausgesprochen hatte.Auf der niedrigen geistlichen Stufe, die die Apostel noch erreicht hatten, war es vielleicht nur natürlich, dass Petrus als Wortführer der anderen in einer Art geistlicher Begierde nach der versprochenen Belohnung griff, und dass er Christus in einem Ton der Selbstgerechtigkeit an die Opfer erinnerte, die sie gebracht hatten. Das war höchst schmerzlich und unpassend, aber es gehörte zu dem, was Er, der Herr, immer zu ertragen hatte, und ertrug es so geduldig und liebevoll, dass sie ihn und sein Werk nicht verstanden. Und dieser Mangel an echter Sympathie, dieser ständige Kampf mit der moralischen Dummheit sogar derer, die ihm am nächsten standen, muss Teil seiner großen Demütigung und seines Kummers gewesen sein, ein Element in der schrecklichen Einsamkeit seines Lebens, die ihn spüren ließ, dass „der Menschensohn im wahrsten Sinne des Wortes nicht weiß, wo er sein Haupt hinlegen soll“. Und doch erkennen wir auch die wunderbare göttliche Großzügigkeit, die Ihn selbst in Momenten solch schwerer Enttäuschung nicht umsonst nehmen ließ, was im freudigen Dienst dankbarer Liebe hätte angeboten werden sollen. Nur bestand hier eine große Gefahr für die Jünger: die Gefahr, in ähnliche Gefühle zu verfallen wie die Pharisäer gegenüber den begnadigten Zöllnern oder der ältere Sohn im Gleichnis gegenüber seinem jüngeren Bruder; die Gefahr, die richtigen Verhältnisse und damit den Charakter des Reiches Gottes und der Arbeit in ihm und für ihn zu missverstehen. Hierauf bezieht sich das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.
Der Grundsatz, den Christus aufstellt, lautet, dass zwar nichts, was für ihn getan wird, um seinen Lohn gebracht wird, dass aber aus dem einen oder anderen Grund keine Voraussage gemacht werden kann, keine Rückschlüsse auf Selbstgerechtigkeit gezogen werden können. Daraus folgt keineswegs, dass die meiste geleistete Arbeit – zumindest nach unserem Ermessen – einen größeren Lohn nach sich ziehen wird. Im Gegenteil, „viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein“. Nicht alle, auch nicht immer und unbedingt, aber „viele“. Und in solchen Fällen ist kein Unrecht geschehen; es besteht kein Anspruch, auch nicht im Hinblick auf die Verheißungen der gebührenden Anerkennung der Arbeit. Geistlicher Stolz und Selbstbehauptung können nur das Ergebnis entweder eines Missverständnisses der Beziehung Gottes zu uns oder eines falschen Geisteszustandes gegenüber anderen sein, d.h. sie zeugen von geistiger oder moralischer Untauglichkeit.
Das Gleichnis von den Arbeitern ist eine Illustration dafür. Es lehrt nichts weiter als dies. Aber es veranschaulicht zwar, wie es dazu kommen kann, dass einige, die die Ersten waren, die Letzten sind, und wie völlig irrig oder falsch der Gedanke ist, dass sie notwendigerweise mehr erhalten müssen als andere, die scheinbar mehr getan haben – kurz gesagt, die Arbeit für Christus ist keine abwägbare Größe, so viel für so viel, und wir sind auch nicht die Richter darüber, wann und warum ein Arbeiter gekommen ist -, aber es vermittelt auch viel Neues und in vielerlei Hinsicht sehr Tröstliches.
Zunächst fällt das Verhalten des Hausherrn auf, der sofort am frühen Morgen (ἅμα πρωΐ) ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Die Tatsache, dass er nicht seinen Verwalter schickte, sondern selbst ging, und zwar in der Morgendämmerung, zeigt sowohl, dass es viel Arbeit gab, als auch, dass der Hausherr darauf bedacht war, sie zu erledigen. Dieser Hausherr ist Gott, und der Weinberg ist sein Reich; die Arbeiter, die er am frühen Morgen auf dem Marktplatz des geschäftigen Lebens sucht, sind seine Diener. Er einigte sich mit ihnen auf einen Denar pro Tag, den üblichen Lohn für einen Tag Arbeit,und schickte sie in den Weinberg; mit anderen Worten: Er sagte ihnen, dass er den Lohn zahlen würde, der den Arbeitern versprochen war. So vergingen die ersten Stunden des Morgens. Um die dritte Stunde (der jüdische Arbeitstag wurde vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang gerechnet), das heißt wahrscheinlich, als er sich dem Ende zuneigte, ging er wieder hinaus, und als er „andere“ müßig auf dem Marktplatz stehen sah, sagte er zu ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg“. In diesem Weinberg gab es mehr als genug zu tun; genug und mehr, um sie zu beschäftigen. Und als er kam, standen sie auf dem Marktplatz und warteten darauf, an die Arbeit zu gehen, aber sie waren „müßig“ – noch nicht beschäftigt. Es mag nicht gerade ihre Schuld gewesen sein, dass sie nicht früher gegangen waren; sie waren „andere“ als die auf dem Marktplatz, als der Meister zuerst gekommen war, und sie waren damals nicht dort gewesen. Nur als er sie jetzt schickte, gab er kein definitives Versprechen. Sie spürten, dass sie in ihrer besonderen Situation keinen Anspruch darauf hatten; er sagte ihnen, dass er ihnen geben würde, was auch immer richtig sei, und sie vertrauten stillschweigend auf sein Wort, auf seine Gerechtigkeit und Güte. Und so geschah es noch einmal, sowohl in der sechsten als auch in der neunten Stunde des Tages. Wir wiederholen, dass es in keinem dieser Fälle die Schuld der Arbeiter war – in dem Sinne, dass es an ihrem Unwillen oder ihrer Weigerung lag -, dass sie nicht vorher in den Weinberg gegangen waren. Aus irgendeinem Grund – vielleicht durch ihr Verschulden, vielleicht auch nicht – waren sie nicht früher auf dem Marktplatz gewesen. Aber sobald sie dort waren und gerufen wurden, gingen sie, obwohl der Zeitverlust, wie auch immer er verursacht wurde, natürlich den Verlust von Arbeit bedeutete. Weder machte der Meister in irgendeinem Fall ein anderes Versprechen, noch baten sie um ein anderes, als das, das in seinem Wort und seinem Charakter enthalten war.
Diese vier Dinge treten also im Gleichnis deutlich hervor: die Fülle der Arbeit im Weinberg; die Sorge des Hausherrn, alle verfügbaren Arbeiter zu bekommen; der Umstand, dass die Arbeiter nicht aus Unwillen oder Weigerung, sondern weil sie nicht da waren und zur Verfügung standen, zu später Stunde kamen; und dass sie, als sie so gekommen waren, bereit waren, in den Weinberg zu gehen, ohne Verheißung einer bestimmten Belohnung, einfach im Vertrauen auf die Wahrheit und Güte dessen, dem sie zu dienen gingen. Wir denken hier an die „Letzten“, die Heiden aus dem Osten, Westen, Norden und Süden, bekehrten Zöllner und Sünder, an jene, die einen großen Teil ihres Lebens leider woanders verbracht haben und erst zu später Stunde auf den Marktplatz gekommen sind, ja, auch an jene, deren Möglichkeiten, Fähigkeiten, Kräfte oder Zeit sehr begrenzt waren – und wir danken Gott für die Lehre dieses Gleichnisses. Und sollten noch Zweifel bestehen, so müssen sie durch die Schlusssätze dieses Teils des Gleichnisses ausgeräumt werden, in denen der Hausherr dargestellt wird, wie er zur letzten Stunde hinausgeht, und als er andere stehen sieht,1 fragt er sie, warum sie den ganzen Tag müßig dagestanden haben, worauf sie antworten, dass niemand sie eingestellt habe. Auch diese werden wiederum in den Weinberg geschickt, allerdings offenbar ohne ein ausdrückliches Versprechen. Es zeigt sich also, dass im Verhältnis zur Verspätung ihrer Arbeit die gefühlte Abwesenheit jeglicher Forderung seitens der Arbeiter und ihr einfaches Vertrauen in ihren Arbeitgeber stand.
Und nun ist es Abend. Die Zeit der Arbeit ist vorbei, und der Herr des Weinbergs fordert seinen Verwalter [hier Christus] auf, seine Arbeiter zu bezahlen. Doch hier wartet die erste Überraschung auf sie. Die Reihenfolge der Bezahlung ist die umgekehrte wie die der Arbeit: „von den Letzten zu den Ersten“. Dies ist fast ein notwendiger Teil des Gleichnisses. Denn wenn die ersten Arbeiter zuerst bezahlt worden wären, wären sie entweder weggegangen, ohne zu wissen, was mit den Letzten geschehen ist, oder, wenn sie geblieben wären, hätte ihr Einwand nicht geltend gemacht werden können, es sei denn aus offensichtlicher Böswilligkeit gegenüber ihren Nächsten. Nachdem sie ihren Lohn erhalten hatten, hätten sie nicht einwenden können, dass sie nicht genug erhalten hätten, sondern nur, dass die anderen zu viel erhalten hätten. Aber es war nicht der Zweck des Gleichnisses, diejenigen, die einen höheren Lohn anstrebten oder sich für berechtigt hielten, der bewussten Böswilligkeit zu bezichtigen. Als Hinweis auf die Gesinnung der späteren Arbeiter bemerken wir außerdem, dass die der dritten Stunde nicht murrten, weil sie nicht mehr bekommen hatten als die der elften Stunde. Dies entspricht dem Umstand, dass sie in der ersten Stunde keinen Handel abgeschlossen hatten, sondern sich ganz auf den Hausherrn verließen. Aber die der ersten Stunde hatten ihren Geiz geweckt. Als sie sahen, was die anderen erhalten hatten, erwarteten sie, mehr zu bekommen, als ihnen zustand. Als sie ebenfalls jeder einen Denar erhielten, murrten sie, als sei ihnen Unrecht getan worden. Und wie meistens in solchen Fällen schienen Wahrheit und Fairness auf ihrer Seite zu sein. Denn hatte nicht der Hausherr, indem er den extremen Fall der Arbeiter der elften Stunde auswählte, diejenigen, die nur eine Stunde gearbeitet hatten1 , mit denen gleichgestellt, die „die Last des Tages und der Hitze getragen hatten“? Doch so gerecht ihre Argumentation auch erscheinen mochte, sie hatten keinen Anspruch auf Wahrheit oder Gerechtigkeit, denn hatten sie sich nicht mit ihm auf einen Denar geeinigt? Und es handelte sich nicht einmal um einen allgemeinen Tagelohn, sondern sie hatten ausdrücklich einen Denar ausgehandelt. Sie waren zur Arbeit gegangen und hatten eine bestimmte Summe als Lohn vor Augen. Sie appellierten nun an die Gerechtigkeit; aber sie hatten von Anfang bis Ende Recht bekommen. Dies gilt für das Prinzip „so viel für so viel“ in Bezug auf Anspruch, Recht, Arbeit und Lohn.
Aber es gab noch einen anderen Aspekt als den der bloßen Gerechtigkeit. Die anderen Arbeiter, die spürten, dass sie wegen ihrer Verspätung keinen Anspruch hatten – und wer von uns spürt nicht, wie spät wir gekommen sind und wie wenig wir deshalb haben tun können -, hatten keinen Handel abgeschlossen, sondern vertrauten dem Meister. Und wie sie geglaubt hatten, so wurde es ihnen auch zuteil. Nicht weil sie irgendeinen Anspruch erhoben oder hatten – „Ich will aber diesem Letzten geben wie dir“ – das Wort „Ich will“ (θέλω) wird mit Nachdruck vorangestellt, um „das Wohlgefallen“ seiner Gnade als Grund des Handelns zu kennzeichnen. Ein solcher Meister hätte denjenigen nicht weniger geben können, die gekommen waren, als sie gerufen wurden, im Vertrauen auf seine Güte und nicht auf ihre Verdienste. Der Lohn wurde nun nicht nach Arbeit oder Schuld, sondern nach Gnade berechnet. Nebenbei bemerken wir auch, wie sehr das, was negative Kritiker das „wahre jüdische Evangelium“ des Matthäus nennen würden, mit dem übereinstimmt, was das Wesen der „antijudaischen Lehre“ des Paulus ausmacht – und wir bitten unsere Gegner, mit ihrer Theorie zu vereinbaren, was nur dadurch erklärt werden kann, dass Paulus, wie Matthäus, der wahre Schüler des wahren Lehrers Jesus Christus war.
Wenn aber alles auf den neuen Boden der Gnade gestellt werden soll, mit dem in der Tat die ganze Haltung der späteren Arbeiter übereinstimmt, dann (wie auch der heilige Paulus zeigt) waren die Arbeiter, die murrten, entweder der Unwissenheit schuldig, weil sie die Souveränität der Gnade nicht erkannten – dass es in Seiner Macht steht, mit den Seinen zu tun, was Er willb -, oder aber der Bosheit, als sie statt mit dankbarer Freude mit bösem Blick zusahen, und dies in dem Maße, wie „der Hausherr“ gut war. Aber eine solche Gesinnung kann sowohl bei den Juden als auch bei den Heiden anzutreffen sein. Und so werden in diesem anschaulichen Fall des Gleichnisses „die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten sein. „1 Und auch in anderen Fällen, wenn auch nicht in allen, „werden viele Letzte sein, die die Ersten sind, und Erste, die die Letzten sind.Er aber ist der Gott, der Herrscher der Gnade, in dessen Weinberg es für alle Arbeit gibt, wie begrenzt auch immer ihre Zeit, ihre Kraft oder ihre Gelegenheit sein mag; Der in seinem Verlangen nach der Arbeit und in seiner Herablassung und Geduld gegenüber den Arbeitern bis zur elften Stunde auf den Marktplatz hinausgeht und uns mit nur sanftem Tadel dafür, dass wir nicht früher dorthin gekommen sind und so unseren Tag im Müßiggang verloren haben, noch bis zum Schluss bittet zu kommen; der verspricht, was recht ist, und gibt weit mehr, als denen zusteht, die ihm einfach vertrauen: Der Gott, der nicht nur der Juden noch der Heiden ist, sondern unser Vater; der Gott, der nicht nur zahlt, sondern von dem Seinen frei gibt, und in dessen Weisheit und Gnade es sein kann, dass, wie die Ersten die Letzten sein werden, so werden die Letzten die Ersten sein.
Ein weiterer Punkt bleibt noch zu beachten. Wenn überhaupt, dann erwarten wir in diesen Gleichnissen, die an das Volk gerichtet sind, Formen der Lehre und des Redens, mit denen sie vertraut waren – mit anderen Worten, jüdische Parallelen. Aber wir erwarten auch, dass die Lehre Christi, obwohl sie unter Bildern vermittelt wird, mit denen die Juden vertraut waren, einen völlig anderen Geist hat. Und so ist es auch im vorliegenden Fall. Zunächst einmal: Wenn ein Mann nach jüdischem Recht einen Arbeiter ohne eine bestimmte Abmachung einstellte, sondern mit der Erklärung, dass er wie einer der Arbeiter des Ortes bezahlt würde, war er nach Ansicht einiger nur verpflichtet, den niedrigsten Lohn des Ortes zu zahlen, nach Ansicht der Mehrheit aber den Durchschnitt zwischen dem niedrigsten und dem höchsten. 2 Was wiederum den Wortlaut des Gleichnisses selbst betrifft, so haben wir eine bemerkenswerte Parallele in einer Leichenrede auf einen Rabbi, der im frühen Alter von achtundzwanzig Jahren starb. Der gewählte Text lautete: „Der Schlaf eines Mühseligen ist süß“und dies wurde durch das Gleichnis eines Königs illustriert, der einen Weinberg besaß und viele Arbeiter anstellte, um darin zu arbeiten. Einer von ihnen zeichnete sich vor allen anderen durch seine Fähigkeiten aus. Der König nahm ihn an die Hand und ging mit ihm auf und ab. Am Abend, als die Arbeiter bezahlt wurden, erhielt dieser denselben Lohn wie die anderen, so als hätte er den ganzen Tag gearbeitet. Daraufhin murrten die anderen, weil er, der nur zwei Stunden gearbeitet hatte, denselben Lohn erhielt wie sie, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, worauf der König antwortete: „Warum murrt ihr? Dieser Arbeiter hat durch sein Geschick in zwei Stunden so viel gearbeitet wie ihr den ganzen Tag.’a Dies in Bezug auf die großen Verdienste des verstorbenen jungen Rabbiners.
Aber man wird feststellen, dass die Moral des jüdischen Gleichnisses bei aller Ähnlichkeit der Form genau in die entgegengesetzte Richtung der Lehre Christi geht. Derselbe Geist von Arbeit und Lohn weht in einem anderen Gleichnis, das den Gedanken veranschaulichen soll, dass Gott nicht für jedes Gebot den damit verbundenen Lohn offenbart hat, damit die Menschen nicht diejenigen vernachlässigen, die weniger Ertrag bringen. Ein König – so heißt es in dem Gleichnis – hatte einen Garten, für den er Arbeiter anstellte, ohne ihnen zu sagen, wie hoch ihr Lohn sein würde. Am Abend rief er sie, und nachdem er von jedem erfahren hatte, unter welchem Baum er gearbeitet hatte, bezahlte er sie nach dem Wert der Bäume, an denen sie gearbeitet hatten. Und als sie sagten, er hätte ihnen sagen sollen, welche Bäume den Arbeitern den meisten Lohn bringen würden, antwortete der König, dass dadurch ein großer Teil seines Gartens vernachlässigt worden wäre. So hatte Gott auch nur den Lohn für das größte der Gebote, nämlich Vater und Mutter zu ehren,und den für das kleinste, nämlich die Vogelmutter wegfliegen zu lassen,c offenbart und beiden genau denselben Lohn beigelegt.
Dazu könnte man, wenn es nötig wäre, noch andere Illustrationen jener schmerzlichen Abrechnung mit Arbeit oder Leiden und Lohn hinzufügen, die die jüdische Theologie ebenso kennzeichnet wie die der Arbeiter im Gleichnis.
Das zweite Gleichnis in dieser Reihe – oder vielleicht eher Illustration – wurde im Tempel gesprochen. Der Heiland hatte auf die Frage der Pharisäer nach seiner Autorität mit einer Berufung auf das Zeugnis des Täufers geantwortet. Dies veranlasste ihn, auf die zweifache Aufnahme dieses Zeugnisses hinzuweisen – einerseits durch die Zöllner und Huren und andererseits durch die Pharisäer.
In dem nun folgenden Gleichnis wird ein Mann vorgestellt, der zwei Söhne hat. Er geht zu dem ersten und bittet ihn in einer Sprache der Zuneigung (τέκνον), in seinem Weinberg zu arbeiten. Der Sohn weigert sich schroff und unhöflich; aber danach ändert er seine Meinung1 und geht. 2 In der Zwischenzeit ist der Vater, nachdem er von dem einen abgelehnt wurde, zu seinem anderen Sohn mit demselben Auftrag gegangen. Der Kontrast ist hier deutlich. Der Ton ist sehr höflich, und die Antwort des Sohnes enthält nicht nur ein Versprechen, sondern wir sehen fast, wie er geht: „Ich, Herr! und er ging nicht. Die Anwendung war einfach. Der erste Sohn stand für die Zöllner und Huren, die den Ruf des Vaters schroff und unhöflich ablehnten, weil sie ein Leben in rücksichtsloser Sünde führten. Doch dann änderten sie ihre Meinung und gingen in den Weinberg des Vaters. Der andere Sohn mit seinem höflichen Ton und seinem bereitwilligen Versprechen, aber seiner völligen Vernachlässigung der eingegangenen Verpflichtungen, stellte die Pharisäer mit ihren heuchlerischen und leeren Bekenntnissen dar. Und Christus zwang sie, das Gleichnis anzuwenden. Als sie vom Herrn gefragt wurden, wer von den beiden den Willen seines Vaters getan habe, konnten sie sich der Antwort nicht entziehen. Dann wies er in ebenso strenger wie wahrhaftiger Sprache auf die Moral hin. Der Täufer war gekommen, um Gerechtigkeit zu predigen, und während die selbstgerechten Pharisäer ihm nicht geglaubt hatten, hatten diese Sünder es getan. Doch selbst als die Pharisäer die Wirkung auf diese ehemaligen Sünder sahen, änderten sie ihre Meinung nicht, damit sie glauben konnten. Deshalb würden die Zöllner und Huren vor ihnen in das Reich Gottes eingehen und taten es auch.
In engem Zusammenhang mit den beiden vorangegangenen Gleichnissen, ja mit dem gesamten Tenor der Reden Christi zu jener Zeit, steht das Gleichnis von den bösen Knechten im Weinberg. Wie im Gleichnis von den Arbeitern, die der Hausherr zu verschiedenen Zeiten suchte, geht es hier darum, die Geduld und Güte des Hausherrn auch gegenüber den Bösen darzustellen. Und wie im Gleichnis von den zwei Söhnen auf die praktische Verwerfung des Zeugnisses des Täufers durch die Juden und ihren daraus folgenden Selbstausschluss vom Reich hingewiesen wird, so wird hier auf Johannes als den Größeren unter den Propheten,b auf den Ausschluss Israels als Volk von seiner Stellung im Reich,und auf seine Bestrafung als Einzelner angespielt. d Nur dass wir hier eine schreckliche Entwicklung feststellen. Die Vernachlässigung und der Unglaube, die sich im vorigen Gleichnis gezeigt hatten, sind nun zur Rebellion gereift, die sich vorsätzlich verschlimmert und in der Ermordung des einzigen und geliebten Sohnes des Königs ihre äußerste Konsequenz gefunden hat. In ähnlicher Weise wird das, was früher als ihr Verlust erschien, weil die Sünder vor ihnen in das Reich Gottes gingen, jetzt als ihre Schuld und ihr Gericht dargestellt, sowohl national als auch individuell.
Das Gleichnis beginnt, wie das in Jes. 5, mit einer Beschreibung der vollständigen Vorkehrungen, die der Besitzer des Weinbergs getroffen hat,um zu zeigen, wie alles getan wurde, um einen guten Ertrag an Früchten zu sichern, und welches Recht der Besitzer hatte, zumindest einen Anteil daran zu erwarten. Im Gleichnis wie in der Prophezeiung steht der Weinberg für die Theokratie, obwohl er im Alten Testament notwendigerweise mit der Nation Israel identifiziert wird,während im Gleichnis die beiden unterschieden werden und die Nation durch die Arbeiter repräsentiert wird, an die der Weinberg „verpachtet“ wurde. In der Tat zeigt die ganze Struktur des Gleichnisses, dass die Knechte Israel als Nation sind, obwohl sie in der Person ihrer Vertreter und Führer angesprochen und behandelt werden. Und so wurde es „zum Volk gesprochen „, und doch „erkannten die Hohenpriester und Pharisäer“ mit Recht, „dass er von ihnen redete „.
Diesen Weinberg hatte der Besitzer an Knechte verpachtet, während er selbst, wie der heilige Lukas hinzufügt, „für eine lange Zeit verreist“ war. Aus der Sprache ist ersichtlich, dass die Weingärtner die volle Verwaltung des Weinbergs hatten. Wir erinnern uns, dass es drei Arten des Umgangs mit Land gab. Nach einer von ihnen (Arisuth) erhielten „die angestellten Arbeiter“ einen bestimmten Anteil an den Früchten, etwa ein Drittel oder ein Viertel des Ertrags. In solchen Fällen scheint es zumindest manchmal üblich gewesen zu sein, ihnen nicht nur einen Teil des Ertrags zu geben, sondern auch das Saatgut (für ein Feld) bereitzustellen und den Arbeitern Lohn zu zahlen. e Die beiden anderen Arten der Landverpachtung bestanden darin, dass der Pächter entweder eine Geldpacht an den Eigentümer entrichtete,oder dass er sich verpflichtete, dem Eigentümer eine bestimmte Menge an Erträgen zu liefern, unabhängig davon, ob die Ernte gut oder schlecht war. g Solche Pachtverträge wurden auf ein Jahr oder auf Lebenszeit vergeben; manchmal war die Pacht sogar erblich und ging vom Vater auf den Sohn über. kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass es die letztere Art von Pacht (Chakhranutha, von חכר) ist, auf die sich das Gleichnis bezieht, wobei die Pächter verpflichtet sind, dem Eigentümer eine bestimmte Menge an Früchten zu ihrer Zeit zu geben.
Als sich die Zeit der Früchte näherte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um die Früchte zu holen – den Teil, der ihm gehörte, oder, wie Markus und Lukas es ausdrücken, „die Früchte des Weinbergs“. Wir schließen daraus, dass es sich um eine Reihe von Knechten handelte, die von diesen bösen Weingärtnern immer schlechter behandelt wurden. Man hätte erwarten können, dass der Besitzer nun strenge Maßnahmen ergreifen würde; aber stattdessen schickte er in seiner Geduld und Güte „andere Knechte“ – nicht „mehr, was kaum eine Bedeutung hätte, sondern „mehr als die ersten“, zweifellos in der Vorstellung, dass ihre größere Autorität Respekt gebieten würde. Und wenn auch diese die gleiche Behandlung erfuhren, müssen wir davon ausgehen, dass dies nicht nur eine zusätzliche, sondern eine noch größere Schuld seitens der Knechte bedeutete. Erneut und mit zunehmender Schärfe stellt sich die Frage, welche Maßnahmen der Eigentümer nun ergreifen würde. Aber wieder haben wir nur eine neue und noch größere Demonstration seiner Geduld und seines Unwillens zu glauben, dass diese Knechte so böse waren. Der heilige Markus drückt es pathetisch aus und weist damit nicht nur auf die Güte des Besitzers hin, sondern auch auf den Geist der entschlossenen Rebellion und die Schlechtigkeit der Knechte: Er hatte noch einen Sohn, den er liebte, und schickte ihn als letzten zu ihnen, in der Annahme, dass sie ihn ehren würden. Das Ergebnis war anders. Das Auftauchen des rechtmäßigen Erben ließ sie um ihren Besitz bangen. Praktisch gehörte der Weinberg bereits ihnen; durch die Tötung des Erben würde der einzige Anwärter darauf aus dem Weg geräumt, und so würde der Weinberg in jeder Hinsicht ihnen gehören. Denn die Weingärtner gingen davon aus, dass der Besitzer, da er „lange Zeit“ unterwegs war, nicht persönlich eingreifen würde – ein Eindruck, der durch den Umstand verstärkt wurde, dass er die frühere Misshandlung seiner Knechte nicht gerächt hatte, sondern nur andere in der Hoffnung schickte, sie durch Milde zu beeinflussen. Da ergriffen die Knechte „ihn [den Sohn] und stießen ihn aus dem Weinberg und töteten ihn“ – die erste Handlung, die darauf hinweist, dass sie ihn mit Gewalt aus seinem Besitz vertrieben, bevor sie ihn auf böse Weise umbrachten.
Die Bedeutung des Gleichnisses ist hinreichend klar. Der Besitzer des Weinbergs, Gott, hatte seinen Weinberg, die Theokratie, an sein altes Volk verpachtet. Nachdem der Bund geschlossen worden war, zog Er sich gleichsam zurück – die frühere direkte Kommunikation zwischen Ihm und Israel hörte auf. Dann sandte er zu gegebener Zeit „seine Diener“, die Propheten, aus, um seine Früchte zu ernten – sie hatten die ihren in allen zeitlichen und geistlichen Vorteilen des Bundes gehabt. Aber anstatt die Früchte zurückzubringen, die der Buße entsprechen, misshandelten sie nur seine Boten, und das zunehmend, sogar bis zum Tod. In seiner Langmut sandte er als Nächstes einen „Größeren“ als sie – Johannes den Täufer. Und als auch er die gleiche Behandlung erfuhr, sandte er zuletzt seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Sein Erscheinen ließ sie spüren, dass nun ein entscheidender Kampf um den Weinberg entbrannte – und so vertrieben sie den rechtmäßigen Erben aus seinem eigenen Besitz, um ihn für sich zu gewinnen, und töteten ihn dann!
Und sie müssen den Sinn des Gleichnisses verstanden haben, die sich als Erben ihrer Väter im Mord an allen Propheten betätigt hatten,die gerade wegen der Verwerfung der Botschaft des Täufers verurteilt worden waren und deren Herzen schon damals voller mörderischer Gedanken gegen den rechtmäßigen Erben des Weinbergs waren. Aber dennoch müssen sie ihr eigenes Urteil sprechen. Auf seine Herausforderung, was der Besitzer des Weinbergs ihrer Meinung nach mit diesen Knechten tun würde, konnten die Hohenpriester und Pharisäer nur antworten: Wie böse Menschen wird er sie vernichten. Und den Weinberg wird Er anderen Weingärtnern überlassen, die Ihm die Früchte zu ihrer Zeit bringen werden. „
Die Anwendung lag auf der Hand und wurde von Christus zuerst, wie immer, durch einen Verweis auf das prophetische Zeugnis gemacht, das nicht nur die Einheit aller Lehren Gottes zeigt, sondern auch die Kontinuität des heutigen Israels mit dem alten in seinem Widerstand und seiner Ablehnung von Gottes Rat und Boten. Das Zitat, von dem man sich kein treffenderes vorstellen kann, stammt aus Ps. 118:22, 23 und wurde im (griechischen) Matthäus-Evangelium – nicht notwendigerweise von Christus – nach der LXX. Fassung. Der einzige, fast verbale Unterschied zwischen ihr und dem Original besteht darin, daß in der letzteren die Annahme des von den Bauleuten verworfenen Steins als Haupt des Ecks („dieser“, hoc, זֹאת) Jehova zugeschrieben wird, während in der LXX. seine ursprüngliche Bezeichnung (αὕτη) als Haupt des Ecks (vor der Handlung der Bauleute) auf den Herrn zurückgeführt wird. Und dann folgte in klarer und unmissverständlicher Sprache die schreckliche Vorhersage, zunächst auf nationaler Ebene, dass das Reich Gottes von ihnen genommen und „einem Volk gegeben werden würde, das seine Früchte hervorbringt“, und dann auf individueller Ebene, dass jeder, der über diesen Stein stolpert und aus persönlicher Beleidigung oder Feindseligkeit über ihn fällt, in Stücke zerbrochen werden , aber jeder, der sich seinem Vorankommen in den Weg stellt oder sich ihm widersetzt, und auf den er deshalb fällt, wird „wie Staub zerstreut“.
Wieder einmal wurde ihr Zorn geweckt, aber auch ihre Furcht. Sie wussten, dass er von ihnen redete, und hätten ihm gern die Hände aufgelegt; aber sie fürchteten das Volk, das ihn in jenen Tagen als Propheten ansah. So verließen sie ihn vorerst und gingen ihrer Wege.
Während die rabbinischen Schriften kaum eine Parallele zum vorangegangenen Gleichnis bieten, scheint das Gleichnis von der Hochzeit des Königssohns und dem Hochzeitsgewandb in der jüdischen Tradition fast unverändert zu sein. In seiner ältesten Formc wird es Jochanan ben Zakkai zugeschrieben, der etwa zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evangeliums blühte. In den jüdischen Kommentaren erscheint es mit verschiedenen oder zusätzlichen Details. Aber während das Gleichnis unseres Herrn nur aus zwei Teilen besteht,die ein Ganzes bilden und eine Lehre haben, teilt der Talmud es in zwei getrennte Gleichnisse auf, von denen das eine die Notwendigkeit aufzeigen soll, für das Jenseits vorbereitet zu sein – sich für das Fest des Königs bereit zu halten; c während das andere1 lehren soll, dass wir in der Lage sein sollen, unsere Seele am Ende in demselben Zustand der Reinheit Gott darzubringen, in dem wir sie (nach rabbinischen Vorstellungen) ursprünglich empfangen hatten. Schon dies zeigt den unendlichen Unterschied zwischen dem Gebrauch des Gleichnisses durch den Herrn und den Rabbinern. 2 In dem jüdischen Gleichnis wird ein König dargestellt, der zu einem Festmahl einlädt,ohne jedoch den genauen Zeitpunkt dafür festzulegen. Die Weisen schmücken sich rechtzeitig und setzen sich an die Tür des Palastes, um bereit zu sein, denn in einem Palast, so argumentieren sie, kann es keine aufwendigen Vorbereitungen für ein Festmahl geben; die Törichten hingegen gehen an ihre Arbeit und argumentieren, es müsse Zeit genug sein, denn ohne Vorbereitung könne es kein Festmahl geben. (Der Midrasch erzählt, dass der König bei der Einladung der Gäste ihnen befohlen hatte, sich zu waschen, zu salben und in ihre festlichen Gewänder zu kleiden, und dass die Toren mit dem Argument, dass sie durch die Zubereitung der Speisen und die Anordnung der Plätze erfahren würden, wann das Fest beginnen würde, wie der Maurer zu seinem Kalkfass, der Töpfer zu seinem Ton, der Schmied zu seinem Ofen und der Bleicher zu seinem Bleichplatz gegangen waren). Doch plötzlich kommt die Aufforderung des Königs zum Fest, und die Weisen erscheinen festlich geschmückt, und der König freut sich über sie, und sie dürfen sich setzen, essen und trinken, während er zornig ist über die Törichten, die armselig erscheinen und in Angst, Hunger und Durst dastehen und zusehen müssen.
Das andere jüdische Gleichnis handelt von einem König, der seinen Dienern die königlichen Gewänder anvertraute. Die Weisen unter ihnen legten sie sorgfältig ab, während die Toren sie anzogen, wenn sie ihre Arbeit verrichteten. Nach einiger Zeit verlangte der König die Gewänder zurück, als die Weisen sie sauber zurückgeben konnten, während die Törichten sie beschmutzt hatten. Da freute sich der König über die Weisen, und die Gewänder wurden in der Schatzkammer aufbewahrt, und sie durften in Frieden nach Hause gehen. Den Törichten aber befahl er, die Gewänder dem Abfüller zu übergeben und sie selbst ins Gefängnis zu werfen. Wir sehen leicht, dass der Sinn dieses Gleichnisses darin bestand, dass ein Mensch seine Seele vollkommen rein bewahren und so in den Frieden eingehen konnte, während die Unvorsichtigen, die ihre ursprüngliche Reinheit [hier keine Erbsünde] verloren hatten, in der nächsten Welt durch Leiden sowohl ihre Schuld sühnen als auch ihre Seelen reinigen würden.
Wenn wir uns von diesen rabbinischen Verdrehungen abwenden und uns dem Gleichnis unseres Herrn zuwenden, ist seine Bedeutung nicht schwer zu verstehen. Der König machte eine Hochzeit1 für seinen Sohn und sandte seine Diener aus, um die zur Hochzeit Geladenen zu rufen. Offensichtlich war der Ankündigung, dass alles bereit war, eine allgemeine Einladung vorausgegangen, wie im jüdischen Gleichnis und wie zuvor in dem der zum großen Abendmahl geladenen Gäste. Tatsächlich heißt es im Midrasch zum Klagelied. 4:2,wird neben anderen Unterscheidungen der Einwohner Jerusalems ausdrücklich erwähnt, dass keiner von ihnen zu einem Festmahl ging, bevor die Einladung ausgesprochen und wiederholt worden war. Im Gleichnis aber wollten die Eingeladenen nicht kommen. Es erinnert uns sowohl an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die zu verschiedenen Zeiten gesucht wurden, als auch an die wiederholte Entsendung von Boten zu den bösen Knechten, um die fälligen Früchte zu holen, wenn uns als Nächstes gesagt wird, dass der König andere Diener aussandte, um ihnen zu sagen, dass sie kommen sollten, denn er hatte sein „Frühmahl“ (ἄριστον, nicht „Abendessen“, wie in der Autorisierten und Revidierten Fassung) vorbereitet, und dass, zweifellos im Hinblick auf das spätere Mahl, die Ochsen und die Masttiere getötet wurden. Diese wiederholten Bemühungen, zu rufen, zu ermahnen und einzuladen, bilden ein charakteristisches Merkmal dieser Gleichnisse und zeigen, dass es eines der zentralen Ziele der Lehre unseres Herrn war, die Langmut und Güte Gottes zu zeigen. Anstatt diesen wiederholten und eindringlichen Aufforderungen Folge zu leisten, heißt es im Gleichnis: „Aber sie (die einen) machten sich darüber lustig und gingen weg, einer in sein Land, der andere zu seinem eigenen Gut.
So die eine Klasse; die andere machte es sich nicht leicht, sondern handelte noch schlimmer als die erste. Die anderen aber legten Hand an seine Knechte, bedrängten sie schändlich und töteten sie. Darunter ist zu verstehen, dass die einen, als die Diener mit der zweiten und dringlicheren Botschaft kamen, den König, die Hochzeit seines Sohnes und das Fest verachteten und sich vorzugsweise mit ihrem eigenen Besitz oder Erwerb beschäftigten – ihrem Eigentum oder ihrem Handel, ihren Vergnügungen oder ihren Zielen und Begierden. Und als diese gegangen waren und vielleicht noch die Diener zurückblieben, um die Botschaft ihres Herrn zu verkünden, wurden sie von den übrigen böse angefeindet und dann umgebracht – was über die bloße Verachtung, das Desinteresse und die Beschäftigung mit den eigenen Angelegenheiten hinausging und zu Hass und Mord führte. Die Sünde war umso schlimmer, als er ihr König war und die Gesandten sie zu einem Festmahl eingeladen hatten, an dem jeder treue Untertan gerne teilgenommen hätte. Es handelte sich also nicht nur um einen Mord, sondern auch um eine Rebellion gegen ihren Herrscher. Daraufhin schickte der König in seinem Zorn seine Heere aus, die – und hier nimmt die Erzählung das Ereignis zeitlich vorweg – die Mörder vernichteten und ihre Stadt niederbrannten.
Doch die Bestrafung dieser Rebellen ist nur ein Teil des Gleichnisses. Denn es lässt die Hochzeit immer noch ohne Gäste, die an der Freude des Königs teilhaben und an seinem Festmahl teilnehmen können. Und so geht die Erzählung weiter:“Dann, nachdem der König seinen Truppen den Befehl zum Auszug gegeben hatte, sagte er zu seinen Dienern: „Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die, die geladen waren, waren es nicht wert. Geht nun an die Abzweigungen der Landstraßen [wo sich mehrere Straßen treffen und kreuzen] und ladet so viele zur Hochzeit ein, wie ihr finden werdet. Wir erinnern uns, dass das Gleichnis hier parallel zu dem anderen läuft, in dem zuerst die Ausgestoßenen aus den Städten und dann die Wanderer auf den Straßen der Welt den Platz der geladenen Gäste einnahmen. b Auf den ersten Blick scheint es so, als ob es keinen Zusammenhang zwischen der Erklärung, dass die Eingeladenen sich als unwürdig erwiesen hatten, und der Anweisung, auf die Straßenkreuzungen zu gehen und alle zu sammeln, die sie finden könnten, gäbe, da letztere sich natürlich als weniger würdig erweisen könnten. Dies ist jedoch einer der wichtigsten Punkte in dem Gleichnis. Die erste Einladung erging an ausgewählte Gäste – die Juden -, von denen man erwarten konnte, dass sie „würdig“ waren, die sich aber als unwürdig erwiesen hatten; die nächste sollte nicht an die auserwählte Stadt oder das auserwählte Volk ergehen, sondern an alle, die, in welcher Richtung auch immer, auf der Weltstraße reisten, und sie dort erreichen, wo sich die Wege des Lebens treffen und trennen.
Wir haben die Deutung dieses Gleichnisses zum Teil schon vorweggenommen. Das „Königreich“ wird hier, wie so oft im Alten und im Neuen Testament, mit einem Festmahl verglichen, und zwar mit einem Hochzeitsmahl. Das Besondere daran ist, dass der König es für seinen Sohn ausrichtet. So bildet Christus als Sohn und Erbe des Reiches die zentrale Figur im Gleichnis. Dies ist der erste Punkt, der uns vor Augen geführt wird. Der nächste ist, dass die auserwählten, eingeladenen Gäste das alte Bundesvolk Israel waren. Zu ihnen hatte Gott zuerst im Alten Testament gesandt. Und obwohl sie seinem Ruf nicht gefolgt waren, wurde ihnen im Neuen Testament eine zweite Klasse von Boten gesandt. Deren Botschaft lautete, dass das „Frühmahl“ (das erste Kommen Christi) bereit sei und dass alle Vorbereitungen für das große Abendmahl (die Herrschaft Christi) getroffen worden seien. Eine weitere herausragende Wahrheit wird in der wiederholten Botschaft des Königs dargelegt, die auf die Güte und Langmut Gottes hinweist. Als Nächstes wird unsere Aufmerksamkeit auf die Weigerung Israels gelenkt, die sich in der verächtlichen Vernachlässigung und Beschäftigung der einen Partei mit ihren eigenen Dingen und dem Hass, Widerstand und Mord der anderen Partei zeigt. Dann folgen in rascher Folge der Befehl zum Gericht über das Volk und die Verbrennung ihrer Stadt – Gottes Heer sind in diesem Fall die Römer – und schließlich die Anweisung, auf die Kreuzwege zu gehen, um alle Menschen einzuladen, sowohl Juden als auch Heiden.
Mit Vers 10 beginnt der zweite Teil des Gleichnisses. Die „Knechte“ – d.h. die neutestamentlichen Boten – hatten ihren Auftrag erfüllt; sie hatten so viele aufgenommen, wie sie vorfanden, sowohl Böse als auch Gute, d.h. ohne Rücksicht auf ihre Vorgeschichte oder ihren moralischen und religiösen Zustand bis zum Zeitpunkt ihrer Berufung; und „die Hochzeit war voll von Gästen“ – d.h. der Tisch beim Hochzeitsmahl war voll von denen, die als Gäste „um ihn herumlagen“ (ἀνακειμένων). Aber wenn wir jemals lernen sollen, dass wir auf Erden – nicht einmal am Hochzeitstisch des Königs – eine reine Kirche erwarten dürfen, dann sicherlich aus dem, was nun folgt. Der König trat ein, um seine Gäste zu sehen, und er entdeckte unter ihnen einen, der kein Hochzeitsgewand trug. Offensichtlich haben die Schnelligkeit der Einladung und die vorherige Unvorbereitetheit der Gäste die Beschaffung eines solchen Gewandes nicht verhindert. Da es sich bei den Gästen um Reisende handelte und das Fest im Palast des Königs stattfand, können wir nicht irren, wenn wir annehmen, dass solche Kleidungsstücke im Palast selbst für alle, die sie suchten, bereitgestellt wurden. Dazu passt auch der Umstand, dass der Angesprochene „sprachlos“ war [wörtlich: „geknebelt“ oder „mundtot gemacht“]. Sein Verhalten deutet auf völlige Gefühllosigkeit in Bezug auf das, wozu er gerufen worden war – auf Unwissenheit darüber, was dem König gebührt und was zu einem solchen Fest gehört. Denn obwohl von den geladenen Gästen keine vorherige Vorbereitung verlangt wurde, sondern alle eingeladen waren, ob gut oder schlecht, so blieb doch die Tatsache bestehen, dass sie, wenn sie an dem Fest teilnehmen wollten, ein dem Anlass entsprechendes Gewand anziehen mussten. Alle sind zum Festmahl des Evangeliums eingeladen; aber wer daran teilnehmen will, muss das königliche Hochzeitsgewand der evangelischen Heiligkeit anziehen. Und wenn im Gleichnis gesagt wird, dass nur einer ohne dieses Kleid erkannt wurde, so soll dies lehren, dass der König seine Gäste nicht nur allgemein ansehen wird, sondern dass jeder einzeln geprüft wird und dass niemand – nein, kein einziger – in der Masse der Gäste der Entdeckung entgehen kann, wenn er nicht das „Hochzeitsgewand“ trägt. Kurzum, an diesem Tag der Prüfung werden nicht die Kirchen, sondern die Einzelnen in der Kirche untersucht. Und so befahl der König den Dienern -διακόνοις -, nicht denselben, die zuvor die Einladung (δούλοις) überbracht hatten, sondern anderen – hier offensichtlich den Engeln, seinen „Dienern“ -, ihn an Händen und Füßen zu fesseln und „in die Finsternis, das Äußere“ hinauszuwerfen, d.h. er sollte, unfähig, Widerstand zu leisten, und als bestrafter Gefangener in jene Finsternis hinausgeworfen werden, die sich außerhalb des hell erleuchteten Gastzimmers des Königs befindet. Und um diese Finsternis noch weiter zu kennzeichnen, wird hinzugefügt, dass es sich dabei um den bekannten Ort des Leidens und der Qualen handelt: „Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein“.
Und hier schließt das Gleichnis mit der allgemeinen Aussage, die sowohl für den ersten Teil des Gleichnisses – für die ersten geladenen Gäste, Israel – als auch für den zweiten Teil, die Gäste aus der ganzen Welt, gilt: „Denn“ (das ist der Sinn des ganzen Gleichnisses) „viele sind berufen, aber wenige auserwählt“.Zum Verständnis dieser Worte müssen wir bedenken, dass die beiden Sätze logischerweise durch dieselben Worte ergänzt werden müssen. Der Vers würde also lauten: Viele sind von Gott aus der Welt berufen, am Festmahl des Evangeliums teilzunehmen, aber wenige aus der Welt – nicht aus den Berufenen – sind von Gott auserwählt, daran teilzunehmen. Der Ruf zum Festmahl und die Auswahl für das Festmahl sind nicht identisch. Der Ruf ergeht an alle; aber er kann äußerlich angenommen werden, und ein Mensch kann sich zum Festmahl setzen, und doch kann er nicht auserwählt werden, am Festmahl teilzunehmen, weil er nicht das Hochzeitsgewand der bekehrenden, heiligenden Gnade hat. Und so kann man sogar von der Hochzeitstafel in die Dunkelheit hinausgestoßen werden, mit ihrem Kummer und ihrer Angst.
So liegen diese beiden – Gottes Ruf und Gottes Wahl – Seite an Seite und doch weit voneinander entfernt. Das Bindeglied zwischen ihnen ist das Anziehen des Hochzeitsgewandes, das im Palast frei gegeben wird. Doch wir müssen es suchen, darum bitten, es anziehen. Und so haben wir auch hier, Seite an Seite, Gottes Gabe und die Aktivität des Menschen. Und doch gilt für alle Zeiten und für alle Menschen gleichermaßen in seiner Warnung, seiner Lehre und seinem Segen: „Viele sind berufen, aber wenige auserwählt!
(Matthäus 24; Markus 13; Lukas 21,5-38; 12,35-48).
Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten
DIE letzte und feierlichste Anprangerung Jerusalems war ausgesprochen worden, die letzte und schrecklichste Vorhersage des Gerichts über den Tempel, und Jesus ließ dem Wort die Tat folgen. Es war, als hätte er den Staub von seinen Schuhen auf das „Haus“ geworfen, das „verwüstet“ werden sollte. Und so verließ Er für immer den Tempel und diejenigen, die darin ihr Amt ausübten.
Sie hatten das Heiligtum und die Stadt verlassen, den schwarzen Kidron überquert und waren langsam auf den Ölberg gestiegen. Eine plötzliche Wegbiegung, und das Heilige Gebäude war wieder in voller Sicht. In diesem Moment warf die westliche Sonne ihre goldenen Strahlen auf die Spitzen der marmornen Kreuzgänge und auf die terrassenförmig angelegten Höfe und glitzerte auf den goldenen Spitzen des Daches des Heiligtums. In der untergehenden Sonne, mehr noch als in der aufgehenden, müssen die gewaltigen Proportionen, die Symmetrie und der funkelnde Glanz dieser Masse aus schneebedecktem Marmor und Gold herrlich hervorgehoben worden sein. Und auf der anderen Seite des schwarzen Tals und an den Hängen des Ölbergs lagen die dunklen Schatten jener gigantischen Mauern aus massiven Steinen, von denen einige fast vierundzwanzig Fuß lang waren. Sogar die Rabbiner gerieten trotz ihres Hasses auf Herodes ins Schwärmen und träumten davon, dass die Tempelmauern selbst mit Gold bedeckt gewesen wären, wenn der bunte Marmor, der den Wellen des Meeres glich, nicht noch schöner gewesen wäre. Wahrscheinlich durchbrachen sie beim Anblick all dieser Pracht und Stärke das Schweigen, das ihnen durch die düsteren Gedanken an die nahe Verwüstung des Hauses auferlegt worden war, die der Herr vorausgesagt hatte. b Einer nach dem anderen wies ihn auf die massiven Steine und die prächtigen Gebäude hin oder sprach von den reichen Opfergaben, mit denen der Tempel geschmückt war. war nur natürlich, dass der Kontrast zwischen dieser und der vorausgesagten Verwüstung sie beeindruckte; natürlich auch, dass sie darauf hinwiesen – nicht als Frage, sondern als Zweifel. a Dann sprach Jesus, der sich wahrscheinlich an einen seiner Fragesteller wandte – vielleicht an den ersten oder den Hauptfragesteller ausführlich über den schrecklichen Kontrast zwischen der Gegenwart und der nahen Zukunft, in der, wie es mit fast unglaublicher Wörtlichkeit erfüllt wurde,1 kein Stein auf dem anderen bleiben würde, der nicht umgestürzt wäre.
Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Auf dem Ölberg setzten sie sich nieder, direkt gegenüber dem Tempel. Unabhängig davon, ob die anderen weiter gegangen waren oder ob Christus mit diesen vier allein gesessen hatte, werden Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas als diejenigen genannt, die ihn nun weiter nach dem fragten, was ihnen so schwer auf dem Herzen gelegen haben muss. Es war keine müßige Neugier, wenngleich eine solche Frage, selbst wenn sie nur der Information diente, einem Juden kaum zum Vorwurf gemacht werden konnte. Aber es ging sie persönlich an, denn hatte der Herr nicht die Verwüstung dieses „Hauses“ mit seiner eigenen Abwesenheit in Verbindung gebracht? Er hatte erklärt, dass Ersteres den Untergang der Stadt und die völlige Zerstörung des Tempels bedeute. Aber zu seiner Vorhersage waren diese Worte hinzugefügt worden: Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr sagen werdet: „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn“. Nach ihrer Auffassung konnte sich dies nur auf seine Wiederkunft und das damit verbundene Ende der Welt beziehen. Dies erklärt die zweifache Frage, die die vier nun an Christus richteten: „Sage uns, wann wird dies geschehen, und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und der Vollendung des Zeitalters sein? „
Unabhängig von anderen Aussagen, in denen zwischen diesen beiden Ereignissen unterschieden wird, können wir kaum glauben, dass die Jünger die Verwüstung des Tempels mit der unmittelbaren Ankunft Christi und dem Ende der Welt in Verbindung gebracht haben könnten. Denn gerade in dem Wort, das Anlass zu ihrer Frage gab, hatte Christus einen unbestimmten Zeitraum zwischen die beiden Ereignisse gelegt. Zwischen der Verwüstung des Hauses und ihrer neuen Aufnahme bei ihm würde eine unbestimmte Zeitspanne liegen, in der sie ihn nicht wiedersehen würden. Die Jünger konnten dies nicht übersehen, und daher war weder ihre Frage noch die Rede unseres Herrn darauf ausgerichtet, die beiden miteinander zu verbinden. Es ist notwendig, dies im Auge zu behalten, wenn man die Worte Christi studiert; und jeder andere Eindruck muss auf die extreme Komprimierung in der Sprache des Matthäus zurückzuführen sein, und darauf, dass Christus die Zeitspanne zwischen „der Verwüstung des Hauses“ und seiner eigenen Wiederkunft absichtlich unbestimmt lassen würde.
Es bleibt noch ein weiterer Punkt von großer Bedeutung zu beachten. Als der Herr beim Verlassen des Tempels sagte: „Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen“, muss er sich auf Israel in seiner nationalen Eigenschaft bezogen haben – auf das jüdische Gemeinwesen in Kirche und Staat. Wenn dem so ist, muss die Verheißung des sichtbaren Wiedererscheinens im Text auch für das jüdische Gemeinwesen gelten, für Israel in seiner nationalen Eigenschaft. Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass sich Christus in diesem Abschnitt auf seinen Advent bezieht, und zwar nicht aus der allgemeinen kosmischen Sicht der universalen, sondern aus der jüdischen Sicht der jüdischen Geschichte, in der die Zerstörung Jerusalems und das Auftreten falscher Christusse die letzten Ereignisse der nationalen Geschichte sind, auf die die trostlose Leere und Stille der vielen Jahrhunderte der „heidnischen Dispensation“ folgt, die schließlich von den Ereignissen durchbrochen wird, die sein Kommen einleiten.
Wenn man also bedenkt, dass die Jünger die Verwüstung des Tempels nicht mit der unmittelbaren Ankunft Christi in seinem Reich und dem Ende der Welt in Verbindung bringen konnten, war ihre Frage an Christus eine doppelte: Wann werden diese Dinge geschehen? und: Was werden die Zeichen seiner königlichen Ankunft und der Vollendung des „Zeitalters“ sein? Zu ersterem gab der Herr keine Auskunft; auf letzteres war seine Rede am Ölberg gerichtet. In einem Punkt war die Aussage des Herrn so neuartig, dass ihre Frage fast berechtigt war. In den jüdischen Schriften ist sehr häufig von den sogenannten „Leiden des Messias“ die Rede (Chebhley shel Mashiachb ). Dabei handelt es sich zum Teil um die des Messias, zum Teil – vielleicht sogar hauptsächlich – um die, die Israel und die Welt vor dem Kommen des Messias treffen und mit diesem verbunden sind. Es hat keinen Sinn, sie im Einzelnen zu beschreiben, da die erwähnten Einzelheiten so unterschiedlich und die Beschreibungen so phantasievoll sind. Im Allgemeinen kann man sie jedoch als eine Zeit der inneren Verderbnis und der äußeren Not, insbesondere der Hungersnot und des Krieges, charakterisieren, deren Schauplatz das Land Palästina sein sollte und deren Hauptleidtragende Israel sein sollte. a Da die rabbinischen Notizen, die wir besitzen, alle aus der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems stammen, ist es natürlich unmöglich, in diesem Punkt eine absolute Aussage zu machen; aber in der Tat bezieht sich keine von ihnen auf die Verwüstung der Stadt und des Tempels als eines der „Zeichen“ oder „Leiden“ des Messias. Es ist wahr, dass vereinzelte Stimmen dieses Schicksal des Heiligtums verkündeten, aber nicht in Verbindung mit dem triumphalen Advent des Messias; und wenn wir nach den Hoffnungen urteilen, die die Fanatiker während der letzten Belagerung Jerusalems hegten, so erwarteten sie vielmehr ein göttliches, zweifellos messianisches Eingreifen zur Rettung der Stadt und des Tempels, selbst im letzten Augenblick. b Wenn Christus also die Verwüstung „des Hauses“ verkündete und sie sogar in indirektem Zusammenhang mit seinem Advent brachte, lehrte er etwas, das ebenso neu wie unerwartet gewesen sein muss.
Dies ist vielleicht der geeignetste Ort, um die jüdische Erwartung im Zusammenhang mit der Ankunft des Messias zu erläutern. Hier müssen wir zunächst die rabbinische Fiktion von zwei Messiassen als aus späterer Zeit stammend verwerfen: der eine, der primäre und regierende, der Sohn Davids; der andere, der sekundäre und kriegerische Messias, der Sohn Ephraims oder Manasses. Die früheste talmudische Erwähnung dieses zweiten Messiasc stammt aus dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung und enthält die merkwürdigen und fast blasphemischen Hinweise, dass die Prophezeiung des Sacharja über die Trauer um den, den sie durchbohrt hatten, sich auf den Messias, den Sohn Josephs, bezog, der im Krieg von Gog und Magog getötet werden würde; und dass der Messias, der Sohn Davids, als er das sah, Gott „um Leben bat“, der es ihm gab, wie es in Ps. 2 geschrieben steht: „Bitte mich, so will ich dir geben“, woraufhin Gott dem Messias mitteilte, dass sein Vater David bereits darum gebeten und es für ihn erlangt hatte, wie es in Ps. 21,4 heißt. Im Allgemeinen wird der Messias, der Sohn Josephs, mit der Sammlung und Wiederherstellung der zehn Stämme in Verbindung gebracht. Spätere rabbinische Schriften verbinden alle Leiden des Messias für die Sünde mit diesem Sohn Josefs. Der Krieg, in dem „der Sohn Josefs“ unterlag, würde schließlich durch „den Sohn Davids“ zu einem siegreichen Ende gebracht werden, wenn die Vorherrschaft Israels wiederhergestellt sein und alle Völker in seinem Licht wandeln würden.
Es ist kaum verwunderlich, dass die verschiedenen Hinweise auf den Messias, den Sohn Josephs, verworren und manchmal widersprüchlich sind, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen dieses Dogma entstanden ist. Sein Hauptgrund war zweifellos die Kontroverse. Wenn man durch christliche Argumente zu den alttestamentlichen Prophezeiungen über die Leiden des Messias kaum unter Druck gesetzt wurde, bot die Fiktion über den Sohn Josephs im Unterschied zum Sohn Davids ein willkommenes Mittel zur Flucht. Als im jüdischen Aufstand unter dem falschen Messias „Bar-Kokhba“ („Sohn des Sterns“) dieser den Römern unterlag und getötet wurde, hielt es die Synagoge für notwendig, die im Blut erloschene Hoffnung Israels durch das Bild zweier Messiasse neu zu entfachen, von denen der erste im Krieg fallen sollte, während der zweite, der Sohn Davids, den Kampf zu einem triumphalen Ende führen würde.
Generell muss hier daran erinnert werden, dass in den jüdischen Schriften zwischen drei Begriffen unterschieden wird, um das zu bezeichnen, was auf die „gegenwärtige Dispensation“ oder „Welt“ (Olam hazzeh) folgen soll, auch wenn die Unterscheidung nicht immer konsequent durchgeführt wird. Diese glückliche Zeit würde mit den „Tagen des Messias“ (ימוח המשיח) beginnen. Diese würden sich bis in das „kommende Zeitalter“ (Athid labho) erstrecken und mit der „kommenden Welt“ (Olam habba) enden – auch wenn letzteres manchmal so verstanden wird, dass es die gesamte Zeitspanne umfasst. Über die Dauer der messianischen Periode gehen die Meinungen weit auseinander. Es scheint eine runde Zahl zu sein, wenn gesagt wird, dass sie drei Generationen dauern würde. c In der ausführlichsten Diskussion zu diesem Thema werden die Meinungen verschiedener Rabbiner erwähnt, die den Zeitraum je nach phantasievollen Analogien auf vierzig, ein-, zwei- oder sogar siebentausend Jahre festlegen.
Wenn Aussagen auf derartigen phantasievollen Überlegungen beruhen, können wir ihnen kaum einen ernsthaften Wert beimessen und auch keine Zustimmung erwarten. Diese Bemerkung gilt auch für die meisten anderen Punkte, um die es geht. Es genügt zu sagen, dass nach allgemeiner Meinung die Geburt des Messias seinen Zeitgenossen unbekannt sein würde; dass er erscheinen, sein Werk vollbringen und dann verschwinden würde – wahrscheinlich für fünfundvierzig Tage -, um dann wieder zu erscheinen und die feindlichen Mächte der Welt zu vernichten, insbesondere „Edom“, „Armilos“, die römische Macht – das vierte und letzte Weltreich (manchmal heißt es: durch Ismael). Das erlöste Israel würde nun auf wundersame Weise von den Enden der Erde gesammelt und in sein eigenes Land zurückgebracht werden, wobei die zehn Stämme an ihrer Wiederherstellung teilhaben würden, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihre früheren Sünden bereuen. 2 Nach dem wird dann das ganze beschnittene Israel aus der Gehenna befreit, und die Toten werden auferweckt – nach Ansicht einiger Autoritäten durch den Messias, dem Gott „den Schlüssel zur Auferstehung der Toten“ geben wird.b Diese Auferstehung wird im Land Israel stattfinden, und die anderswo begrabenen Israeliten müssen sich unter der Erde wälzen – nicht ohne Schmerzenc -, bis sie den heiligen Boden erreichen. Der Grund für diese seltsame Vorstellung, die durch einen Appell an die Weisung Jakobs und Josephs bezüglich ihrer letzten Ruhestätte unterstützt wurde, war wahrscheinlich, die Juden zu veranlassen, Palästina nach der endgültigen Verwüstung ihres Landes nicht zu verlassen. Diese Auferstehung, von der man annimmt, dass sie zu Beginn oder im Verlauf der messianischen Offenbarung stattfindet, würde durch das Blasen der großen Trompete angekündigt werden. 3 Es wäre schwierig zu sagen, wie viele dieser seltsamen und verworrenen Ansichten zur Zeit Christi vorherrschten, welche von ihnen allgemein als echte Dogmen angesehen wurden oder aus welchen Quellen sie ursprünglich stammten. Wahrscheinlich wurden viele von ihnen im Volk verbreitet und später weiterentwickelt – wie wir glauben, mit Elementen, die aus der christlichen Lehre entstellt wurden.
Wir haben nun die Zeit des „kommenden Zeitalters“ (des Athid labho oder sæculum futurum) erreicht. Der gesamte Widerstand gegen Gott wird sich in dem großen Krieg von Gog und Magog konzentrieren, und mit ihm wird sich die Vorherrschaft aller Bosheit verbinden. Und schrecklich wird die Not Israels sein. Dreimal würde der Feind versuchen, die Heilige Stadt zu stürmen. Aber jedes Mal würde der Angriff abgewehrt werden – und zuletzt würde der Feind völlig vernichtet werden. Die heilige Stadt würde nun vollständig wiederaufgebaut und bewohnt werden. Aber oh, wie anders als früher! Ihre Sabbatgrenzen würden mit Perlen und kostbaren Edelsteinen übersät sein. Die Stadt selbst würde auf eine Höhe von etwa neun Meilen angehoben werden – ja, bei realistischer Anwendung von Jes. 49:20 würde sie bis zum Thron Gottes reichen, während sie sich von Joppa bis zu den Toren von Damaskus erstrecken würde! Denn Jerusalem sollte die Wohnstätte Israels und der Zufluchtsort aller Völker sein. Am herrlichsten aber sollte in Jerusalem der neue Tempel sein, den der Messias errichten sollte und in dem jene fünf Dinge wiederhergestellt werden sollten, die im früheren Heiligtum gefehlt hatten: der goldene Leuchter, die Lade, das vom Himmel entzündete Feuer auf dem Altar, der Heilige Geist und die Cherubim. Und das Land Israel würde dann so groß sein wie in der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte und die nie zuvor erfüllt worden war – denn die größte Ausdehnung der Herrschaft Israels hatte sich nur über sieben Nationen erstreckt, während die göttliche Verheißung sie über zehn, wenn nicht über die ganze Erde ausdehnte.
So seltsam realistisch und übertrieben diese Hoffnungen auch klingen mögen, so gibt es doch im Zusammenhang mit ihnen einen Punkt von größtem Interesse, zu dem, wie an anderer Stelle äutert , bemerkenswerte Meinungsverschiedenheiten herrschen. Es geht um die Dienste des wiederaufgebauten Tempels und die Einhaltung des Gesetzes in messianischen Tagen. Eine Partei bestand hier auf der Wiederherstellung aller alten Gottesdienste und der strikten Einhaltung des mosaischen und rabbinischen Gesetzes – ja sogar auf dessen vollständiger Auferlegung für die heidnischen Völker. Aber diese Ansicht muss zumindest durch die Erwartung modifiziert worden sein, dass der Messias ein neues Gesetz geben würde. Aber sollte dieses neue Gesetz nur für die Heiden gelten oder auch für Israel? Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Einige meinen, dieses Gesetz sei für Israel verbindlich, nicht aber für die Heiden, oder aber die Heiden hätten eine veränderte oder verkürzte Reihe von Verordnungen (höchstens dreißig Gebote). Die liberalste und, wie wir annehmen dürfen, für die Erleuchteten annehmbarste Auffassung war jedoch, dass in Zukunft nur diese beiden Festtage beachtet werden würden: Der Versöhnungstag und das Estherfest (oder auch das Laubhüttenfest), und dass von allen Opfern nur die Dankopfer beibehalten werden würden. 1 Nein, die Meinung ging sogar noch weiter, und viele vertraten die Ansicht, dass in den messianischen Tagen die Unterscheidung von rein und unrein, von erlaubt und unerlaubt, was die Nahrung betrifft, abgeschafft werden würde. kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass diese unterschiedlichen Ansichten auch in den Tagen unseres Herrn und in der apostolischen Zeit vertreten wurden, und sie erklären die große Bitterkeit, mit der die extreme pharisäische Partei in der Kirche zu Jerusalem dafür eintrat, dass die heidnischen Bekehrten beschnitten werden müssten und dass ihnen die ganze Last des Jochs des Gesetzes auf den Nacken gelegt werden sollte. Und mit Blick auf dieses neue Gesetz, das Gott seiner Welt durch den Messias geben würde, teilten die Rabbiner die Zeit in drei Abschnitte ein: die Urzeit, die Zeit unter dem Gesetz und die Zeit des Messias.
Es bleibt nur noch, kurz die physische und moralische Seligkeit Israels in jenen Tagen zu beschreiben, den Zustand der Völker und schließlich das Ende dieses „Zeitalters“ und sein Übergehen in die „kommende Welt“ (Olam habba). Moralisch gesehen wird dies eine Zeit der Heiligkeit, der Vergebung und des Friedens sein. Außerhalb gäbe es keine Feinde und Unterdrücker mehr. Und innerhalb der Stadt und des Landes würde ein mehr als paradiesischer Zustand herrschen, der in einer mehr als nur realistischen orientalischen Sprache beschrieben wird. Für dieses riesige neue Jerusalem (nicht im Himmel, sondern im buchstäblichen Palästina) sollten Engel Edelsteine von 45 Fuß Länge und Breite (30 Ellen) schneiden und in seine Tore einsetzen; die Fenster und Tore sollten aus Edelsteinen, die Mauern aus Silber, Gold und Edelsteinen sein, während alle Arten von Juwelen umhergestreut werden sollten, von denen sich jeder Israelit nach Belieben bedienen durfte. Jerusalem würde so groß sein wie ganz Palästina und Palästina wie die ganze Welt. b Dieser wundersamen Ausdehnung würde eine wundersame Erhöhung Jerusalems in die Luft entsprechen. Und es ist eine der seltsamsten Vermischungen von Selbstgerechtigkeit und Realismus mit tieferen und geistigeren Gedanken, wenn die Rabbiner durch Verweise auf die prophetischen Schriften beweisen, dass jedes Ereignis und Wunder in der Geschichte Israels in messianischen Tagen seine Entsprechung oder vielmehr größere Erfüllung finden würde. So würde das, was von Abrahamd aufgezeichnet wurde, aufgrund seines Verdienstes Satz für Satz seine Entsprechung in der Zukunft finden: „Laßt ein wenig Wasser holen“ in dem, was in Sach 14,8 vorausgesagt wird; „Wascht eure Füße“ in dem, was in Jes 4,5 vorausgesagt wird; „Ruht euch unter dem Baum aus“ in dem, was in Jes 4,4 gesagt wird; und „Ich will einen Bissen Brot holen“ in der Verheißung von Ps 72,16.
Aber daneben gibt es auch viel groben Realismus. Das Land würde spontan die besten Kleider und die feinsten Kuchen hervorbringen; der Weizen würde so hoch wie Palmen, ja, wie die Berge wachsen, während der Wind das Korn auf wundersame Weise in Mehl verwandeln und in die Täler werfen würde. Jeder Baum würde Früchte tragen, b ja, sie würden ausbrechen und jeden Tag Früchte tragen; jede Frau sollte täglich Kinder gebären, so dass am Ende jede israelitische Familie so zahlreich sein würde wie ganz Israel zur Zeit des Exodus. d alle Krankheiten und alles, was schaden könnte, würden vergehen. Was den Tod anbelangt, so wurde die Verheißung seiner endgültigen Abschaffung mit charakteristischem Einfallsreichtum auf Israel angewandt, während die Aussage, dass das Kind hundert Jahre alt sterben würdef, so verstanden wurde, dass sie sich auf die Heiden bezog und lehrte, dass sie zwar sterben würden, ihr Alter aber stark verlängert werden würde, so dass ein Hundertjähriger nur noch als Kind angesehen werden würde. Schließlich würden die körperlichen und äußerlichen Verluste, die der Rabbinismus als Folge des Sündenfalls ansah,dem Menschen wiedergegeben werden.
Es wäre ein Leichtes, noch realistischere Zitate als diese zu vervielfältigen, wenn dies überhaupt von Nutzen sein könnte. Dieselbe Wörtlichkeit herrscht auch in Bezug auf die Herrschaft des Königs Messias über die Völker der Welt. Es wird nicht nur die bildhafte Sprache der Propheten auf die äußerste Weise angewandt, sondern es werden auch illustrierende Details desselben Charakters hinzugefügt. Jerusalem würde als Wohnsitz des Messias zur Hauptstadt der Welt werden, und Israel würde an die Stelle der (vierten) Weltmonarchie, des Römischen Reiches, treten. Nach dem Römischen Reich sollte sich kein anderes mehr erheben, denn ihm sollte unmittelbar die Herrschaft des Messias folgen. Aber dieser Tag oder vielmehr der Untergang der (zehn) heidnischen Völker, der das Reich des Messias einleiten würde, gehörte zu den sieben Dingen, die den Menschen unbekannt waren. k Nein, Gott hatte Israel beschworen, den Heiden das Geheimnis der Zeitrechnung nicht mitzuteilen. Aber der Ursprung des bösen Weltreichs war durch Israels Sünde verursacht worden. Es war (im Idealfall) gegründet worden2 , als Salomo einen Bund mit der Tochter des Pharao einging, während Romulus und Remus aufstanden, als Jerobeam die Anbetung der beiden Kälber einführte. So wurde das, was die universale davidische Herrschaft hätte werden sollen, durch die Sünde Israels in die Unterwerfung unter die Heiden verwandelt. Ob diese Heiden in der messianischen Zukunft zu Proselyten werden würden oder nicht, scheint eine strittige Frage zu sein. Manchmal wird es bejaht; a an anderer Stelle heißt es, dass dann keine Proselyten aufgenommen würden,und zwar aus dem guten Grund, dass diese Proselyten im letzten Krieg und Aufstand aus Angst das Joch des Judentums abwerfen und sich den Feinden anschließen würden.
Dieser Krieg, der eine Fortsetzung des Krieges von Gog und Magog zu sein scheint, wird das messianische Zeitalter beenden. Die Völker, die dem Messias bis dahin Tribut gezollt hatten, würden sich gegen ihn auflehnen, und er würde sie durch den Hauch seines Mundes vernichten, so dass Israel allein auf der Erde übrig bliebe. Dauer dieser Zeit des Aufruhrs wird mit sieben Jahren angegeben. Es scheint zumindest zweifelhaft, ob eine zweite oder allgemeine Auferstehung erwartet wurde; wahrscheinlicher ist, dass es nur eine Auferstehung gab, und zwar nur die Israels,d oder jedenfalls nur die der Frommen und Gelehrten,und dass diese zu Beginn der messianischen Herrschaft stattfinden sollte. Wenn die Heiden überhaupt auferstehen würden, dann nur, um sofort wieder zu sterben.
Dann würde das Endgericht beginnen. Wir müssen hier noch einmal einen Unterschied zwischen Israel und den Heiden machen, mit denen einige notorische Sünder, Ketzer und alle Abtrünnigen in eine Reihe gestellt werden, ja, die sogar noch mehr bestraft werden als sie. Während sich für Israel die Gehenna, in die alle außer den vollkommen Gerechten nach dem Tod eingewiesen wurden, als eine Art Fegefeuer erwies, aus dem sie schließlich alle durch Abraham,oder, nach einigen der späteren Midraschim, durch den Messias befreit wurden, war eine solche Befreiung weder für die Heiden noch für die Sünder Israels in Aussicht. h Die Frage, ob die erlittenen feurigen Qualen (die sehr realistisch beschrieben werden) am Ende mit der Vernichtung enden würden, wurde zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet, wie an anderer Stelle ausführlich erläutert wird. Zur Zeit Christi wurde die Bestrafung der Bösen sicherlich als von ewiger Dauer angesehen. Rabbi José, ein Lehrer des zweiten Jahrhunderts und Vertreter der eher rationalistischen Schule, sagt ausdrücklich: „Das Feuer von Gehinnom ist nie erloschen.i Und selbst die so oft (wenn auch nur teilweise) zitierte Passage, dass die letzten Qualen der Gehenna zwölf Monate dauern würden, nach denen Körper und Seele vernichtet würden, schließt eine Reihe von jüdischen Sündern aus, die besonders erwähnt werden, wie Ketzer, Epikureer, Abtrünnige und Verfolger, die als „Kinder der Gehenna“ (ledorey doroth, zu „Zeitaltern der Zeitalter“) bezeichnet werden. Und damit stimmen auch andere Aussagen überein,b so dass daraus allenfalls folgt, dass auf die weniger Schuldigen die Vernichtung wartet, während die besonders Schuldigen der ewigen Strafe vorbehalten sind.
Das war also das Endgericht, das im Tal Joschafat von Gott an der Spitze des himmlischen Sanhedrins, bestehend aus den Ältesten Israels, abgehalten wurde. So realistisch die Schilderung auch sein mag, so sehr wird sie doch von einer Passage übertroffen, in der die angeblichen Bitten der verschiedenen Völker um Gnade angeführt und widerlegt werden, wenn nach einem ungebührlichen Streit zwischen Gott und den Heiden – der ebenso schockierend für den guten Geschmack und blasphemisch ist – über die Israel erwiesene Parteilichkeit die Heiden zur Strafe verurteilt werden. All dies in einer Art und Weise, die jedes ehrfürchtige Gefühl abstößt. Und der Kontrast zwischen dem jüdischen Bild des Jüngsten Gerichts und dem in den Evangelien skizzierten ist so auffallend, dass er allein die eschatologischen Teile des Neuen Testaments rechtfertigt (wenn dies notwendig wäre) und beweist, welch unendlicher Abstand zwischen der Lehre Christi und der Theologie der Synagoge besteht.
Nach dem Endgericht müssen wir auf die Erneuerung von Himmel und Erde warten. In letzterer wird weder physische noch moralische Finsternis mehr herrschen, da der Yetser haRa, der „böse Trieb“, vernichtet sein wird. Und die erneuerte Erde wird alles ohne Makel und in paradiesischer Vollkommenheit hervorbringen, während sowohl das physische als auch das moralische Böse aufgehört hat. Dann begann die „Olam habba“, die „kommende Welt“. Die Frage, ob irgendwelche Funktionen oder Genüsse des Körpers fortbestehen würden, wird unterschiedlich beantwortet. Die Antwort des Herrn auf die Frage der Sadduzäer nach der Ehe im Jenseits scheint darauf hinzudeuten, dass zu dieser Zeit materialistische Ansichten zu diesem Thema vertreten wurden. Viele rabbinische Passagen, etwa über das große Festmahl, das den Gerechten in der Endzeit über Leviathan und Behemoth bereitet wird,bestätigen nur zu schmerzlich den Eindruck grob materialistischer Erwartungen. Andererseits lassen sich Passagen anführen, in denen der völlig immaterielle Charakter der „kommenden Welt“ mit größtem Nachdruck betont wird. In Wahrheit bestehen hier die gleichen grundlegenden Divergenzen wie in anderen Punkten, wie dem Aufenthaltsort der Seligen, der sichtbaren oder unsichtbaren Herrlichkeit, die sie genießen werden, und sogar dem neuen Jerusalem. Und bei letzterem1 wie auch bei all den Hinweisen auf die Seligpreisungen der kommenden Welt scheint es zumindest zweifelhaft, ob die Rabbiner nicht eher die messianischen Tage als die endgültige Vollendung aller Dinge beschreiben wollten.
Um diese Skizze der jüdischen Meinungen zu vervollständigen, ist es notwendig, wenn auch nur kurz, auf die pseudepigraphischen hinzuweisen, die, wie wir uns erinnern werden, die apokalyptischen Erwartungen der Juden vor der Zeit Christi zum Ausdruck brachten. Dabei müssen wir jedoch immer die doppelte Schwierigkeit im Auge behalten, dass die in diesen Werken verwendete Sprache einen sehr bildhaften Charakter hat und daher nicht wörtlich genommen werden darf, und dass mehr als eines von ihnen, insbesondere 4 Esdras, aus nachchristlicher Zeit stammt und in wichtigen Punkten zugegebenermaßen von der christlichen Lehre beeinflusst wurde. Aber im Großen und Ganzen ist das Bild der messianischen Zeit in diesen Schriften dasselbe wie das der Rabbiner. Die pseudepigraphische Sichtweise lässt sich kurz so skizzieren. 3 Von den sogenannten „Kriegen des Messias“ gab es bereits eine Art Vorahnung in den Tagen des Antiochus Epiphanes, als bewaffnete Soldaten gesehen wurden, die in der Luft Krieg führten. Dieses Zeichen wird in den Sibyllinischen Büchernc als Zeichen für das kommende Ende erwähnt, zusammen mit dem Anblick von Schwertern am nächtlichen Sternenhimmel, dem Herabfallen von Staub vom Himmel, dem Erlöschen des Sonnenlichts und dem Erscheinen des Mondes am Tag sowie dem Herabfallen von Blut von den Felsen. Ein ähnliches, wenn auch noch realistischeres Bild wird im Zusammenhang mit dem Stoß der dritten Posaune in 4. (2.) Esdras dargestellt. d Nur dass dort das Element des moralischen Gerichts deutlicher eingeführt wird. Noch deutlicher erscheint dies in einer anderen Stelle desselben Buches,in der, offenbar im Zusammenhang mit dem Gericht, der Einfluss der christlichen Lehre, wenn auch in veräußerlichter Form, deutlich nachgezeichnet werden kann. Eine vielleicht noch detailliertere Beschreibung der Bosheit, der Bedrängnis und der physischen Verwüstung auf der Erde zu jener Zeit findet sich im Buch der Jubiläen.
Endlich, wenn diese Bedrängnisse ihren endgültigen Höhepunkt erreicht haben, wenn Zeichen am Himmel und Verderben auf der Erde zu sehen sind und die unbegrabenen Leichen, die den Boden bedecken, von Vögeln und wilden Tieren gefressen oder von der Erde verschlungen werden,würde Gott „den König“ senden, der der Ungerechtigkeit ein Ende setzen würde. Dann würde der letzte Krieg gegen Jerusalem folgen, in dem Gott vom Himmel aus mit den Völkern kämpfen würde, wenn sie sich Ihm unterwerfen und Ihn anerkennen würden. c Aber während im Buch Henoch und in einem anderen Werk derselben Klassed das Gericht Gott zugeschrieben wird und der Messias als erst danach erscheinend dargestellt wird,1 wird in den meisten dieser Werke das Gericht oder seine Ausführung dem Messias zugeschrieben.
In dem so wiederhergestellten Land Israels und unter der Herrschaft des Messiaskönigs würde das neue, von den Heiden gereinigte Jerusalem die Hauptstadt sein, vergrößert, ja ganz verwandelt. Dieses Jerusalem war Adam vor seinem Sündenfall gezeigt worden,2 aber danach war es ihm ebenso wie das Paradies entzogen worden. Es wurde Abraham,Mose und Esra gezeigt. i Die Pracht dieses neuen Jerusalems wird in glühenden Worten beschrieben. 3 Der Messias würde in dem auf diese Weise errichteten herrlichen Königreich König sein,4 allerdings unter der Oberhoheit Gottes. Seine Herrschaft würde sich über die heidnischen Völker erstrecken. Der Charakter ihrer Unterwerfung wurde je nach dem mehr oder weniger jüdischen Standpunkt der Verfasser unterschiedlich gesehen. So wird im Buch der Jubiläen den Nachkommen Jakobs der Besitz der ganzen Erde versprochen; sie würden „über alle Völker herrschen, wie es ihnen gefällt, und danach die ganze Erde an sich ziehen und sie für immer erben“. In der „Himmelfahrt des Mose „scheint dieser Aufstieg Israels mit der Idee der Rache an Rom verbunden zu sein,5 obwohl die verwendete Sprache sehr bildhaft ist. in den Sibyllinischen Büchernq dargestellt, wie sich die Völker angesichts der Segnungen Israels selbst zur Anerkennung Gottes bekehren, wenn unter der (wörtlichen oder bildlichen) Herrschaft und dem Richteramt der Propheten vollkommene geistige Erleuchtung und absolute Rechtschaffenheit sowie körperliches Wohlergehen herrschen werden. a Die „griechischste“ Sicht des Königreichs ist natürlich die von Philo geäußerte. Er geht davon aus, dass der glückliche moralische Zustand des Menschen schließlich auch die wilden Tiere beeinflussen wird, die, nachdem sie ihre einsamen Gewohnheiten aufgegeben haben, zunächst gesellig werden und dann, indem sie die Haustiere nachahmen, allmählich den Menschen als ihren Herrn respektieren, ja, so anhänglich und fröhlich werden wie „Malteserhunde“. Unter den Menschen würden die Frommen und Tugendhaften die Herrschaft ausüben, wobei ihre Würde Respekt, ihr Schrecken Furcht und ihre Wohltätigkeit Wohlwollen hervorrufen würde. Zwischen dieser extremen griechischen und der jüdischen Vorstellung vom Millennium liegen wahrscheinlich solche Äußerungen, die die allgemeine Anerkennung des Messias auf die Erkenntnis zurückführen, dass Gott ihn mit Herrlichkeit und Macht ausgestattet hat und dass seine Herrschaft die des Segens ist.
Die Unterschiede zwischen der apokalyptischen Lehre der Pseudepigraphen und der des Neuen Testaments sind ebenso deutlich wie die zwischen letzterer und der der Rabbiner. Eine weitere Abweichung besteht darin, dass die Pseudepigraphen die messianische Herrschaft einheitlich als ewig darstellen, die durch keinen weiteren Abfall oder Aufstand unterbrochen wird. Dann wird die Erde erneuert,d und darauf folgt schließlich die Auferstehung. In der Apokalypse des Baruch,e wie auch bei den Rabbinern, wird dargelegt, dass die Menschen in genau demselben Zustand auferstehen werden, den sie zu Lebzeiten getragen haben, so dass die Realität der Auferstehung dadurch bestätigt wird, dass sie erkannt werden, während bei der Wiedervereinigung von Körper und Seele jeder die ihm gebührende Strafe für die Sünden erhält, die er in seinem Zustand der Vereinigung auf Erden begangen hat. Aber danach würde eine Verwandlung stattfinden: der Gerechten in den engelhaften Glanz ihrer Herrlichkeit, während die Bösen angesichts dessen entsprechend verblassen würden. g Josephus gibt an, dass die Pharisäer nur eine Auferstehung der Gerechten lehrten. Da wir wissen, dass dies nicht der Fall war, müssen wir dies als eine der vielen Behauptungen betrachten, die dieser Schriftsteller zu seinen eigenen Zwecken aufstellte – wahrscheinlich, um Außenstehenden die pharisäische Lehre in dem attraktivsten und rationalsten Licht zu präsentieren, dessen sie fähig war. In ähnlicher Weise widerspricht die moderne Behauptung, dass einige der pseudepigraphischen Schriften dieselbe Auffassung von einer Auferstehung nur der vertreten, dem Beweis. 2 Es steht außer Frage, dass nach den Pseudepigraphen im allgemeinen Gericht, das auf die allgemeine Auferstehung folgen sollte, die zugewiesene Belohnung und Bestrafung als von ewiger Dauer dargestellt werden, obwohl es, wie bei der rabbinischen Lehre, fraglich sein mag, wer von den Sündern die endgültige und endlose Qual erleiden würde.
Die zahlreichen und hartnäckigen Versuche, die Lehre Christi über die „letzten Dinge“ trotz der damit verbundenen groben Ungereimtheiten lediglich als Widerspiegelung der zeitgenössischen jüdischen Meinung darzustellen, haben einen detaillierten Nachweis erforderlich gemacht. Wenn wir uns mit den soeben zusammengefassten Informationen erneut den Fragen zuwenden, die die Jünger an ihn richteten, erinnern wir uns daran, dass sie (wie zuvor gezeigt) das „Wann“ dieser „Dinge“ – d. h. der Zerstörung Jerusalems und des Tempels – nicht mit dem „Wann“ seiner Wiederkunft und des Endes des „Zeitalters“ in Verbindung bringen oder vielmehr verwechseln konnten. Wir erinnern uns auch an die Vermutung, dass Christus sich auf seinen Advent wie auf sein Verschwinden vom jüdischen Standpunkt der jüdischen und nicht vom allgemeinen kosmischen Standpunkt der universalen Geschichte aus bezog.
Was die Antwort des Herrn auf die beiden Fragen seiner Jünger anbelangt, so kann man sagen, dass der erste Teil seiner Redea dazu dient, Informationen über die beiden zukünftigen Tatsachen zu liefern: die Zerstörung des Tempels und seine Wiederkunft und das Ende des „Zeitalters“, indem er ihnen die Zeichen vor Augen stellt, die das Nahen oder den Beginn dieser Ereignisse anzeigen. Aber auch hier wird die genaue Zeitspanne nicht definiert, und die gegebene Lehre ist für rein praktische Zwecke bestimmt. Im zweiten Teil seiner Redeb sagt ihnen der Herr deutlich, was sie nicht wissen sollen und warum; und wie alles, was ihnen mitgeteilt wurde, nur dazu diente, sie auf jene ständige Wachsamkeit vorzubereiten, die für die Kirche zu allen Zeiten das richtige Ergebnis der Lehre Christi über dieses Thema war. Daran können wir uns also bei unserer Untersuchung orientieren: dass die Worte Christi nichts enthalten, was über das hinausgeht, was zur Warnung und Belehrung der Jünger und der Kirche notwendig war.
Der erste Teil der Rede Christia besteht aus vier Abschnitten,von denen der erste den „Anfang der Geburtswehen „c des neuen „Zeitalters“ beschreibt, das bald erscheinen wird. Der Ausdruck: „Das Ende ist noch nicht „d weist eindeutig darauf hin, dass es sich nur um die früheste Periode des Anfangs – den äußersten Terminus a quo der „Geburtswehen“ – handelt.Eine weitere allgemeine Überlegung, die von Bedeutung zu sein scheint, ist, dass die synoptischen Evangelien diesen Teil der Rede des Herrn in fast identischer Sprache berichten. Daraus lässt sich zwar schließen, dass ihre Berichte aus einer gemeinsamen Quelle stammen – etwa dem Bericht des Petrus -, doch vermittelt diese enge und gleichbleibende Wiederholung auch den Eindruck, dass die Evangelisten selbst die Bedeutung dessen, was sie aufzeichneten, nicht ganz verstanden haben. Dies mag der Grund für die schnellen und unzusammenhängenden Übergänge von Thema zu Thema sein. Zugleich erlegt es uns die Pflicht auf, die Sprache neu und ohne Rücksicht auf ein Auslegungsschema zu studieren. Nur soviel sei gesagt: Die offensichtlichen Schwierigkeiten der negativen Kritik sind hier gleich groß, ob wir annehmen, dass die Erzählungen vor oder nach der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurden.
Der rein praktische Charakter der Rede geht aus den einleitenden Worten hervor. Sie enthalten eine Warnung, die an die Jünger in ihrer individuellen, nicht in ihrer gemeinschaftlichen Eigenschaft gerichtet ist, davor, „in die Irre geführt zu werden“. Dies vor allem im Hinblick auf die jüdischen Verführungen, die sie zu falschen Christusse führen. Obwohl in der Vielzahl der Hochstapler, die in den unruhigen Zeiten zwischen der Herrschaft des Pilatus und der Zerstörung Jerusalems die messianische Befreiung Israels versprachen, nur wenige Namen und Behauptungen dieser Art speziell aufgezeichnet wurden, deuten die Andeutungen im Neuen Testament,f und die Hinweise des jüdischen Geschichtsschreibers,wenn auch zurückhaltend, auf das Auftreten vieler solcher Verführer hin. Und ihr Einfluss, nicht nur auf die Juden, sondern auch auf die Judenchristen, könnte umso gefährlicher sein, als die letzteren die „Wehe“, die der Anlass für ihre Behauptungen war, natürlich als die Gerichte ansehen würden, die die Ankunft ihres Herrn einleiten würden. Vor einer solchen Verführung müssen sie sich besonders in Acht nehmen. So weit zu den „Dingen“, die mit der Zerstörung Jerusalems und dem Umsturz des jüdischen Gemeinwesens zusammenhängen. Aber in einem größeren und kosmischen Zusammenhang könnten sie auch durch Gerüchte von Kriegen in der Ferne oder durch tatsächliche Kriege zu der Annahme verleitet werden, dass die Auflösung des Römischen Reiches und damit die Ankunft Christi unmittelbar bevorstehe. Auch dies wäre ein Irrtum, der sie schwer in die Irre führt und vor dem sie sich hüten müssen.
Obwohl sie sich in erster Linie auf sie beziehen, dürfen doch sowohl die spezifisch jüdischen, vielleicht sogar christlichen, als auch die allgemeinen kosmischen Quellen des Irrtums über den nahen Advent Christi nicht auf die Zeit der Apostel beschränkt werden. Sie verweisen vielmehr auf die beiden Ursachen des Irrtums, die zu allen Zeiten die Christen zu einer falschen Erwartung der unmittelbaren Wiederkunft Christi verleitet haben: die Verlockungen falscher Messiasse oder vielleicht auch Lehrer und die gewaltsamen Unruhen in der politischen Welt. Was Israel betrifft, so erreichten diese ihren Höhepunkt in der großen Rebellion gegen Rom unter dem falschen Messias Bar Kokhba zur Zeit Hadrians,obwohl Echos ähnlicher falscher Behauptungen oder Hoffnungen darauf Israel während der Nacht dieser vielen Jahrhunderte immer wieder zu einem kurzen, erschrockenen Erwachen gebracht haben. Und was die allgemeineren kosmischen Zeichen anbelangt, haben die Christen in den frühen Zeiten nicht nur die Kriege an den Grenzen des Reiches, sondern auch den Zustand des Staates im Zeitalter Neros, die Aufstände, Unruhen und Drohungen beobachtet; und so weiter, die der späteren Generationen, sogar bis hin zu den Unruhen unserer eigenen Zeit, als ob sie die unmittelbare Ankunft Christi ankündigten, anstatt in ihnen nur den Beginn der Geburtswehen des neuen „Zeitalters“ zu markieren?
Nach der Warnung an die Christen als Einzelpersonen wendet sich der Herr als Nächstes der Ermahnung an die Kirche in ihrer Eigenschaft als Körperschaft zu. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die nun beschriebenen Ereignissec nicht so zu verstehen sind, dass sie mit strenger chronologischer Genauigkeit auf die in den vorhergehenden Versen erwähnten Ereignisse folgen. Vielmehr soll damit ein allgemeiner Zusammenhang mit ihnen angedeutet werden, so dass diese Ereignisse teils vor, teils während und teils nach den früher vorhergesagten Ereignissen beginnen. Sie bilden in der Tat die Fortsetzung der „Geburtswehen“. Dies geht sogar aus der verwendeten Sprache hervor. Während Matthäus schreibt: „Dann“ (τότε, zu jener Zeit) „werden sie euch überliefern“, setzt Lukas die Verfolgungen „vor all diese Dinge“während Markus, der diesen Teil der Rede am ausführlichsten wiedergibt, jede Zeitangabe auslässt und nur die Ermahnung hervorhebt, die diese Tatsache mit sich bringt. b Was die Ermahnung selbst betrifft, die in diesem Teil der Rede des Herrn zum Ausdruck kommt,so stellen wir fest, dass, wie früher für die einzelnen Menschen, so jetzt für die Kirche zwei Gefahrenquellen aufgezeigt werden: die innere, durch Häresien („falsche Propheten“) und den Verfall des Glaubens,und die äußere, durch Verfolgungen, sei es aus dem Judentum und von ihren eigenen Verwandten, sei es von den weltlichen Mächten in der ganzen Welt. Neben diesen beiden Gefahren werden aber auch zwei tröstliche Tatsachen hervorgehoben. Was die zu erwartenden Verfolgungen betrifft, so ist den Christen – sowohl den einzelnen als auch der Kirche – die volle göttliche Hilfe zugesagt. So können alle Sorgen und Ängste abgetan werden; weder wird ihr Zeugnis zum Schweigen gebracht, noch wird die Kirche unterdrückt oder ausgelöscht werden; sondern innere Freude, äußeres Ausharren und endgültiger Triumph werden durch die Gegenwart des auferstandenen Erlösers und die spürbare Innewohnung des Heiligen Geistes in seiner Kirche gesichert. Und was die andere und ebenso tröstliche Tatsache betrifft: Trotz der Verfolgung von Juden und Heiden wird, bevor das Ende kommt, „dies Evangelium vom Reich Gottes auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden zum Zeugnis für alle Völker. Dies ist also wirklich das einzige Zeichen des „Endes“ des gegenwärtigen „Zeitalters“.
Von diesen allgemeinen Voraussagen geht der Herr im dritten Teil dieser Rede aus,um die Jünger auf die große historische Tatsache hinzuweisen, die unmittelbar vor ihnen liegt, und auf die Gefahren, die sich daraus ergeben könnten. In der Tat haben wir hier seine Antwort auf ihre Frage: „Wann werden diese Dinge sein? „g, zwar nicht in Bezug auf das Wann, aber auf das Was davon. Und damit verbindet er die gegenwärtige Anwendung seiner allgemeinen Warnung vor falschen Christusse, die er im ersten Teil dieser Rede gegeben hat. Die Tatsache, auf die er sie nun in diesem dritten Teil seiner Rede hinweist, ist die Zerstörung Jerusalems. Sie birgt zwei Gefahren in sich: äußerlich die Schwierigkeiten und Gefahren, die zu dieser Zeit notwendigerweise auf die Menschen und besonders auf die Glieder der jungen Kirche zukommen würden, und in religiöser Hinsicht die Anmaßungen und Behauptungen falscher Christusse oder Propheten in einer Zeit, in der alles jüdische Denken und Erwarten die Menschen dazu bringen würde, die nahe Ankunft des Messias zu erwarten. Es steht außer Frage, dass die Warnung des Herrn die Kirche vor diesen beiden Gefahren bewahrte. Wie von ihm angewiesen, flohen die Glieder der christlichen Kirche zu einem frühen Zeitpunkt der Belagerung1 Jerusalems nach Pella, während die Worte, in denen er gesagt hatte, dass sein Kommen nicht im Verborgenen, sondern mit der Helligkeit jenes Blitzes, der über den Himmel schoss, erfolgen würde, nicht nur ihre Täuschung verhinderten, sondern vielleicht sogar die Aufzeichnung, wenn nicht sogar den Aufstieg vieler, die sie sonst getäuscht hätten. Was Jerusalem betrifft, so würde die prophetische Vision, die sich ursprünglich in den Tagen des Antiochusa erfüllt hatte, erneut und nun vollständig Wirklichkeit werden, und der Greuel der Verwüstung1 würde an heiliger Stätte stehen. Dies würde zusammen mit einer Drangsal über Israel kommen, die in der schrecklichen Vergangenheit seiner Geschichte beispiellos ist und selbst in seiner blutigen Zukunft ihresgleichen sucht. Ja, die Verfolgung würde so schrecklich sein, dass, wenn nicht die göttliche Barmherzigkeit um der Nachfolger Christi willen eingegriffen hätte, das ganze jüdische Volk, das das Land bewohnte, hinweggefegt worden wäre. b Aber am Morgen jenes Tages würde kein neuer Makkabäer aufstehen, kein Christus kommen, wie Israel inständig hoffte; sondern über diesem Aas würden sich die Geier versammeln; und so durch das ganze Zeitalter der Heiden, bis das bekehrte Israel den Willkommensruf erheben würde: „Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Zeitalter der Heiden, „das Ende des Zeitalters“, und damit die neue Zugehörigkeit seines nun reumütigen Volkes Israel; „das Zeichen des Menschensohnes am Himmel“, das von ihnen wahrgenommen wird; die Bekehrung der ganzen Welt, die Ankunft Christi, die letzte Posaune, die Auferstehung der Toten – das ist, in schnellster Skizze, der Umriss, den der Herr von seinem Kommen und dem Ende der Welt zeichnet.
Es sei daran erinnert, dass dies die zweite Frage der Jünger war. Wir erinnern noch einmal daran, dass die Jünger die Zerstörung Jerusalems und seine Wiederkunft nicht als unmittelbar aufeinanderfolgende Ereignisse miteinander in Verbindung brachten, ja nicht einmal in Verbindung bringen konnten, da er ausdrücklich die – scheinbar lange – Zeit seiner Abwesenheit dazwischen gelegt hatte,f mit den vielen Ereignissen, die sich in dieser Zeit ereignen sollten – vor allem die Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen bewohnten Erde. Bis dahin hatte der Herr in seiner Rede nur auf die Ereignisse eingegangen, die sich erfüllen würden, bevor diese Generation vergehen würde. Er hatte zur Ermahnung und Warnung gesprochen, nicht zur Befriedigung der Neugierde. Es war eine Vorhersage der unmittelbaren Zukunft zu praktischen Zwecken, mit einem so schwachen und allgemeinen Hinweis auf die fernere Zukunft der Kirche, wie es unbedingt notwendig war, um ihre Stellung in der Welt als eine der Verfolgung zu kennzeichnen, jedoch mit der Verheißung seiner Gegenwart und Hilfe; mit einem Hinweis auch auf ihr Werk in der Welt, bis zu seinem terminus ad quem – der Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes an alle Nationen auf Erden.
Mehr hätte man über die Zukunft der Kirche nicht sagen können, ohne den eigentlichen Zweck der Ermahnung und Warnung zu verfehlen, die Christus bei der Beantwortung der Frage der Jünger ausschließlich im Auge hatte. Daher beschreibt das, was in Ver. 29 nicht die Geschichte der Kirche – und schon gar nicht irgendwelche sichtbaren physischen Zeichen am buchstäblichen Himmel -, sondern in prophetischen Bildern die Geschichte der feindlichen Mächte der Welt mit ihren Lehren. Ein ständiges Aufeinanderfolgen von Reichen und Dynastien würde politisch – und es ist nur der politische Aspekt, mit dem wir uns hier befassen – die gesamte Zeit nach dem Aussterben des jüdischen Staates kennzeichnen. Unmittelbar danach würde das Erscheinen des „Zeichens“ des Menschensohns am Himmel für Israel folgen und damit die Bekehrung aller Völker (wie zuvor vorhergesagt), die Wiederkunft Christi,und schließlich der Stoß der letzten Trompete und die Auferstehung.
Nach diesem raschen Ausblick auf die Zukunft wandte sich der Herr erneut an die Jünger, um sie auf die Gegenwart, ja sogar auf alle Zeiten hinzuweisen. Von dem Feigenbaum, unter dem sie an jenem Frühlingsnachmittag auf dem Ölberg geruht haben mögen, sollten sie ein „Gleichnis“ lernen. Wir können uns vorstellen, wie Christus einen seiner Zweige nimmt, gerade als seine weichen Spitzen in junge Blätter ausbrechen. Sicherlich bedeutete dies, dass der Sommer nahte – nicht, dass er tatsächlich gekommen war. Diese Unterscheidung ist wichtig. Denn sie scheint zu beweisen, dass „alle diese Dinge“, die ihnen anzeigen sollten, dass es1 nahe war, sogar an den Türen, und die erfüllt werden sollten, bevor diese Generation vergangen war, sich nicht auf die letzten Zeichen bezogen haben können, die mit dem unmittelbaren Advent Christi verbunden waren,sondern sich auf die vorherige Vorhersage der Zerstörung Jerusalems und des jüdischen Gemeinwesens beziehen müssen. Gleichzeitig geben wir wiederum zu, dass die Sprache der Synoptiker darauf hinzudeuten scheint, dass sie die Worte des Herrn, die sie berichteten, nicht klar verstanden hatten und dass sie in ihrem eigenen Denken die „letzten Zeichen“ und die Ankunft Christi mit dem Fall der Stadt in Verbindung brachten. So mögen sie dazu gekommen sein, diesen gesegneten Advent sogar in ihren eigenen Tagen zu erwarten.
Es ist zumindest fraglich, ob der Herr mit dem deutlichen Hinweis auf diese Tatsachen die Absicht hatte, den Zweifeln und der Ungewissheit über ihre Nachfolge bei seinen Jüngern ein Ende zu bereiten. Das hätte das erfordert, was er im ersten Satz des zweiten Teils dieser Rede ausdrücklich als außerhalb ihrer Kenntnis liegend erklärt hatte. Das „Wann“ – der Tag und die Stunde seines Kommens – sollte den Menschen und den Engeln verborgen bleiben. Nein, sogar der Sohn selbst – wie sie ihn sahen und wie er zu ihnen sprach – wusste es nicht. 1 Es gehörte nicht zu seiner gegenwärtigen messianischen Mission und war auch nicht Gegenstand seiner messianischen Lehre. Wäre dies der Fall gewesen, so wäre die ganze folgende Lehre über die Notwendigkeit ständiger Wachsamkeit und die dringende Pflicht, in Glaube, Hoffnung und Liebe – mit Reinheit, Selbstverleugnung und Ausdauer – für Christus zu arbeiten, verloren gegangen. Die besondere Haltung der Kirche: mit umgürteten Lenden zur Arbeit, da die Zeit kurz war und der Herr jeden Augenblick kommen konnte; mit fleißigen Händen; mit treuem Verstand; mit selbstverleugnender und hingebungsvoller Haltung; mit einem Herzen voller liebevoller Erwartung; mit dem Gesicht zur Sonne gerichtet, die so bald aufgehen sollte; und mit dem Ohr darauf bedacht, die ersten Töne des himmlischen Triumphliedes zu hören – all das wäre verloren gegangen! Was die Kirche in den vielen Jahrhunderten der Trauer gestützt hat, was sie mit Mut zum Kampf, mit Standhaftigkeit zum Ertragen, mit Liebe zur Arbeit, mit Geduld und Freude in Enttäuschungen gestärkt hat – all das wäre verloren gegangen! Die Kirche wäre nicht die des Neuen Testaments, wenn sie das Geheimnis jenes Tages und jener Stunde gekannt und nicht immer auf die unmittelbare Ankunft ihres Herrn und Bräutigams gewartet hätte.
Und was die Kirche des Neuen Testaments war und ist, das hat ihr Herr und Meister aus ihr gemacht, und zwar auf keine wirksamere Weise, als indem er den genauen Zeitpunkt seiner Wiederkunft unbestimmt ließ. Für die Welt würde dies in der Tat zum Anlass für völlige Sorglosigkeit und praktischen Unglauben an das kommende Gericht werden. Wie in den Tagen Noahs die lange Verzögerung des angedrohten Gerichts zur Vertiefung in die gewöhnlichen Verrichtungen des Lebens und zum völligen Unglauben an das, was Noah gepredigt hatte, geführt hatte, so würde es auch in Zukunft sein. Aber jener Tag würde gewiss und unerwartet kommen, zur plötzlichen Trennung derer, die in denselben täglichen Geschäften des Lebens beschäftigt waren, von denen der eine aufgenommen (παραλαμβάνεται, „aufgenommen“), der andere dem Verderben des kommenden Gerichts überlassen werden könnte.
Aber gerade diese Vermischung der Kirche mit der Welt in den gewöhnlichen Beschäftigungen des Lebens wies auf eine große Gefahr hin. Wie in allen solchen Fällen ist das Heilmittel, das der Herr uns vor Augen stellt, nicht negativ, indem wir bestimmte Dinge meiden, sondern positiv. Wir werden am besten Erfolg haben, nicht indem wir aus der Welt gehen, sondern indem wir in ihr wachsam sind und die Tatsache, dass Er unser Herr ist, in unserem Herzen und in unserem Verstand frisch halten, und dass wir immer und in aller Liebe Seine Wiederkunft erwarten und ersehnen sollen. Andernfalls könnten wir doppelten Schaden erleiden. Da wir die Ankunft des Herrn nicht in der Nacht erwarten (die für sein Kommen am unwahrscheinlichsten ist), könnten wir einschlafen, und der Feind könnte dies ausnutzen und uns unseres besonderen Schatzes berauben. b So könnte die Kirche, die ihren Herrn nicht erwartet, so arm werden wie die Welt. Das wäre ein Verlust. Aber es könnte noch schlimmer kommen. Nach der Bestimmung des Meisters hatte jeder während der Abwesenheit Christi sein Werk für ihn zu verrichten, und der Lohn der Gnade oder die Strafe der Vernachlässigung waren in sicherer Aussicht. Der treue Verwalter, dem der Meister die Sorge für seinen Haushalt anvertraut hatte, um seine Diener mit dem zu versorgen, was sie für ihren Unterhalt und ihre Arbeit brauchten, würde, wenn er sich als treu erwies, durch eine Beförderung zu einer weit größeren und verantwortungsvolleren Arbeit belohnt werden. Andererseits würde der Glaube an eine verspätete Wiederkunft des Herrn zur Vernachlässigung des Werkes des Meisters, zu Untreue, Tyrannei, Selbstgefälligkeit und Sünde führen. Und wenn der Herr plötzlich käme, was er mit Sicherheit tun würde, gäbe es nicht nur Verlust, sondern auch Schaden, Verletzung und die Strafe für die Heuchler. Deshalb soll die Kirche immer auf der Hut sein, d soll sie immer bereit sein! Und wie furchtbar die moralischen Folgen der Unbereitschaft und die angedrohte Strafe sind, hat die Geschichte der Kirche in diesen achtzehn Jahrhunderten nur zu oft und zu traurig gezeigt.
(Matthäus 25:1-13; Matthäus 25:14-30; Lukas 19:11-28).
Aldred Edersheim – Das Leben und die Zeiten von Jesus dem Gesalbten
Wie zu erwarten war, stehen die Gleichnisse über die letzten Dinge in engem Zusammenhang mit der Rede über die letzten Dinge, die Christus gerade zu seinen Jüngern gehalten hatte. In der Tat ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das am vielseitigsten zu sein scheint, in seiner Hauptaussage nur eine Veranschaulichung des letzten Teils der Rede Christi. Seine großen praktischen Lehren waren: die Unerwartetheit des Kommens des Herrn; die Folgen, die aus seiner Verspätung zu befürchten sind; und die Notwendigkeit der persönlichen und ständigen Bereitschaft. In ähnlicher Weise kann das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in seinen großen Zügen so zusammengefasst werden: Seid persönlich bereit; seid für jede Zeitspanne bereit; seid bereit, direkt zu Ihm zu gehen.
Bevor wir fortfahren, stellen wir fest, dass auch dieses Gleichnis mit den vorangegangenen in Verbindung steht. Aber wir bemerken nicht nur einen Zusammenhang, sondern eine Entwicklung. In der Tat wäre es sowohl historisch als auch für das bessere Verständnis der Lehre Christi von großem Interesse, vor allem aber, um ihre innere Einheit und Entwicklung sowie die Glaubwürdigkeit der Evangelien zu zeigen, diesen Zusammenhang und Fortschritt nachzuvollziehen. Und dies nicht nur in den drei Reihen von Gleichnissen, die die drei Etappen seiner Geschichte kennzeichnen – die Gleichnisse von der Gründung des Reiches, von seinem Charakter und von seiner Vollendung -, sondern was die Gleichnisse selbst betrifft, so dass die ersten mit den letzten wie eine Kette himmlischer Perlen verbunden werden können. Aber das liegt außerhalb unserer Aufgabe. Nicht so, um den Zusammenhang zwischen dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen und dem Gleichnis von dem Mann ohne Hochzeitsgewand zu erkennen.
Wie das Gleichnis von den zehn Jungfrauen hatte es auf die Zukunft verwiesen. Wenn sich der Ausschluss und die Bestrafung des unvorbereiteten Gastes nicht primär auf den Jüngsten Tag oder die Wiederkunft Christi bezog, sondern vielleicht eher auf das, was im Tod geschehen würde, so wies es doch zumindest sekundär auf die endgültige Vollendung hin. Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen hingegen steht diese Vollendung im Vordergrund. Insofern gibt es also sowohl eine Verbindung als auch einen Vorlauf. Wiederum haben wir aus dem Auftreten und dem Schicksal des unvorbereiteten Gastes gelernt, dass nicht jeder, der dem Ruf des Evangeliums folgt und zum Evangeliumsmahl kommt, daran teilhaben darf, sondern dass Gott jeden einzelnen suchen und prüfen wird. Es gibt in der Tat eine Gesellschaft von Gästen – die Kirche; aber wir dürfen weder erwarten, dass die Kirche, während sie auf Erden ist, völlig rein sein wird, noch dass ihre Reinigung durch den Menschen erreicht werden wird. Jeder Gast kann zwar in den Festsaal kommen, aber das endgültige Urteil über seine Würdigkeit liegt bei Gott. Schließlich lehrt das Gleichnis auch die nicht weniger wichtige gegenteilige Lektion, dass jeder Einzelne persönlich verantwortlich ist; dass wir uns nicht in die Gemeinschaft der Kirche zurückziehen können, sondern dass die Teilnahme am Festmahl eine persönliche und individuelle Vorbereitung erfordert. Um es in moderner Terminologie auszudrücken: Es lehrte den Kirchentum gegen den einseitigen Individualismus und den geistigen Individualismus gegen den toten Kirchentum. All diese wichtigen Lehren werden im Gleichnis von den zehn Jungfrauen weitergeführt. Wenn der Zusammenschluss der zehn Jungfrauen zum Zweck der Begegnung mit dem Bräutigam und ihr apriorischer Anspruch, mit ihm einzutreten – die sozusagen die historischen Daten und notwendigen Voraussetzungen im Gleichnis sind – auf die Kirche hinweisen, so sind die Hauptlektionen des Gleichnisses die Notwendigkeit individueller, persönlicher und geistiger Vorbereitung. Nur solche werden die Prüfung der langen Verzögerung des Kommens Christi ertragen; nur solche werden die Prüfung der unmittelbaren Ladung zur Begegnung mit Christus bestehen.
Es ist spät am Abend – der lange Tag der Welt scheint vorüber, und die Ankunft des Bräutigams muss nahe sein. Den Tag und die Stunde kennen wir nicht, denn der Bräutigam ist weit weg gewesen. Wir wissen nur, dass es der Abend der Hochzeit ist, den der Bräutigam festgesetzt hat, und dass man sich auf sein Wort der Verheißung verlassen kann. Deshalb ist im Haus des Bräutigams alles vorbereitet und wartet dort; und deshalb bereiten sich die Jungfrauen darauf vor, ihm bei seiner Ankunft entgegenzugehen. Das Gleichnis geht davon aus, dass der Bräutigam nicht in der Stadt ist, sondern irgendwo in der Ferne, so dass man nicht wissen kann, zu welcher genauen Stunde er kommen wird. Aber es ist bekannt, dass er in dieser Nacht kommen wird; und die Jungfrauen, die ihm entgegenkommen sollen, haben sich versammelt – vermutlich in dem Haus, in dem die Hochzeit stattfinden soll – und warten auf die Aufforderung, hinauszugehen und den Bräutigam zu begrüßen. Der weit verbreitete Irrtum, dass die Jungfrauen in Vers 1 so dargestellt werden, als seien sie auf den Weg hinausgegangen, um dem Bräutigam entgegenzugehen, ist nicht nur irrational – denn es ist kaum glaubhaft, dass sie alle am Wegesrand und mit Lampen in den Händen eingeschlafen wären -, sondern auch unvereinbar mit dem Umstand, dass um Mitternacht plötzlich der Ruf ertönt, hinauszugehen und ihm entgegenzugehen. Unter diesen Umständen lässt sich keine genaue Parallele zu den gewöhnlichen jüdischen Hochzeitszeremonien ziehen, bei denen der Bräutigam in Begleitung seiner Bräutigame und Freunde zum Haus der Braut ging und von dort aus die Braut mit ihren begleitenden Mägden und Freunden in sein eigenes oder das Haus seiner Eltern führte. Im Gleichnis jedoch kommt der Bräutigam von weit her und geht zum Haus der Braut. Dementsprechend soll der Brautzug ihm bei seiner Ankunft entgegenkommen und ihn zum Ort der Hochzeit geleiten. Die Braut wird weder in diesem Gleichnis noch in dem über die Hochzeit des Königssohns erwähnt. Dies aus Gründen, die mit ihrer Anwendung zusammenhängen, denn in dem einen Fall nehmen die Hochzeitsgäste, in dem anderen die Jungfrauen den Platz der Braut ein. Und hier müssen wir uns an den allgemeinen Kanon erinnern, dass bei der Auslegung eines Gleichnisses nicht zu sehr auf Einzelheiten geachtet werden darf. Die Gleichnisse veranschaulichen die Aussprüche Christi, wie die Wunder seine Taten; und sowohl die Gleichnisse als auch die Wunder stellen nur den einen oder anderen, nicht alle Aspekte der Wahrheit dar.
Eine andere archäologische Untersuchung ist vielleicht hilfreicher für unser Verständnis dieses Gleichnisses. Die „Lampen“ – nicht „Fackeln“ -, die die zehn Jungfrauen bei sich trugen, waren von bekannter Konstruktion. In talmudischen Schriften tragen sie gewöhnlich den Namen Lappid, aber die aramäisierte Form des griechischen Wortes kommt im Neuen Testament auch als Lampad und Lampedas vor. Die Lampen bestanden aus einem runden Gefäß für Pech oder Öl für den Docht. Dieses befand sich in einem hohlen Becher oder einer tiefen Untertasse – Beth Shiqquac -, die mit einem spitzen Ende an einer langen Holzstange befestigt war, an der sie in die Höhe getragen wurde. Jüdischen Behörden zufolge war es im Osten üblich, bei einer Brautprozession etwa zehn solcher Lampen mitzuführen. Wir haben umso weniger Grund, daran zu zweifeln, dass dies auch in Palästina der Fall war, da laut Rubriken zehn die Zahl war, die bei jedem Amt oder jeder Zeremonie anwesend sein musste, wie etwa bei den Segnungen, die die Hochzeitszeremonien begleiteten. Und unter den besonderen Umständen, die im Gleichnis angenommen werden, werden zehn Jungfrauen dargestellt, die dem Bräutigam entgegengehen, wobei jede ihre Lampe trägt.
Der erste Punkt, den wir bemerken, ist, dass die Zehn Jungfrauen vermutlich „ihre eigenen Lampen“ in das Brauthaus brachten. Dies muss hervorgehoben werden. Es war also viel persönliche Vorbereitung von allen dabei. Aber während die fünf klugen Jungfrauen auch „Öl in den Gefäßen „[vermutlich die hohlen Gefäße, in denen die eigentliche Lampe stand] mitbrachten, versäumten es die fünf törichten Jungfrauen, dies zu tun, da sie zweifellos erwarteten, dass ihre Lampen aus einem gemeinsamen Vorrat im Haus gefüllt würden. Im Text werden die törichten Jungfrauen vor den klugen erwähnt, weil sich das Gleichnis darum dreht. Wir können nicht umhin, den Sinn des Gleichnisses zu verstehen. Der Bräutigam in der Ferne ist Christus, der zum Hochzeitsfest aus dem „fernen Land“ – der Heimat im Himmel – gekommen ist, sicherlich in dieser Nacht, aber wir wissen nicht, zu welcher Stunde. Die zehn berufenen Brautleute, die ihm entgegengehen sollen, sind seine erklärten Jünger, und sie versammeln sich im Brauthaus, um seine Ankunft zu begrüßen. Es ist Nacht, und es ist ein Hochzeitszug: deshalb müssen sie mit ihren Lampen hinausgehen. Alle haben ihre eigenen Lampen mitgebracht, alle haben das christliche, oder sagen wir, das kirchliche Bekenntnis: die Lampe in dem hohlen Becher oben auf dem Pfahl. Aber nur die klugen Jungfrauen haben mehr als das – das Öl in den Gefäßen, ohne das die Lampen ihr Licht nicht geben können. Das christliche oder kirchliche Bekenntnis ist nur ein leeres Gefäß auf der Spitze einer Stange, ohne das Öl in den Gefäßen. Wir erinnern uns hier an die Worte Christi: „Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. „Die Torheit der Jungfrauen, die darin bestand, dass sie es versäumt hatten, ihr Öl mitzubringen, wird im Text so ausgedrückt: „Alle, die [αἵτινες]b töricht waren, als sie ihre eigenen Lampen brachten, brachten sie kein Öl mit:“ Sie brachten ihre eigenen Lampen, aber nicht ihr eigenes Öl. Dies geschah (wie bereits erklärt) wahrscheinlich nicht aus Vergesslichkeit – sie konnten kaum vergessen, dass sie Öl brauchten -, sondern aus vorsätzlicher Vernachlässigung, in dem Glauben, dass es einen gemeinsamen Vorrat im Haus geben würde, aus dem sie versorgt werden würden, oder dass nach der Ankündigung der Ankunft des Bräutigams genügend Zeit für die Versorgung ihres Bedarfs sein würde. Sie hatten weder eine Vorstellung von einer persönlichen Verpflichtung in dieser Angelegenheit, noch davon, dass der Ruf so plötzlich kommen würde, noch davon, dass zwischen der Ankunft des Bräutigams und dem „Schließen der Tür“ so wenig Zeit liegen würde. Und so hielten sie es nicht für nötig, das zu tun, was mit Mühe und Sorgfalt verbunden gewesen sein musste: ihr eigenes Öl in die hohlen Gefäße zu bringen, in denen die Lampen befestigt waren.
Wir sind davon ausgegangen, dass das Öl nicht in separaten Gefäßen mitgeführt wurde, sondern in solchen, die an den Lampen befestigt waren. Es scheint kaum wahrscheinlich, dass diese Lampen angezündet wurden, während man im Brauthaus wartete, in dem sich die Jungfrauen versammelten und das zweifellos festlich beleuchtet war. Gegen diese Sichtweise lassen sich leicht viele praktische Einwände vorbringen. Die Torheit der fünf Jungfrauen bestand also nicht (wie man gemeinhin annimmt) in ihrer mangelnden Ausdauer – als ob das Öl vor der Ankunft des Bräutigams verbraucht gewesen wäre und sie sich nur nicht mit einem ausreichenden Nachschub versorgt hätten -, sondern in der völligen Abwesenheit einer persönlichen Vorbereitung,da sie kein eigenes Öl in ihren Lampen mitgebracht hatten. Das entspricht ihrem Verhalten, die zur Kirche gehören, die den „Beruf“ haben, die mit Lampen ausgestattete Brautleute sind, die bereit sind, hinauszugehen, und die erwarten, am Hochzeitsmahl teilzuhaben, und die die Vorbereitung der Gnade, die persönliche Bekehrung und die Heiligkeit vernachlässigen und darauf vertrauen, dass in der Stunde der Not das Öl aus dem gemeinsamen Vorrat geliefert wird. Aber sie wissen nicht oder beachten nicht, dass jeder persönlich auf die Begegnung mit dem Bräutigam vorbereitet sein muss, dass der Ruf plötzlich kommt, dass der Ölvorrat nicht allgemein ist und dass die Zeit zwischen seiner Ankunft und dem Schließen der Tür furchtbar kurz sein wird.
Denn – und hier beginnt die zweite Szene des Gleichnisses – die Zeitspanne zwischen dem Zusammentreffen der Jungfrauen und der Ankunft des Bräutigams ist viel länger, als man erwartet hatte. Und so kam es, dass sowohl die klugen als auch die törichten Jungfrauen „schlummerten und schliefen“. Offensichtlich ist dies nur ein sekundäres Merkmal des Gleichnisses, das vor allem dazu dient, die Überraschung über die plötzliche Ankündigung des Bräutigams hervorzuheben. Die törichten Jungfrauen scheiterten letztlich nicht an ihrem Schlaf, und auch die klugen wurden nicht dafür getadelt. Es war zwar ein Beweis für ihre Schwäche, aber es war Nacht, alle Welt schlief, und ihre eigene Schläfrigkeit mag im Verhältnis zu ihrer früheren Aufregung stehen. Was nun folgt, soll die erschreckende Plötzlichkeit des Kommens des Bräutigams hervorheben. Es ist Mitternacht – wenn der Schlaf am tiefsten ist – als plötzlich „ein Ruf ertönt: Siehe, der Bräutigam kommt! Kommt heraus zur Begegnung mit ihm. Da wachten alle Jungfrauen auf und bereiteten ihre Lampen vor“. Dies nicht in dem Sinne, dass sie die schwache Flamme in ihren Lampen erhöhten, sondern in dem Sinne, dass sie eilig den Docht herauszogen und anzündeten, wobei die Flamme natürlich sofort erlosch, da kein Öl in den Gefäßen war. Da sprachen die Törichten zu den Weisen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Die Weisen aber antworteten und sprachen: Keineswegs1 – es wird niemals2 für uns und euch ausreichen! Geht lieber zu den Verkäufern und kauft für euch selbst.‘
Dieser Ratschlag ist nicht als Ironie zu verstehen. Das Merkmal wird eingeführt, um auf die richtige Quelle der Versorgung hinzuweisen – um zu betonen, dass das Öl ihr eigenes sein muss, und auch um auf das vorzubereiten, was folgt. Während sie aber kauften, kam der Bräutigam; und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zum Hochzeitsmahl, und die Tür wurde verschlossen. Der plötzliche Ruf um Mitternacht: „Der Bräutigam kommt!“ kam sowohl für die klugen als auch für die törichten Jungfrauen überraschend; für die eine Klasse kam er nur unerwartet, für die andere aber auch unvorbereitet. Da ihre Hoffnung, das Öl der klugen Jungfrauen zu teilen oder zu borgen, enttäuscht wurde, waren die törichten Jungfrauen natürlich nicht in der Lage, den Bräutigam zu treffen. Und während sie zu den Ölverkäufern eilten, trafen sich die, die bereit waren, nicht nur, sondern gingen mit dem Bräutigam in das Brauthaus, und die Tür wurde geschlossen. Es ist hier nicht von Bedeutung, ob es den törichten Jungfrauen schließlich gelang, Öl zu beschaffen – obwohl dies zu jener Zeit unwahrscheinlich erscheint -, denn es konnte nicht mehr von Nutzen sein, da es dazu bestimmt war, bei der festlichen Prozession zu dienen, die nun vorüber war. Dennoch kamen die törichten Jungfrauen, als die Tür geschlossen war, und riefen den Bräutigam an, ihnen zu öffnen. Aber sie hatten in dem versagt, was ihnen allein ein Recht auf Einlass geben konnte. Sie gaben vor, Brautjungfern zu sein, waren aber nicht im Hochzeitszug, und so konnte Er in Wahrheit und Gerechtigkeit nur von innen heraus antworten: „Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. Dies nicht nur zur Strafe, sondern in der richtigen Ordnung der Dinge.
Die persönliche Anwendung dieses Gleichnisses auf die Jünger, die der Herr vornimmt, folgt fast zwangsläufig. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde’Es genügt nicht, mit der Kirche zu warten; Sein Kommen wird weit in der Nacht sein; es wird plötzlich sein; es wird schnell sein: Seid also bereit, seid immer und persönlich bereit! Christus wird kommen, wenn man es am wenigsten erwartet – um Mitternacht – und wenn die Kirche, die sich an seine lange Verspätung gewöhnt hat, sich schlafen gelegt hat. Sein Kommen wird so plötzlich sein, dass nach dem Ruf der Ankündigung keine Zeit für irgendetwas anderes bleibt, als ihm entgegenzugehen; und das Ende wird so schnell sein, dass, bevor die törichten Jungfrauen zurückkehren können, die Tür für immer geschlossen ist. Um dies alles auf die eindrucksvollste Weise darzustellen, nimmt das Gleichnis die Form eines Dialogs an, zunächst zwischen den törichten und den klugen Jungfrauen, wobei die letzteren nur die nackte Wahrheit sagen, dass jede nur so viel Öl hat, wie sie bei ihrem Eintritt in den Hochzeitszug braucht, und nichts, was überflüssig ist. Schließlich sollen wir aus dem Dialog zwischen den törichten Jungfrauen und dem Bräutigam lernen, dass es am Tag der Ankunft Christi unmöglich ist, eine vernachlässigte Vorbereitung nachzuholen, und dass diejenigen, die es versäumt haben, ihm entgegenzukommen, auch wenn sie zu den bräutlichen Jungfrauen gehören, schließlich als Fremde vom Bräutigam ausgeschlossen sein werden.
Das Gleichnis von den Talenten – ihre Verwendung und ihr Missbrauch – schließt sich eng an die Ermahnung zur Wachsamkeit im Hinblick auf die plötzliche und sichere Wiederkunft Christi und die Belohnung oder Bestrafung an, die dann erfolgen wird. Nur bezieht sich das Gleichnis von den zehn Jungfrauen auf den persönlichen Zustand, das Gleichnis von den Talenten dagegen auf die persönliche Arbeit der Jünger. Im ersten Fall werden sie als Brautjungfern dargestellt, die seine Wiederkunft begrüßen sollen, im zweiten Fall als Diener, die Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen müssen.
Aufgrund des engen Zusammenhangs mit dem Vorangegangenen beginnt das Gleichnis fast unvermittelt mit den Worten: Denn es ist wie ein Mensch, der in die Fremde geht und seine eigenen Knechte ruft und ihnen seine Güter übergibt. Die Betonung liegt darauf, dass sie seine eigenen Diener waren, die in seinem Interesse handeln sollten. Sein Eigentum wurde ihnen übergeben, nicht um es zu verwahren, sondern damit sie im Interesse ihres Meisters so gut wie möglich damit umgehen. Dies geht aus dem unmittelbar folgenden Text hervor: Und so gab er einem fünf Talente (ca. 1.170 l), einem aber zwei (ca. 468 l) und einem einen (= 6.000 Denare, ca. 234 l), einem jeden nach seinem Vermögen „er gab einem jeden nach seinem Vermögen, je nachdem, wie er sie für eine größere oder kleinere Verwaltung für geeignet hielt. Und er reiste sogleich ins Ausland’2. Nachdem er die Verwaltung seiner Angelegenheiten seinen Dienern entsprechend ihren Fähigkeiten anvertraut hatte, reiste er sogleich ab.
So weit können wir keine Schwierigkeiten haben, den Sinn des Gleichnisses zu verstehen. Unser Herr, der uns für das Haus des Vaters verlassen hat, ist derjenige, der auf die Reise gegangen ist, und seinen eigenen Dienern hat er das, was er als seine eigenen „Güter“ beansprucht, nicht zur Aufbewahrung, sondern zum Gebrauch für ihn in der Zeit zwischen seiner Abreise und seiner Rückkehr anvertraut. Wir dürfen dies nicht auf die Verwaltung seines Wortes oder auf das heilige Amt beschränken, auch wenn diese in erster Linie im Blick waren. Es bezieht sich allgemein auf alles, was ein Mensch hat, um Christus zu dienen; denn alles, was der Christ hat – seine Zeit, sein Geld, seine Möglichkeiten, seine Talente oder sein Wissen (und nicht nur „das Wort“) -, gehört Christus und ist uns anvertraut, nicht um es zu verwahren, sondern um damit für den abwesenden Meister zu handeln – um den Fortschritt seines Reiches zu fördern. Und einem jeden von uns gibt er entsprechend seiner Arbeitsfähigkeit – geistig, moralisch und sogar körperlich – dem einen fünf, dem anderen zwei und dem nächsten ein „Talent“. Diese Arbeitsfähigkeit liegt nicht in unserer eigenen Macht; aber es liegt in unserer Macht, alles, was wir haben, für Christus einzusetzen.
Und hier zeigt sich der charakteristische Unterschied. Derjenige, der die fünf Talente erhalten hatte, ging hin und handelte mit ihnen und erwarb weitere fünf Talente. In gleicher Weise gewann der, der die zwei empfangen hatte,1 andere zwei.‘ Wie jeder nach seinem Vermögen empfangen hatte, so arbeitete jeder nach seiner Kraft, als gute und treue Diener seines Herrn. Wenn auch das äußere Ergebnis unterschiedlich war, so waren doch ihre Arbeit, ihre Hingabe und ihre Treue gleich. Anders war es bei dem, der am wenigsten für seinen Herrn zu tun hatte, denn ihm war nur ein einziges Talent anvertraut worden. Er „ging weg, grub Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn“. Das Besondere daran ist, dass er es nicht wie ein guter Diener für seinen Herrn einsetzte, sondern sich vor der Arbeit und der Verantwortung drückte und sich so verhielt, als wäre es das Eigentum eines Fremden und nicht das seines Herrn. Damit wurde er nicht nur seinem Vertrauen untreu, sondern verleugnete praktisch, dass er ein Diener seines Herrn war. Dementsprechend werden im Gegensatz zu dem Knecht, der viel erhalten hatte, im Gleichnis zwei andere vorgestellt, die beide vergleichsweise wenig erhalten hatten – einer von ihnen war treu, während der andere in müßigem Egoismus das Geld versteckte und sich nicht darum kümmerte, dass es „seinem Herrn“ gehörte. Während also der zweite Knecht, obwohl ihm weniger anvertraut worden war, ebenso treu und gewissenhaft war wie der, dem viel gegeben worden war, und während beide durch ihren Gewinn den Besitz ihres Herrn vermehrt hatten, hatte der dritte durch sein Verhalten das Geld seines Herrn zu einer toten, nutzlosen, vergrabenen Sache gemacht.
Und nun beginnt die zweite Szene. Aber nach langer Zeit kommt der Herr dieser Knechte und rechnet mit ihnen ab1. Die Erwähnung der langen Abwesenheit des Herrn stellt nicht nur eine Verbindung zum Gleichnis von den zehn Jungfrauen her, sondern soll auch zeigen, dass die Verzögerung die Knechte, die Handel trieben, unvorsichtiger gemacht haben könnte, während sie auch die Schuld desjenigen vergrößerte, der die ganze Zeit über nichts mit dem Geld seines Herrn gemacht hatte. Und nun antwortet der erste der Knechte, ohne von seiner Arbeit beim Handel oder seinem Verdienst beim „Verdienen“ von Geld zu sprechen, mit einfacher Freude: „Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Siehe, ich habe noch andere fünf Talente dazugewonnen. „Wir können fast sehen, wie sein ehrliches Gesicht vor Freude strahlt, als er auf den vermehrten Besitz seines Meisters zeigt. Seine Anerkennung war alles, worauf der treue Diener gehofft und wofür er während seiner langen Abwesenheit geschuftet hatte. Und wir können verstehen, wie der Meister diesen Diener willkommen hieß und ihm eine Belohnung zukommen ließ. Dieser war zweifach. Nachdem er seine Treue und seine Fähigkeiten in einem vergleichsweise begrenzten Bereich unter Beweis gestellt hatte, sollte ihm ein viel größerer zugewiesen werden. Denn die Arbeit zu verrichten und den Reichtum seines Meisters zu mehren, war offensichtlich seine Freude und sein Vorrecht sowie seine Pflicht gewesen. Daher darf sich auch der zweite Teil seines Lohns – das Eingehen in die Freude seines Herrn – nicht auf die Teilnahme am Festmahl bei seiner Rückkehr beschränken, noch weniger auf den Aufstieg von der Stellung eines Knechtes zu der eines Freundes, der die Herrschaft seines Herrn teilt. Sie beinhaltet weit mehr als das: sogar eine zufriedene Sympathie des Herzens für die Ziele und Errungenschaften seines Meisters und die Teilnahme an ihnen mit allem, was dies mit sich bringt.
Ein ähnliches Ergebnis ergab sich bei der Abrechnung mit dem Knecht, dem zwei Talente anvertraut worden waren. Wir sehen, dass er, obwohl er nur von zwei gewonnenen Talenten sprechen konnte, seinem Meister mit der gleichen offenen Freude begegnete wie der, der fünf verdient hatte. Denn er war genauso treu gewesen und hatte sich genauso angestrengt wie der, dem mehr anvertraut worden war. Und, was noch wichtiger ist, der frühere Unterschied zwischen den beiden Dienern, der von größerer oder geringerer Arbeitsfähigkeit abhing, hörte nun auf, und der zweite Diener erhielt genau die gleiche Begrüßung und genau den gleichen Lohn, und zwar in den gleichen Worten wie der erste. Und eine noch tiefere und in gewisser Weise geheimnisvolle Wahrheit erfahren wir im Zusammenhang mit den Worten: Du bist über wenige Dinge treu gewesen, ich will dich über viele Dinge setzen“. Wenn auch nicht nach dem Tod, so muss doch in jener anderen „Dispensation“ ein Werk für Christus zu tun sein, auf das wir uns in diesem Leben vorbereiten, indem wir das, was er uns anvertraut hat, treu für ihn einsetzen – sei es viel oder wenig. Das gibt dem jetzigen Leben eine ganz neue und gesegnete Bedeutung – als wahrhaftiger und in all seinen Aspekten Teil des Lebens, zu dem es sich entfalten soll. Nein, nicht der kleinste Teil der „Talente“, wenn sie nur treu für Christus eingesetzt werden, kann verloren gehen, nicht nur in Bezug auf seine Anerkennung, sondern auch auf ihre weitere und umfassendere Verwendung. Und dürfen wir nicht vermuten, dass dies, wenn auch nicht erklärt, so doch den Heiligenschein Seiner Absicht und Gegenwart um das wirft, was so oft rätselhaft erscheint bei der Entfernung derer, die gerade die Öffnung oder volle Nützlichkeit erreicht hatten, oder sogar derer, die uns im frühen Morgengrauen der Jugend und Schönheit genommen werden. Der Herr mag sie „brauchen“, wo oder wie, wissen wir nicht – und jenseits dieses Arbeitstages und dieser Arbeitswelt gibt es „viele Dinge“, über die der treue Diener im Kleinen „gesetzt“ werden kann, damit er immer noch, und mit stark erweiterten Möglichkeiten und Kräften, das Werk für Christus tun kann, das er so sehr geliebt hatte, während er gleichzeitig auch die Freude seines Herrn teilt.
Es bleibt nur noch, auf den dritten Knecht hinzuweisen, dessen traurige Untreue und Dienstverweigerung wir bereits in gewissem Maße verstehen. Als er zur Rechenschaft gezogen wurde, gab er das ihm anvertraute Talent mit der Erklärung zurück, er wisse, dass sein Meister ein harter Mann sei, der erntet, wo er nicht sät, und sammelt, wo er nicht , und deshalb habe er Angst gehabt, sich zu verantworten2 , und das Talent, das er nun zurückgab, in der Erde versteckt. Es bedarf keines Kommentars, um zu zeigen, dass seine eigenen Worte, so ehrlich und selbstgerecht sie auch klingen mögen, eine Vernachlässigung seiner Arbeit und seiner Pflicht als Diener und ein völliges Missverständnis sowie eine Herzensentfremdung von seinem Meister zugeben. Er diente Ihm nicht und kannte Ihn nicht; er liebte Ihn nicht und sympathisierte nicht mit Ihm. Aber seine Antwort war auch eine Beleidigung und ein verlogener Vorwand. Er war untätig gewesen und nicht bereit, für seinen Meister zu arbeiten. Wenn er arbeitete, dann nur für sich selbst. Er wollte sich nicht den Schwierigkeiten, der Selbstverleugnung und vielleicht den Vorwürfen aussetzen, die mit der Arbeit seines Meisters verbunden waren. Wir erkennen hier diejenigen, die, obwohl sie seine Diener sind, aus Selbstgefälligkeit und Weltlichkeit mit dem einen Talent, das ihnen anvertraut wurde, keine Arbeit für Christus verrichten – auch wenn die Verantwortung und der Anspruch an sie am geringsten sind – und die es für ausreichend halten, es in der Erde zu verstecken – um es nicht zu verlieren – oder um es, wie sie meinen, davor zu bewahren, für Böses verwendet zu werden, ohne es für den Handel mit Christus einzusetzen. Die Falschheit der Ausrede, er habe sich gefürchtet, irgendetwas damit zu tun – eine Ausrede, die in unseren Tagen zu oft wiederholt wird -, um vielleicht mehr Schaden als Nutzen anzurichten, wurde nun vom Meister vollständig entlarvt. Zugegeben, sie rührte von einem Mangel an Wissen über Ihn her, als ob Er ein harter, fordernder Meister wäre und nicht Einer, der auch den geringsten Dienst als für sich selbst getan ansieht; auch von einem Missverständnis darüber, was Arbeit für Christus ist, bei der nichts jemals fehlschlagen oder verloren gehen kann; und schließlich von einem Mangel an freudiger Anteilnahme daran. Und so wischte der Meister den fadenscheinigen Vorwand beiseite. Er sprach ihn als „bösen und faulen Knecht“ an und wies ihn darauf hin, dass er, wenn er Angst gehabt hätte, Verantwortung zu übernehmen, das Geld „den Bankiers“ hätte geben können (ein Wort, das die Abwesenheit von Arbeit ausdrücken sollte), und bei seiner Rückkehr hätte er das Seine „mit Zinsen“ erhalten. Auf diese Weise hätte er, ohne Verantwortung oder viel Arbeit auf sich zu nehmen, zumindest in einem begrenzten Sinne seiner Pflicht und seinem Vertrauen als Diener treu sein können.
Der Hinweis auf die Praxis, Geld gegen Zinsen bei den Bankiers zu hinterlegen, wirft Fragen auf, die zu zahlreich und langwierig sind, um sie an dieser Stelle ausführlich zu erörtern. Das jüdische Gesetz unterschied zwischen „Zins“ und „Gewinn“ (neshekh und tarbith) und ging auf viele und komplizierte Details zu diesem Thema ein. Solche Geschäfte waren bei Israeliten verboten, bei Heiden aber erlaubt. Wie in Rom scheinen die Geschäfte der „Geldwechsler“ (argentarii, nummularii) und die der „Bankiers“ (collectarii, mensularii) ineinander übergegangen zu sein. Die jüdischen „Bankiers“ tragen genau denselben Namen (Shulchani, mensularius, τραπεζίτης). In Rom scheinen in der Frühzeit sehr hohe Zinsen erhoben worden zu sein; nach und nach wurden sie gesenkt, bis sie zunächst auf 8 ½ und dann auf 4 1/6 Prozent festgelegt wurden. Aber diese Gesetze waren nicht von Dauer. Praktisch war der Wucher unbegrenzt. Bald wurde es üblich, monatliche Zinsen in Höhe von 1 Prozent pro Monat zu verlangen. Dennoch gab es blühende Zeiten, wie am Ende der Republik, in denen der Zinssatz so niedrig wie 4 Prozent war; während des frühen Kaiserreichs lag er bei 8 Prozent. Dies gilt natürlich für das, was wir als fairen Geschäftsverkehr bezeichnen können. Jenseits davon, in der fast unglaublichen Extravaganz, dem Luxus und der Verschuldung selbst einiger der wichtigsten historischen Persönlichkeiten, fanden die meisten wucherischen Geschäfte statt (besonders in den Provinzen), und zwar von Leuten in hoher Position (Brutus in Zypern und Seneca in Britannien). Geld wurde zu 12, 24, ja sogar 48 Prozent verliehen; die Rechnungen lauteten auf eine höhere Summe als die tatsächlich erhaltene, und die Zinsen wurden dem Kapital zugeschlagen, so dass Schulden und Zinsen gleichermaßen wuchsen. In Griechenland gab es reguläre Staatsbanken, während in Rom eine solche Einrichtung nur in Ausnahmefällen existierte. Nicht selten wurde das doppelte Geschäft des Geldwechselns und des Bankgeschäfts kombiniert. Solche „Bankiers“ übernahmen Zahlungen, das Einziehen von Geldern und Konten, die Auszahlung von Geld gegen Zinsen – kurz, alle üblichen Geschäfte dieser Art. außer Frage, dass die jüdischen Bankiers in Palästina und anderswo dieselben Tätigkeiten ausübten, während es für die über die ganze Welt verstreuten Menschen einfacher war, in jeder Stadt vertrauenswürdige Korrespondenten zu haben. So finden wir, dass Herodes Agrippa dem jüdischen Alabarchen in Alexandria die Summe von 20.000 Drachmen geliehen hat, die ihm in Italien ausgezahlt wurde, wobei sich die Provision und die Zinsen darauf auf nicht weniger als 8 ½ Prozent beliefen. (2.500 Drachmen).
So ist die Anspielung auf die „Bankiers“ zu verstehen, bei denen der böse und untreue Knecht das Geld seines Herrn hätte unterbringen können, wenn seine Ausrede wahr gewesen wäre. Der Hauptzweck dieses Teils des Gleichnisses ist es, seine Hohlheit zu entlarven. Es wäre aber im Sinne des Gleichnisses, den Ausdruck auch auf den indirekten Einsatz von Geld im Dienste Christi anzuwenden, wie etwa durch Spenden usw. Aber die große Lektion, die gemeint ist, ist, dass jeder gute und treue Diener Christi, unabhängig von seinen Umständen, persönlich und direkt das Talent einsetzen muss, das er haben mag, um für Christus Gewinn zu machen. An dieser Prüfung gemessen, wie wenige scheinen ihre Beziehung zu Christus verstanden zu haben, und wie kalt ist die Liebe der Kirche in der langen Abwesenheit ihres Herrn geworden!
Was aber den „unnützen“ Knecht im Gleichnis betrifft, so soll ihn die bekannte Strafe desjenigen erwarten, der ohne Hochzeitsgewand zum Hochzeitsmahl gekommen war, während das Talent, das er nicht für seinen Herrn eingesetzt hatte, demjenigen anvertraut werden soll, der sich als besonders tüchtig erwiesen hatte. Wir brauchen nicht nach einer ausführlichen Interpretation zu suchen. Es weist auf den Grundsatz hin, der in jeder Verwaltung Gottes gleichermaßen gilt: „Wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird in die Fülle kommen; aber nicht hat,4 dem wird auch das genommen werden, was er hat“. Das ist keine zynische Regel, wie sie die Welt in ihrem Egoismus oder ihrer Verehrung des Erfolgs karikiert, und auch nicht die Verehrung einer überlegenen Kraft, sondern die, dass der treue Gebrauch jeder Fähigkeit für Gott immer neue Gelegenheiten eröffnen wird, in dem Maße, wie die alten benutzt worden sind, während die geistliche Unrentabilität mit dem völligen Verlust auch dessen enden muss, was, wie bescheiden auch immer, zu einer Zeit für Gott und zum Guten hätte benutzt werden können.
Zu diesen Gleichnissen kann das Gleichnis vom König, der bei seiner Rückkehr mit seinen Dienern und Feinden abrechnet, als Ergänzung betrachtet werden. Es wird nur von Lukas aufgezeichnet und von ihm in einen etwas losen Zusammenhang mit der Bekehrung des Zachäus gestellt. oberflächlicher Betrachtung wird man eine so unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Gleichnis von den Talenten feststellen, dass sich dem Leser die Identität von selbst erschließt. Andererseits gibt es bemerkenswerte Abweichungen im Detail, von denen einige auf einen unterschiedlichen Standpunkt hinzudeuten scheinen, von dem aus dieselbe Wahrheit betrachtet wird. Hinzu kommt die Botschaft des Hasses seitens der Bürger und ihr daraus resultierendes Schicksal. Es mag sein, dass Christus die beiden Gleichnisse bei den beiden von Lukas und Matthäus erwähnten unterschiedlichen Gelegenheiten erzählte – das eine auf dem Weg nach Jerusalem, das andere auf dem Ölberg. Und doch scheint es schwer vorstellbar, dass er innerhalb weniger Tage nach der Erzählung des von Lukas aufgezeichneten Gleichnisses dieses mit fast denselben Worten vor den Jüngern wiederholt haben soll, die es in Jericho gehört haben müssen. Dieser Einwand wäre nicht so schwerwiegend, wenn das zunächst an die Jünger gerichtete Gleichnis (das von den Talenten) danach (in der Aufzeichnung des Lukas) in einem größeren Kreis wiederholt worden wäre, und nicht, wie die Synoptiker behaupten, im Gegenteil. Wenn wir jedoch die beiden Gleichnisse von den Talenten und den Geldstücken als im Wesentlichen dasselbe betrachten, sind wir geneigt, die Überlieferung des Matthäus als die ursprüngliche zu betrachten, da sie die homogenere und kompaktere ist, während die des Lukas ein anderes Gleichnis, nämlich das von den rebellischen Bürgern, mit diesem zu verbinden scheint. Vielleicht ist es am sichersten anzunehmen, dass Christus auf seinem Weg nach Jerusalem, als seine Anhänger (nicht nur die Jünger) natürlich erwarteten, dass er sein messianisches Reich einführen würde, das letztgenannte Gleichnis erzählte, um sie zu lehren, dass das Verhältnis, in dem Jerusalem zu ihm stand, und sein Schicksal ganz anders waren, als sie es sich vorstellten, und dass sein Einzug in die Stadt und die Ankunft seines Reiches zeitlich weit voneinander entfernt sein würden. Die Aussicht, die sie vor sich sahen, war daher die des Wirkens, nicht die des Herrschens; danach würde die Abrechnung kommen, wenn der treue Arbeiter der vertraute Herrscher werden würde. Diese Punkte standen natürlich in engem Zusammenhang mit den Lehren aus dem Gleichnis von den Talenten, und um das Thema in seiner Gesamtheit darzustellen, hat Lukas vielleicht Einzelheiten aus diesem Gleichnis übernommen und seine Lehre durch die Darstellung eines anderen Aspekts ergänzt.
Wenn Lukas wirklich diese beiden Gleichnisse (das vom König und das von den Talenten) im Auge hatte und sie zu einer neuen Lehre verbinden wollte, so hat er sie auf wunderbare Weise miteinander verbunden. Denn da der Edle, der seinen Dienern Geld anvertraut, ins Ausland geht, um ein Königreich zu empfangen, war es möglich, ihn sowohl in Bezug auf die rebellischen Bürger als auch auf seine eigenen Diener darzustellen und ihren Lohn mit seinem „Königreich“ zu verbinden. Und so werden die beiden Gleichnisse miteinander verbunden, indem die Illustration aus dem politischen statt aus dem sozialen Leben abgeleitet wird. Es ist allgemein angenommen worden, dass das Gleichnis eine Anspielung auf die Ereignisse nach dem Tod von Herodes dem Großen enthält, als sein Sohn Archelaus nach Rom eilte, um die Bestätigung des Testaments seines Vaters zu erwirken, während eine jüdische Deputation folgte, um sich seiner Ernennung zu widersetzen – ein Akt der Rebellion, den Archelaus später mit dem Blut seiner Feinde rächte. Der Umstand muss dem Volk noch in frischer Erinnerung gewesen sein, obwohl mehr als dreißig Jahre vergangen waren. Aber wenn dem nicht so war, waren die Anträge auf Einsetzung in die Regierung in Rom und der Widerstand des Volkes dagegen inmitten der Streitigkeiten und Intrigen der Herodianer so häufig, dass es keine Schwierigkeiten gab, die Anspielungen des Gleichnisses zu verstehen.
Eine kurze Analyse wird genügen, um die besonderen Lehren dieses Gleichnisses aufzuzeigen. Es wird „ein gewisser Edelmann“ vorgestellt, der Anspruch auf den Thron erhebt, aber noch nicht die offizielle Ernennung durch die Oberherrschaft erhalten hat. Da er sich auf den Weg macht, um die Ernennung zu erhalten, hat er bisher nur mit seinen Dienern zu tun. Sein Ziel ist es offenbar, ihre Eignung, Hingabe und Treue zu prüfen, und so übergibt er – nicht jedem nach seinem Vermögen, sondern allen gleichermaßen – eine Summe, die nicht groß (wie Talente), sondern klein ist – jedem eine „Mina“, die 100 Drachmen oder etwa 3l. 5s. von unserem Geld. Mit einer so kleinen Summe zu handeln, wäre natürlich viel schwieriger, und der Erfolg würde eine größere Fähigkeit voraussetzen, auch wenn es mehr ständige Arbeit erfordern würde. Hier haben wir einige Züge, in denen sich dieses Gleichnis vom Gleichnis von den Talenten unterscheidet. Es wird angenommen, dass allen dieselbe kleine Summe anvertraut wurde, um zu zeigen, wer von ihnen am fähigsten und ernsthaftesten war, und daher zu der größten Arbeit und damit zur größten Ehre im Königreich berufen werden sollte. Während „der Edle“ sich am Hofe seines Oberherrn aufhielt, traf eine Deputation seiner Mitbürger ein, um ihren Entschluss zu bekräftigen: „Wir wollen nicht, dass dieser über uns regiert. Es war einfach ein Ausdruck des Hasses; er gab keinen Grund an und drängte nur auf persönliche Ablehnung, auch wenn diese dem persönlichen Wunsch des Herrschers, der ihn zum König ernannt hatte, entgegenstand.
In der letzten Szene ist der König, der nun ordnungsgemäß ernannt wurde, in sein Land zurückgekehrt. Er rechnet zunächst mit seinen Dienern ab, und es stellt sich heraus, dass alle bis auf einen ihrem Auftrag treu geblieben sind, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg (die Mina des einen ist auf zehn angewachsen, die des anderen auf fünf und so weiter). In strenger Übereinstimmung mit diesem Erfolg ist nun ihre weitere Berufung zur Herrschaft – Arbeit hier, die der Herrschaft dort entspricht, die aber, wie wir aus dem Gleichnis von den Talenten wissen, auch Arbeit für Christus ist: eine Herrschaft, die Arbeit ist, und Arbeit, die Herrschaft ist. Zugleich ist die Anerkennung für alle treuen Diener die gleiche. Auch die Motive, die Überlegungen und das Schicksal des untreuen Knechtes sind die gleichen wie im Gleichnis von den Talenten. Aber was seine „Feinde“ betrifft, die nicht wollten, dass er über sie herrsche – offensichtlich Jerusalem und das Volk Israel -, die selbst nachdem er gegangen war, um das Königreich zu empfangen, die persönliche Feindschaft ihres „Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht“ fortsetzten – die Asche des Tempels, die Ruinen der Stadt, die Asche des Tempels, die Ruinen der Stadt, das Blut der Väter und das heimatlose Umherirren ihrer Kinder mit dem für alle sichtbaren Kainsmal auf der Stirn zeugen davon, dass der König viele Diener hat, um das Gericht zu vollstrecken, das die hartnäckige Rebellion mit Sicherheit bringen muss, wenn seine Autorität gerechtfertigt und seine Herrschaft die Unterwerfung sichern soll.




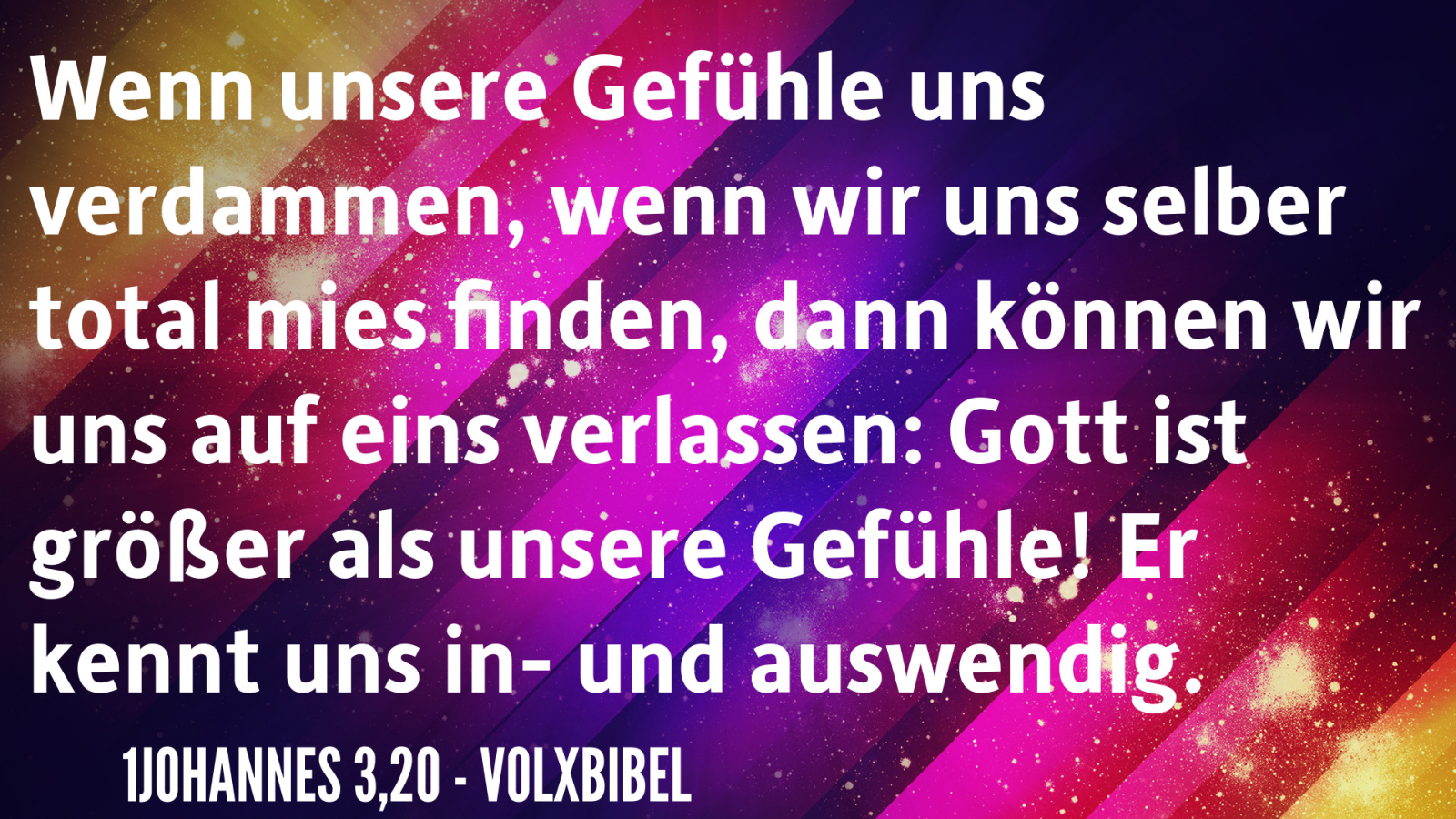
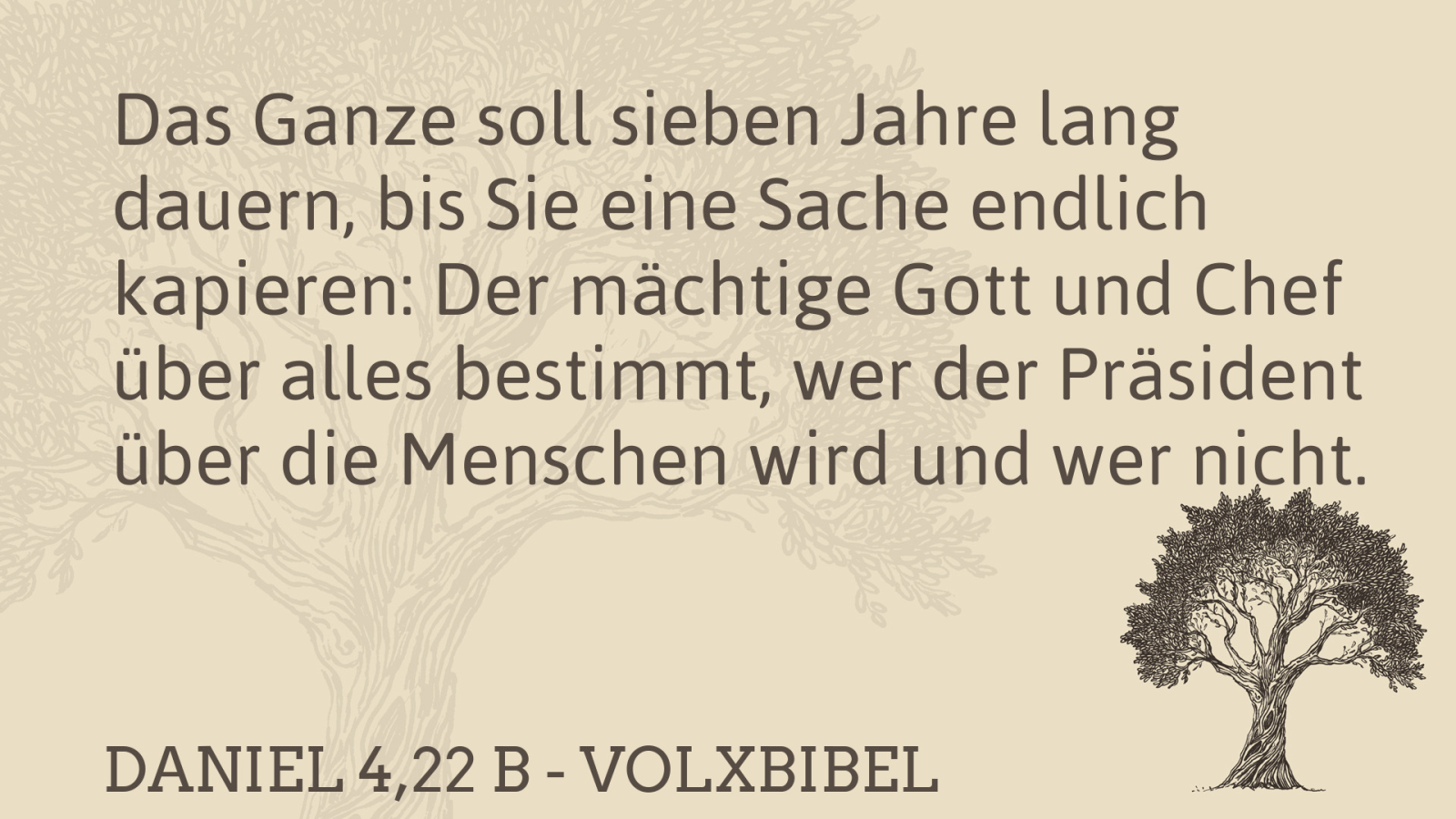
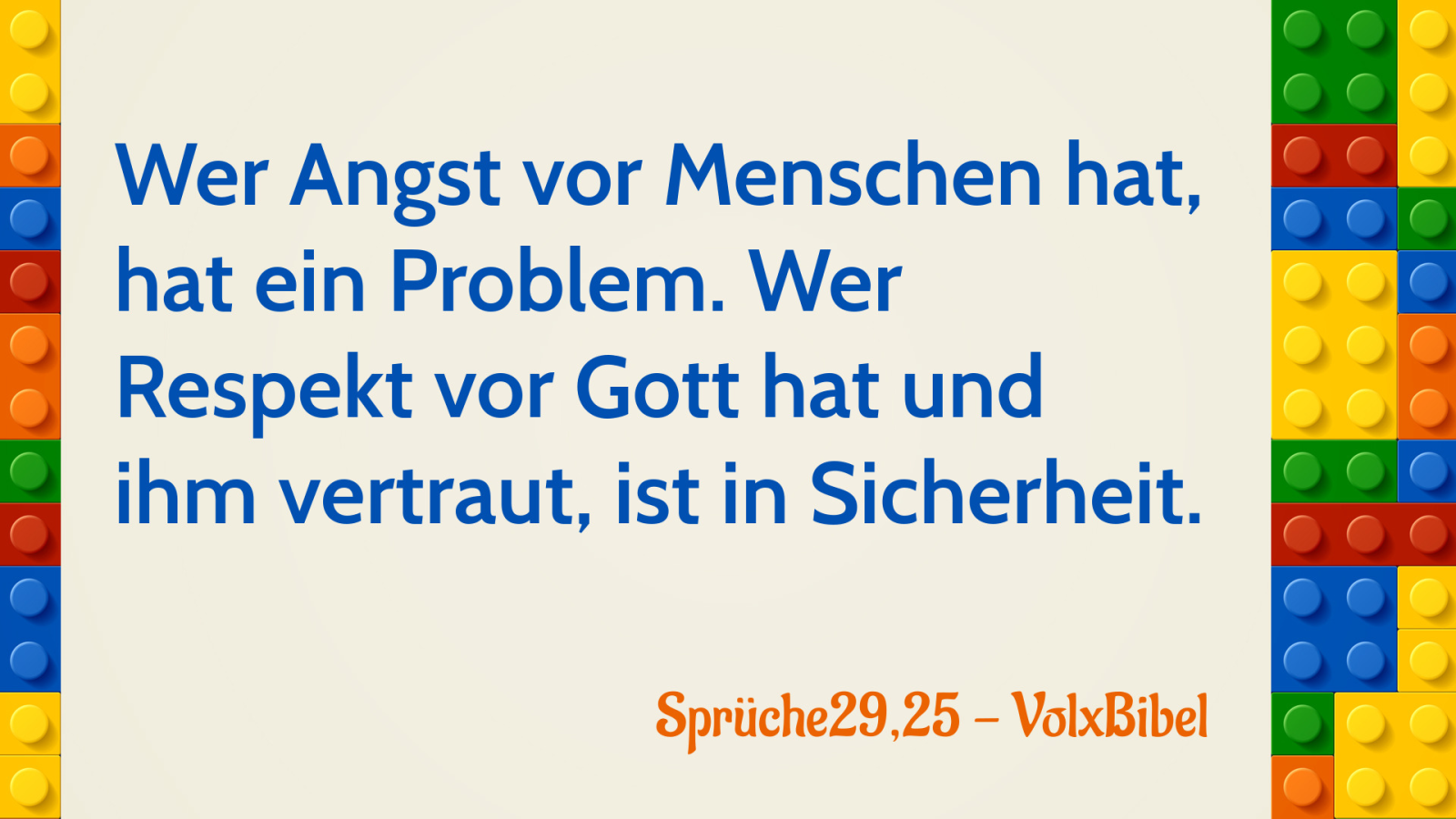
Neueste Kommentare