Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, (Vergl 2Mose 19,5. 6.) damit ihr die Tugenden (O. Vortrefflichkeiten) dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;
Elberfelder 1871 – 1.Petrus 2,9
Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk ( wörtlich Geschlecht ); ihr seid eine königliche Priesterschaft (oder eine Priesterschaft im Dienst des Königs. Vergleiche 2. Mose 19,6 und zum ganzen Vers auch 2. Mose 19,5 und Jesaja 43,21 ) , eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat ( und ihr habt den Auftrag), seine großen Taten zu verkünden – die Taten ( seinen Ruhm zu verkünden – den Ruhm ) dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
Neue Genfer Übersetzung – 1.Petrus 2:9
Ihr aber seid „ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum besonderen Besitz, damit ihr die Vorzüglichkeiten“ dessen „weit und breit verkündet“, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat.
neue Welt Übersetzung – Bi12 – 1.Petrus 2:9
Doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation, eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, öffentlich zu erzählen. Er, Gott, hat euch herausgerufen aus dem Bereich der Finsternis in sein wunderbares, erstaunliches Licht.
Roland Werner – Das Buch – 1.Petrus 2,9
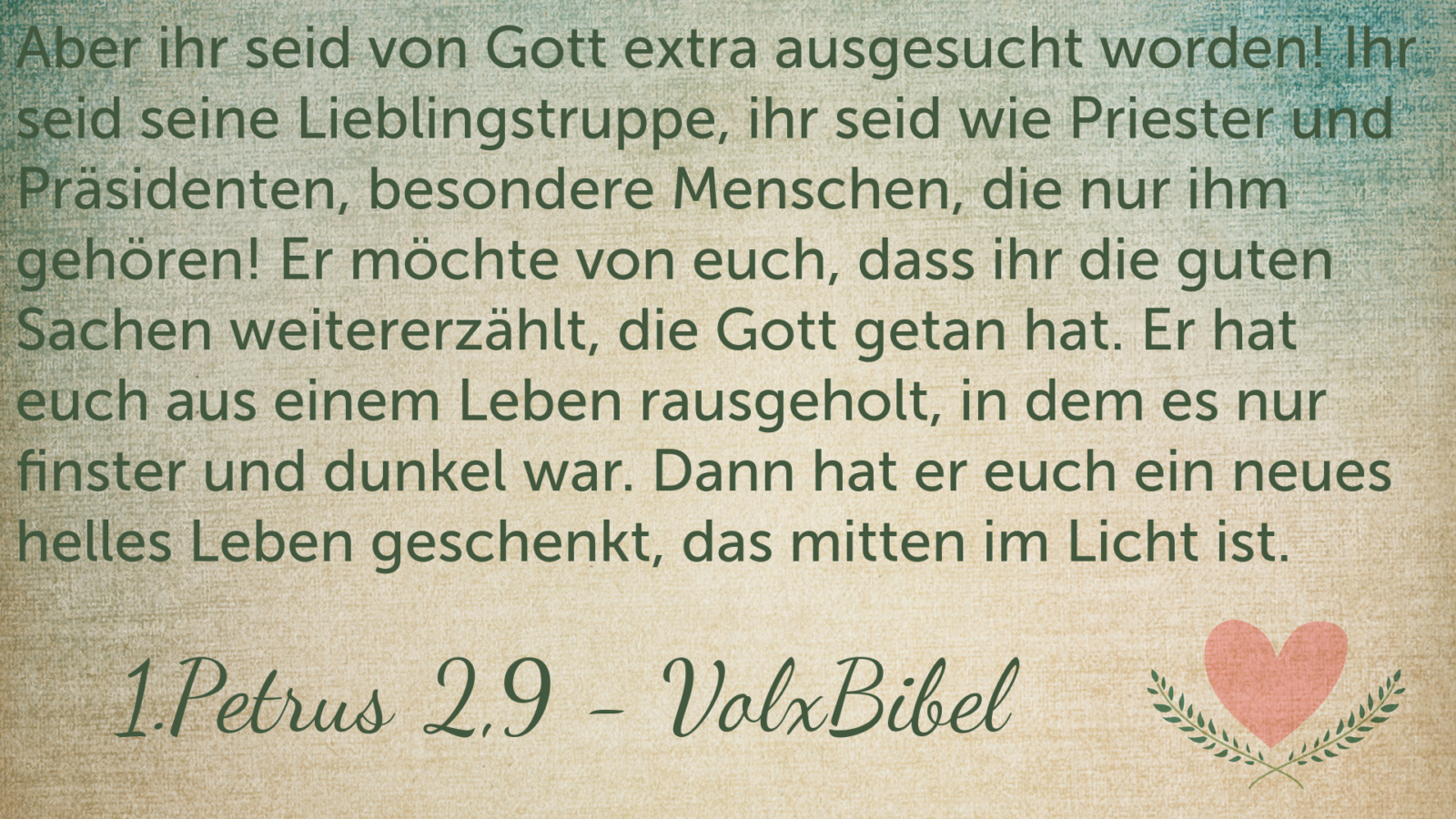
Petrus schließt diesen Abschnitt seines seelsorgerlichen Schreibens mit einer eindringlichen Mahnung an seine Leser, den Weg der Heiligung in die Praxis umzusetzen. Er erinnert sie nochmals daran, daß sie im Gegensatz zu den Ungehorsamen, deren Schicksal die Vernichtung ist, das auserwählte (eklekton; vgl. eklektois; 1 Petrus 1,1) Geschlecht sind. Auch hier knüpft er wieder an das Alte Testament, vor allem an die Aussage in Jes 43,20 ,an. Der Titel „auserwähltes Geschlecht“, der ursprünglich nur Israel gebührte, gilt nun den Heidenchristen ebenso wie den Judenchristen. Die Verantwortung, die einst allein auf der Nation Israel ruhte, ist jetzt, im Zeitalter der Gnade, auf die Kirche übertragen worden. Am Sinai trug Gott Mose auf, dem Volk zu verkünden: „Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein“ (2Mo 19,6).
Die Bibel erklärt und ausgelegt – Walvoord Bibelkommentar
Nun, im Kirchenzeitalter, werden die Gläubigen als königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums bezeichnet. Petrus gebraucht für die Christen den Begriff „heilige Priesterschaft“ (1 Petrus 2,5) und „königliche Priesterschaft“ ( 1 Petrus 2,9; vgl. Offb 1,6). Die Wendung „Volk des Eigentums“ ist eine freie Wiedergabe der griechischen Worte eis peripoiEsin, wörtlich „zur Bewahrung“ (vgl. auch Hebräer 10,39). Die Christen sind ein besonderes Volk, weil Gott sie für sich bewahrt hat. Die Beschreibung der Kirche ähnelt damit zwar derjenigen Israels im Alten Testament, doch es gibt keinerlei Anzeichen dafür, daß sie an die Stelle Israels getreten ist und die nationalen Verheißungen Israels, die im Tausendjährigen Reich erfüllt werden, auf sie übertragen wurden. Der Apostel gebraucht hier einfach ähnliche Begriffe für ähnliche Sachverhalte. So wie Israel „das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums“ war, so sind jetzt die Gläubigen „auserwählt“, haben priesterliche Funktionen, sind heilig und Gottes Eigentum. Doch Ähnlichkeit bedeutet noch nicht Gleichheit.
Gottes Plan in der Erwählung der Gläubigen zu seinem Volk ist es, daß sie verkündigen … die Wohltaten dessen, der sie berufen hat. Statt „Wohltaten“ könnte man auch „hervorragende Eigenschaften“, „außergewöhnliche Qualitäten“ oder „Tugenden“ (aretos; das Wort taucht nur viermal im Neuen Testament auf; Phil 4,8; 1 Petrus 2,9; 2 Petrus 1,3.5) schreiben. Die priesterlichen Gläubigen sollen so leben, daß das Wesen ihres himmlischen Vaters in ihrer Lebensführung zum Ausdruck kommt. Sie sollen die Herrlichkeit und Gnade Gottes bezeugen, der sie von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Petrus (1 Petrus 2,10) macht diesen Satz mit einem Zitat aus Hosea (1 Petrus 2,25) deutlich. „Finsternis“ ist ein Bild für die Zeit, in der die jetzigen Christen noch Heiden waren und nichts von Gottes Heilsplan wußten (vgl. Kol 1,13), als sie „nicht ein Volk“ waren und nicht in Gnaden lebten. Nun aber, wo sie in Gnaden sind, sind sie „Gottes Volk“ und erleuchtet von einem „wunderbaren Licht“. Die Praxis der Heiligung, in der das Volk Gottes als heilige und königliche Priesterschaft dient, seinem Herrn geistliche Opfer bringt und seine Herrlichkeit preist, ist die rechte Antwort auf die Gnade (vgl. 1 Petrus 1,13), die diesen Menschen zuteil wurde.
Der ganze Gegensatz zwischen Glaubenden und Unglaubenden wird noch einmal deutlich, wenn Petrus jetzt den Gemeinden ihren Stand vor Augen stellt, was sie wirklich sind durch und in Christus. Dabei wird das Wort »Volk« in dreifacher Ausprägung zur Kennzeichnung der Gemeinde des neuen Bundes gebraucht:
Edition C Bibelkommentar
a) »Ihr seid das auserwählte Geschlecht.« »Geschlecht« meint im Griechischen das Volk von seiner Abstammung her. Christen haben die gleiche Abstammung, den gleichen Vater, sind gezeugt aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes (vgl. 1,23). Das alles beinhaltet das Wort »auserwählt«.
b) »Ihr seid…das heilige Volk.« Das griechische Wort »Volk« bezeichnet Menschen der gleichen Zugehörigkeit, Kultur und Lebensweise. Die Christen sind »heilig«, abgesondert für den selben Herrn. Sie leben in der Heiligung, richten ihr ganzes Denken, Wollen und Handeln auf ihren Herrn Jesus Christus aus. Dabei sind sie Volk Gottes nicht als Volk unter anderen Völkerschaften. Sie sind »die königliche Priesterschaft«. Ihr Handeln und Sein ist nach oben, vertikal ausgerichtet. »Volk« meint hier keine soziologische Größe, sondern eine geistliche Größe. Christen sind »königlich«, denn sie sind Bürger des Königreiches Jesu Christi, das nicht »von dieser Welt ist« (vgl. Joh 18,36), sich aber in dieser Welt entfaltet und gebaut wird. Sie sind eine »Priesterschaft«, tun Priesterdienst, d. h. sie dienen vor Gott für die Welt in aufhaltender Fürbitte und stehen vor der Welt, um ihr Gottes Weisung und Evangelium anzusagen.
c) »Ihr seid das Volk des Eigentums.« Dieser griechische Begriff meint das Volk, das dieselben Ziele hat. Mit »Volk des Eigentums« (eigentlich »Volk zum Eigentum«) ist die Zielrichtung angegeben. Die Gemeinde ist unterwegs, um in Gottes Ewigkeit ganz mit ihrem Herrn vereint zu sein. Doch ist sie schon hier »Eigentum« Gottes, nämlich das Werk, das Jesus Christus »errettet« hat, freigekauft und damit für sich »erworben« hat (so die griechischen Wortbedeutungen). Für sie gilt: »Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein« (Jes 43,1).
Hinter diesen Kennzeichnungen der christlichen Gemeinde als »auserwähltes Geschlecht«, »heiliges Volk« und »Volk des Eigentums« stehen atl. Gottesworte an Israel (vgl. 2 Mo 19,5f; Jes 43,20f). Die Gemeinde des neuen Bundes tritt also mit in die Stellung Israels ein. Allerdings tritt sie nicht an Israels Stelle, denn das atl. Gottesvolk ist von Gott nicht verworfen, sondern bis zum Ende der Zeit zurückgestellt. Wir sind eingepfropfte Zweige am Baum Israel (so drückt es Paulus aus, vgl. Röm 11,17, 25f).
Das neue Gottesvolk steht im Dienst seines Herrn: »…daß ihr verkündigen sollt die Wohltaten.« Christen sind Zeugen ihres Herrn und rufen vor den Menschen die »Wohltaten« ihres Herrn einladend aus. Das griechische Wort »Wohltaten« kann mit »Herrlichkeit, Stärke, Machttat« wiedergegeben werden. Dahinter steht Jesaja 43,21, Israel soll Gottes Ruhm verkündigen. Und diese »Machttat« Gottes gipfelt eben darin, daß er uns »berufen hat von der Finsternis«. »Finsternis« ist der Zustand des »alten« Menschen, ist der »Schatten des Todes« (vgl. Ps 107,10; Jes 42,7; 58,10; 60,2; Mt 4,16; Lk 1,79; Joh 1,5; 8,12; 2 Kor 4,6; Eph 5,8; Kol 1,13; 1 Thes 5,4; 1 Jo 2,8, 11). Daraus hat Gott durch Jesus Christus – das Licht der Welt – uns herausgerufen »zu seinem wunderbaren Licht«, »wunderbar«, denn es ist und bleibt das Gotteswunder, daß Tote zum Leben kommen können, daß Finsternis hell werden kann, daß Menschen im Glauben an Jesus Christus gerettet werden für Zeit und Ewigkeit.
Im fünften Punkt schließt Petrus seine Diskussion zum Thema Jesus als Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses mit der Position des Überrestes ab und macht drei Beobachtungen.
Arnold Fruchtenbaum – Das Buch 1 Petrus
Die erste Beobachtung ist, dass es vier verschiedene Charakterisierungen der Position der jüdischen Gläubigen im Gegensatz zu Israel als Ganzes in Vers 9a gibt: Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum eigenen Besitz Gottes.
Erstens sind sie ein auserwähltes Volk, dies basiert auf Jesaja 43:20; zweitens sind sie ein königliches Priestertum, dies basiert auf Hebräer 7:1-28; drittens sind sie eine heilige Nation, dies basiert auf Exodus 19:6; und viertens sind sie ein Volk für Gottes eigenen Besitz, dies basiert auf Deuteronomium 7:6; 14:2; 26:18; Jesaja 43:21; und Maleachi 3:17.
Viele Lehrer nehmen diese Verse und wenden sie auf die Gemeinde als Ganzes an, aber das ist eine falsche Anwendung. Petrus schreibt hier speziell an jüdische Gläubige. Er sagt, dass Israel als Nation, Israel als Ganzes, versagt hat, aber die jüdischen Gläubigen haben nicht versagt. Die Gemeinde ist keine Rasse; sie setzt sich aus Mitgliedern aller verschiedenen Rassen zusammen. Die Gemeinde ist keine Nation; sie setzt sich aus Einzelpersonen aus jeder Nation zusammen; tatsächlich wird die Gemeinde in Römer 10,19 als keine Nation bezeichnet. Die Gemeinde ist keine Rasse, aber die jüdischen Gläubigen sind eine Rasse, und sie bilden das Israel Gottes. Also geht es in diesen Versen wieder um die Stellung und den Status der jüdischen Gläubigen im Gegensatz zu den jüdischen Ungläubigen.
Die zweite Beobachtung ist der Zweck der Berufung des Überrestes in Vers 9b: damit ihr die Vorzüge dessen zeigt, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
Der Hintergrund dieses Verses ist ein Verweis auf Jesaja 43:20-21. Das griechische Wort für „vorzeigen“ bedeutet „weithin bekannt machen“. Es bezieht sich auf die Verkündigung einer Botschaft an Außenstehende. Das unterstreicht ihre evangelistische Funktion: die Nachricht von Gottes Vorzügen oder Gottes Eigenschaften zu verbreiten. Er ist derjenige, der sie berufen hat, was sich auf den Punkt ihrer Errettung bezieht. Sie wurden aus der Finsternis, dem Reich des Satans, in sein wunderbares Licht, die Schechinah-Herrlichkeit, gerufen.

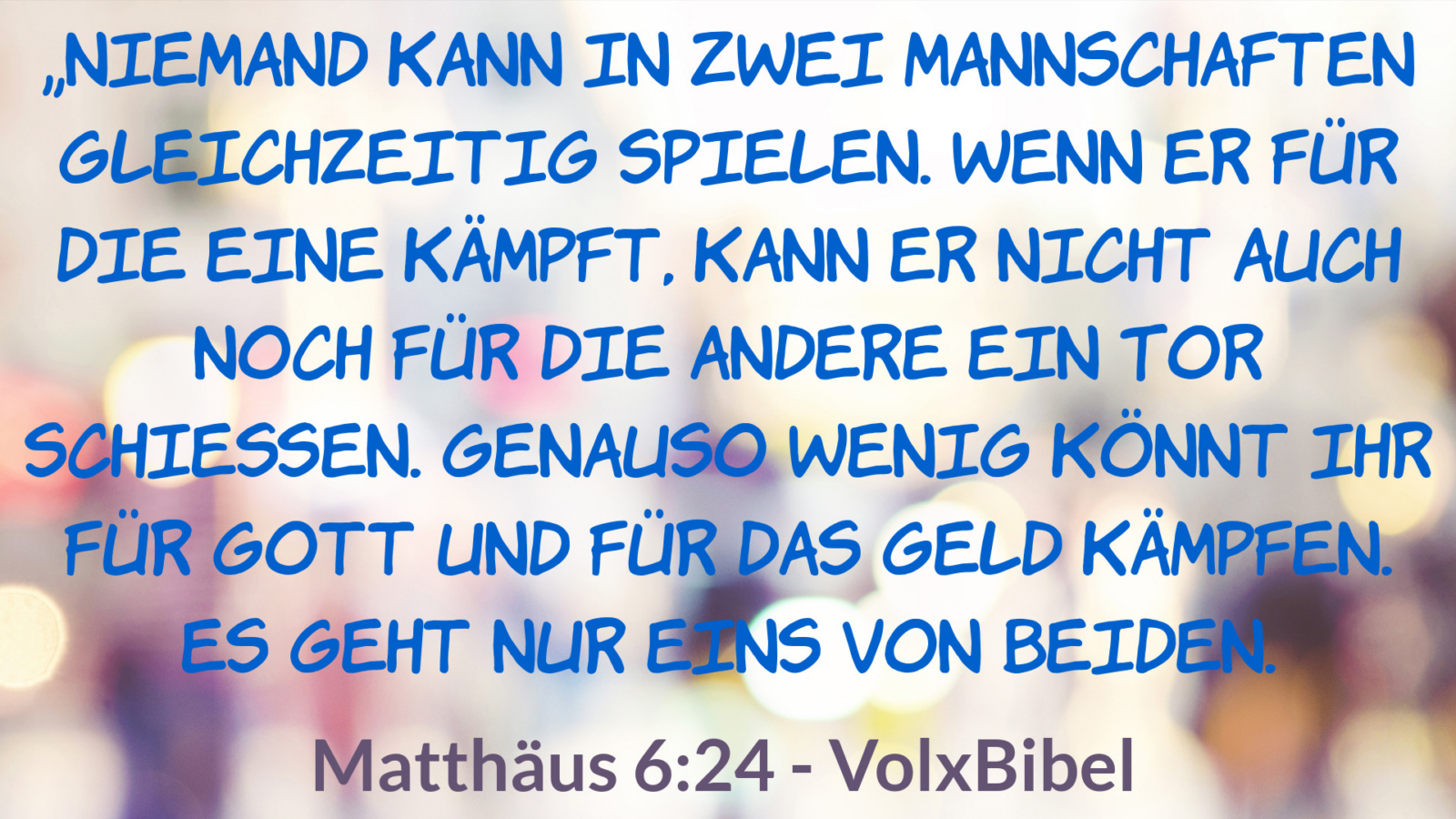
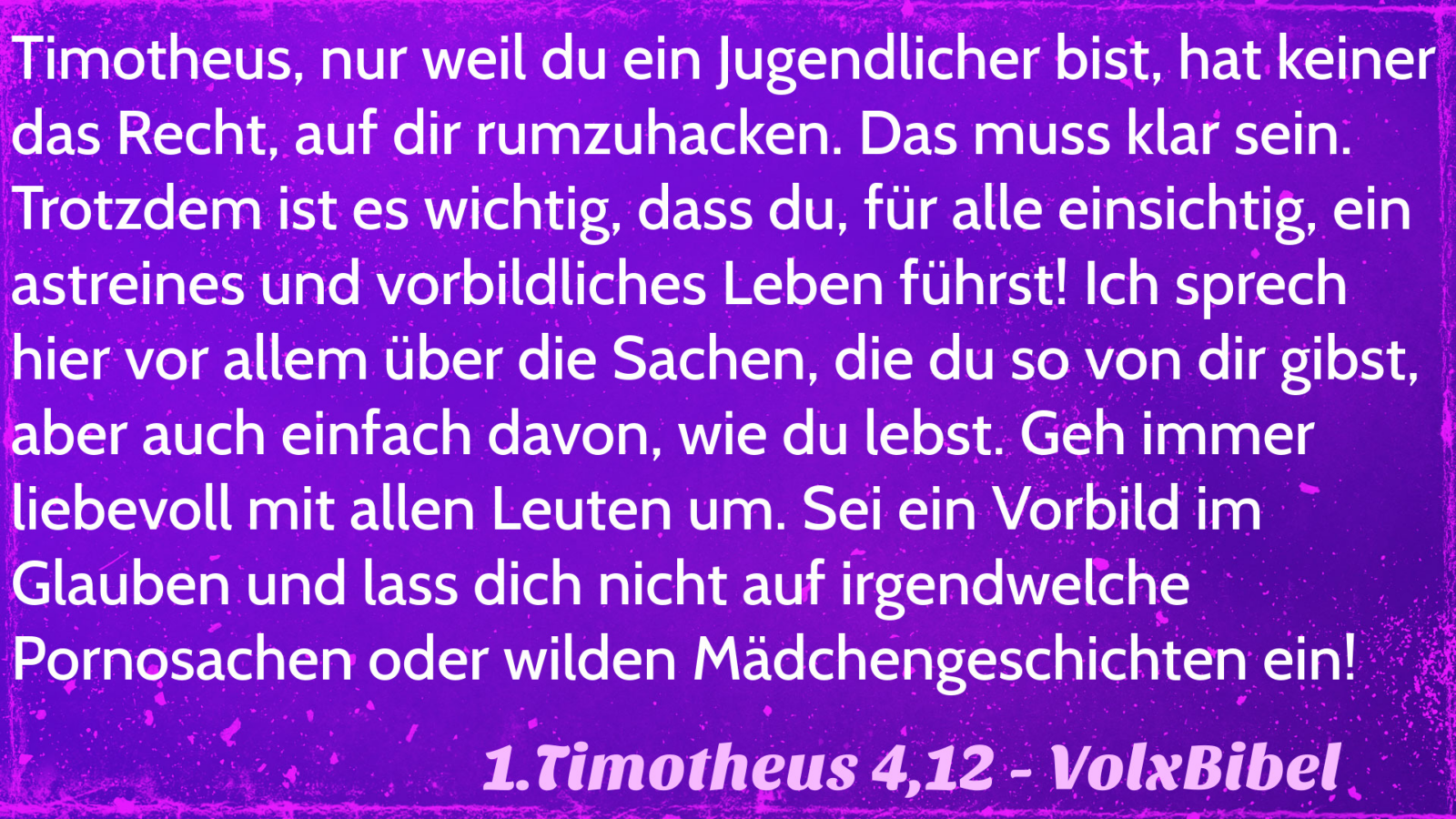
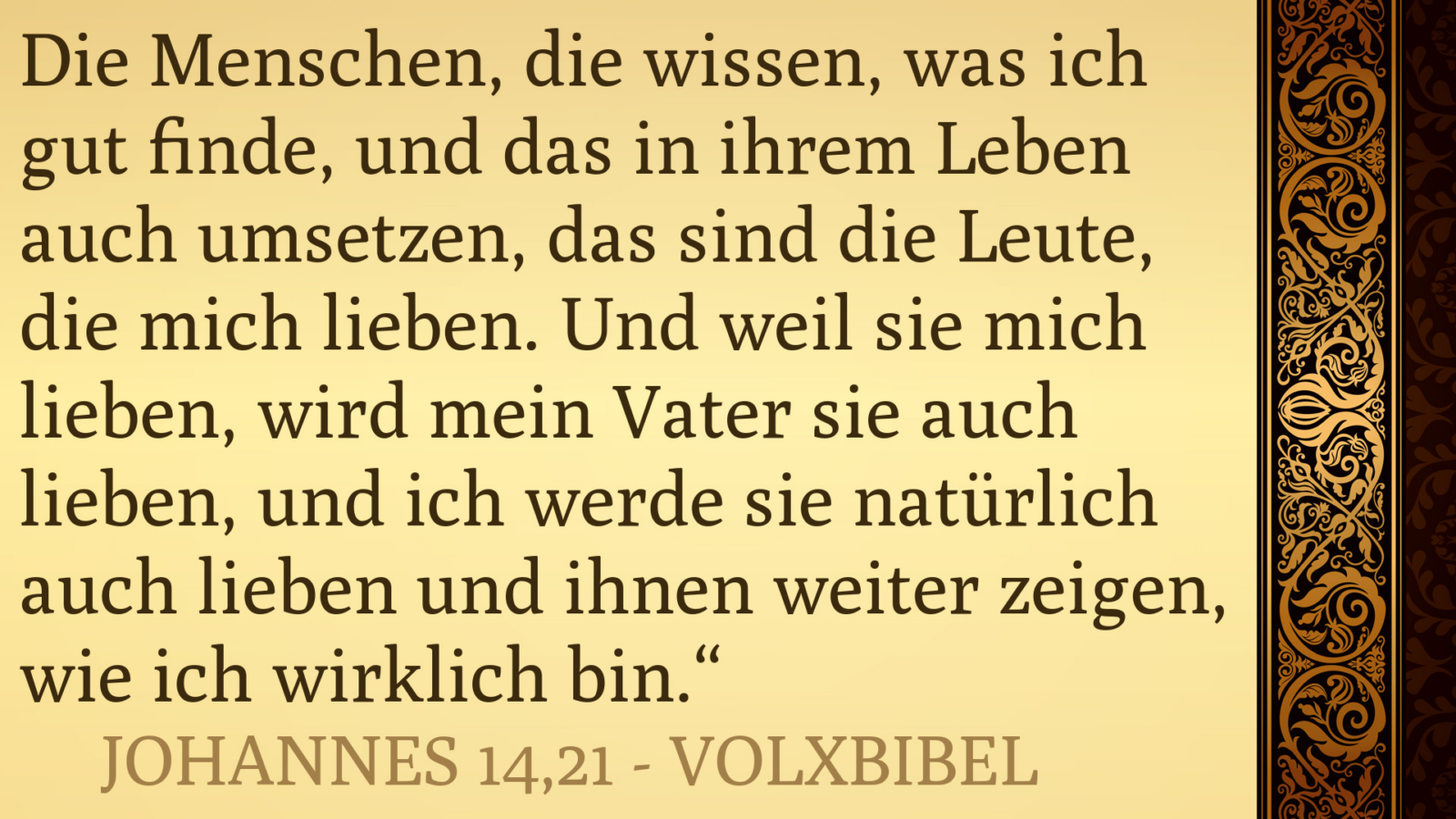
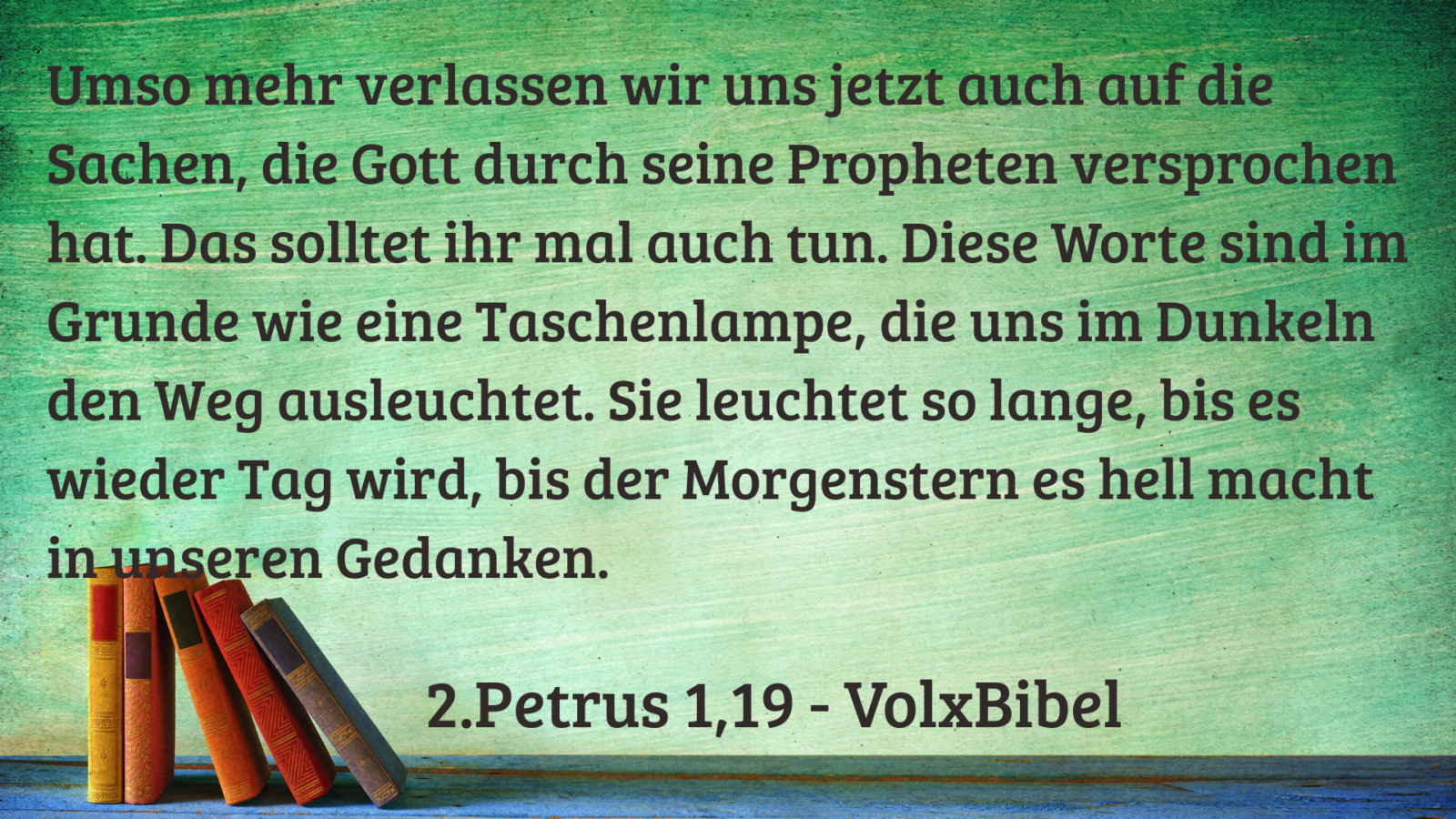
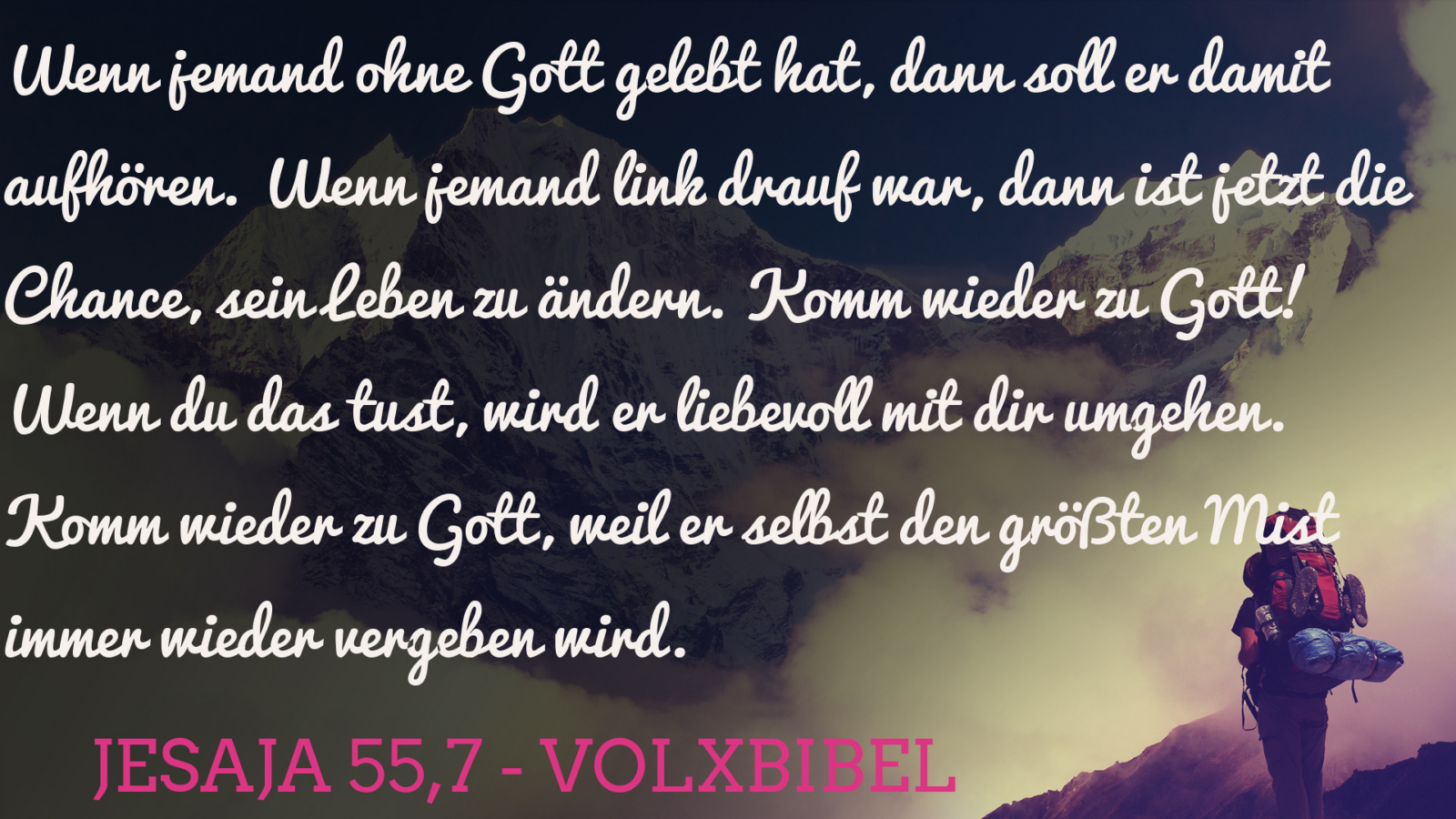
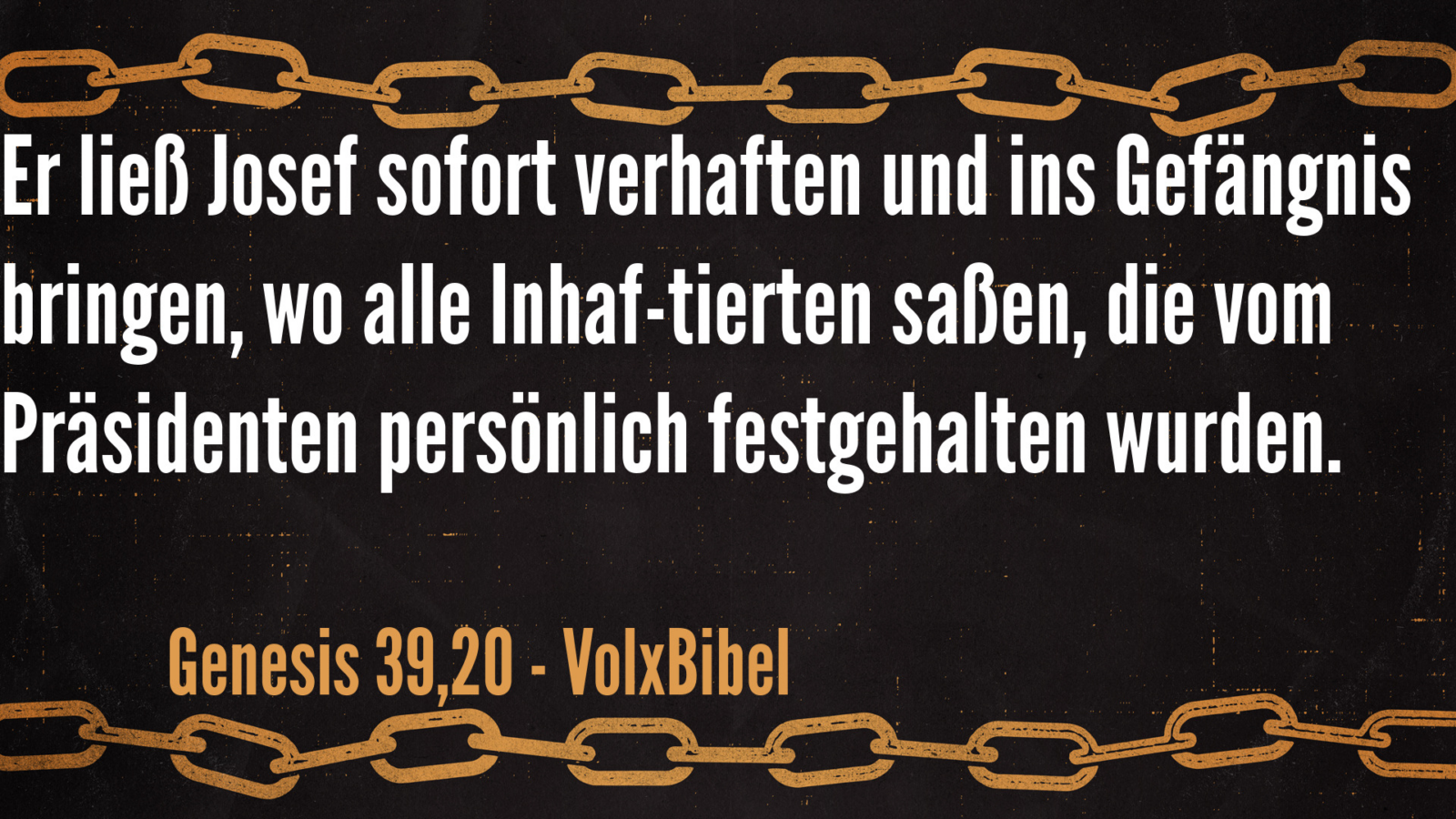
Neueste Kommentare