Habe gestern eine Broschüre gelesen, in der gesagt wird:
Natürlich sind alle Gebete gut, aber die Art von Gebet, die wirklich die Hand Gottes bewegt und die Situation verändert, muss aus einer tiefen Identifikation mit dem, für wen wir beten, kommen. Ich bin sicher, dass Ihr mir zustimmt, dass, wenn wir für eine persönliche Sache beten oder für etwas, was uns sehr nahe liegt, dann beten wir anders, als wenn wir für einen Fremden beten.
Da ist es wieder – die Frage, ob wir unseren Gott mit unseren Gebeten beeinflussen können. Echt Leute, denkt ihr, ihr könnt Jehovah so beeinflussen, wie euren Ehepartner, indem ihr ihm immer und immer wieder das selbe sagt, bis er genervt das tut, was ihr möchtet? Oder könnt ihr IHN gar mit euren Worten „verführen“ und „bezirzen“?
Nun habe ich heute einmal in den Nachschlagewerken nachgeschaut, was GEBET eigentlich ist – und ob das biblische Gebet etwas mit Magie und Beeinflussung zu tun hat. Ich würde ja einfach behaupten, dass unsere Gebete in erster Linie MEIN Denken auf Gottes Linie bringen sollte….
Aber schauen wir einmal was die üblichen deutschen Wörterbücher dazu sagen.
Beten
B. ist das Gegenteil aller Künste. B. können kommt nicht von religiösen Übungen
Beten ist nicht eine Kunst; man bedarf dazu nicht einer inneren Steigerung oder besonderer Übungen. Beten kann man erst, wenn man alle Künste abgelegt hat und zum Vater im Himmel spricht. „Wenn ihr betet, sollt ihr sprechen“ (Luk. 11, 2). Welcher menschliche Vater würde es dulden, daß sein Sohn, wenn er ein Anliegen an ihn hat, sich hinstellte und eine wohlgesetzte, tönende Rede hielte, statt einfach und natürlich mitzuteilen, was ihm nottut? Wie soll der Allmächtige es anhören, wenn Menschen mit verstellten Gebärden, mit gewählten Worten vor ihn treten? Alles religiöse Pathos, alle wohlgesetzten Wendungen beim Beten sind vom Übel, ein heidnischer Unfug (Matth. 6, 7). Um beten zu können, muß man nicht aufsteigen zu irgendeiner religiösen Höhenlage, sondern es gilt herabzusteigen von den Stelzen und da zu stehen, wo das kleinste Kind steht (Matth. 18, 3). Beten heißt: so, wie man ist und wie einem zumute ist, vor Gott stehen und zu ihm sprechen.
B. ist Menschenrecht
Das Recht zum Beten liegt in der göttlichen Abstammung des Menschen. „Sprecht: Unser Vater.“ Das heißt nicht, wir sollen es so ansehen, daß Gott für uns sorgt, als ob er unser Vater wäre. Jesus lehrt uns kein Als ob. Er erinnert uns daran, daß wir göttlichen Geschlechts, daß wir im Himmel zu Hause sind: denn unser Geist stammt aus dem Odem Gottes, unser Wesen ist dem seinen ähnlich. Es ist das Natürlichste von der Welt, daß wir uns dahin wenden, wo unsere Heimat ist, daß wir den anrufen, der uns das Leben gab.
Das echte B. sucht nicht Gaben, sondern den Geber
Es geht im Gebet zuletzt nicht um Gaben, sondern darum, daß wir dem Geber selbst nahe kommen. Die Gegenwart Gottes, das Hereinbrechen seines Lebens in unseres, das ist Sinn und Ziel allen Betens. Darum sagt Jesus: Beten sei so viel als Suchen (Luk. 11, 9. 10). Das klingt an das alte Wort an: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ Antlitz steht in der Bibel oft für Person. Wer ernstlich die persönliche Berührung mit dem Vater im Himmel sucht, der soll sie finden. Ein Kind sein und seinen Vater nie sehen, ist ein unhaltbarer Zustand, mit dem niemand sich abfinden sollte.
B. ist unbeirrbares Pochen an verschlossene Türen
Sucht man einen Ausweg aus diesem Zustand, so kann man freilich auf verschlossene Türen stoßen. Die Jünger sollten sich dadurch nicht abschrecken lassen, daß die Türen, die sie und ihre Zeitgenossen von der oberen Welt absperrten, seit Jahrhunderten verriegelt und eingerostet waren; sie sollten dennoch getrost und nachdrücklich an diese Türen pochen und nicht aufhören, bis sie einmal geöffnet würden. Das wird und muß geschehen – sagt Jesus, wenn nur die Ausdauer unbeirrbar bleibt, wenn die Betenden nur immer daran festhalten, daß das Öffnen jener Türen schlechthin notwendig ist (Luk. 11, 5-13).
Ralf Luther — Neutestamentliches Wörterbuch
schöner Gedanke: wir suchen im Gebet Jehovah! und nicht unsere Wünsche
Gebet
(ahd. beitten = bitten, auch zwängen, drängen, fordern) in allen Religionen Ausdruck der Hinwendung des Menschen zu Gott, indem der Mensch Gott anspricht: bittend, lobend, dankend, klagend. Das Gebet kann frei formuliert sein, aber auch Psalmen und Lieder verstehen sich als Gebete. Vorformulierte Gebete (z. B. das → Vaterunser) helfen, die eigenen Wünsche und Ängste in Worte zu fassen.
Kleines Lexikon zum Christentum
Gebet
Beten als Sprechen zu Gott und mit Gott ist ein religiöser Grundakt. Er setzt den Glauben an einen persönlichen Gott voraus: an Gott, der mich sieht und hört, der mich anspricht und mir antwortet und mit dem ich infolgedessen ins Gespräch kommen kann. Das ist beim Gott der Bibel der Fall. Er hat sich offenbart und seinen Namen kundgetan, damit der Mensch ihn anrufen und ansprechen kann (vgl. Ex 3,14 f mit Ex 20,24). Gebet im weiteren Sinn des Wortes ist jedes Sprechen mit Gott, auch das Loben und Danken; im engeren Sinn besteht das Gebet aus Klagen und Bitten. Die Bibel, für die der betende Mensch eine Selbstverständlichkeit ist und die in all ihren Teilen (nicht nur in den ➛ Psalmen) verschiedenartigste Gebete enthält, gebraucht dafür eine Vielzahl von Wörtern, die dem zwischenmenschlichen Bereich entnommen sind: bitten, flehen, fragen, klagen, rufen, schreien usw. Daneben begegnet im Hebräischen ein spezifisch religiöser Begriff für Gebet: tepilla. Das dazugehörige Tätigkeitswort hitpallel bedeutet an sich „eine Entscheidung fordern für“, „eintreten zugunsten von jemand“. Das weist auf einen wichtigen Sachverhalt: Das Gebet schlechthin war urspr. die ➛ Fürbitte, die eine dazu bes. befähigte und ermächtigte Mittlergestalt (v.a. der Prophet: Mose, Samuel, Jeremia; aber schon Abraham und dann auch der König) Gott vortrug. Dieses Gebet des Mittlers bildet gleichsam die Brücke zwischen den individuellen und den kollektiven Gebeten, je nachdem ob das betende Subjekt ein Ich oder ein Wir ist. Vor allem die individuellen Klage- und Bittgebete zeigen, worin das Wesen bibl. Betens besteht. Es vollzieht sich in drei Phasen:
Beten als Sich-Aussprechen vor Gott: Der Betende legt das, was ihn bedrängt und bedrückt, vertrauensvoll seinem Gott vor (vgl. 2 Kön 19,14–19); er schüttet vor ihm sein Herz und seine Sorgen aus (vgl. Ps 102,1).
Beten als Sich-Auseinandersetzen mit Gott: Der Betende ringt mit Gott, von dem er sich oft verlassen und verraten fühlt, um eine befreiende, Heil und Segen spendende Zuwendung (vgl. den nächtlichen Kampf Jakobs in Gen 32,23–33). So kann im NT „kämpfen“ geradezu zu einem Ausdruck für beten werden (im griech. Original in Röm 15,30; Kol 4,12; vgl. 2 Kor 10,4 und die „Agonie“ Jesu in Getsemani: Mt 26,36–46).
Beten als Sich-Ausliefern an Gott: Das Sich-Aussprechen vor Gott und das Sich-Auseinandersetzen mit ihm werden im Prozess des Gebets zum Sich-Ausliefern an Gott: Man ergibt sich ihm, sagt Ja zu dem, von dem man sich grundsätzlich als bejaht erfährt. So führen die bibl. Gebete aus der Klage zum Vertrauen und münden dann nicht selten in die Danksagung und den Lobpreis, der – im neu gewonnenen Glauben an Gottes Macht, Weisheit und Liebe – die Errettung, wie immer sie geschehen mag, als gewiss vorwegnimmt.
Beten ist demnach ein personaler Vollzug, in dem das Innerste des/der Betenden zur Sprache kommt. Doch aufgrund des bibl. Ganzheitsdenkens ist der ganze Mensch, also auch sein Körper, mitbeteiligt. Dabei gibt es verschiedene typische Gebetshaltungen: Man steht vor Gott (1 Sam 1,26), breitet die Hände aus (1 Kön 8,38.54; Jes 1,15) oder erhebt sie zum Himmel (Ps 141,2; vgl. 1 Tim 2,8); man demütigt sich, indem man niederkniet (1 Kön 8,54; Ps 95,6; Dan 6,11; vgl. Apg 9,40; 21,5) oder sich zu Boden wirft (Esra 10,1; vgl. Mk 14,35; ➛ Anbetung). Zum ganzheitlichen Vollzug gehört auch, dass das Gebet oft vom ➛ Fasten begleitet ist (Esra 8,23; Neh 1,4; Joël 1,14; 2,12–17; vgl. Lk 2,37; Apg 13,2 f; 14,23).
Grundsätzlich kann man überall beten, doch gibt es privilegierte Gebetsstätten. Dazu gehörte v.a. der Jerusalemer Tempel als der Ort, den JHWH sich erwählt hatte und wo sich der Einzelne in der Gemeinschaft des zum Gottesdienst versammelten Volkes aufgenommen wissen konnte (1 Kön 8,29 f.35.42.44.48; vgl. u.a. Apg 2,46). Er sollte zum „Haus des Gebets für alle Völker“ werden (Jes 56,7). In der Ferne pflegte man sich beim Beten Jerusalem zuzuwenden (1 Kön 8,48; Dan 6,11).
Wie man überall beten kann, so kann und soll man prinzipiell auch jederzeit beten. Doch zeigt bereits das AT, dass sich allmählich bestimmte Gebetszeiten herauskristallisierten, die dann auch für das christl. Stundengebet maßgebend werden sollten. Die Hauptgebetszeiten sind der Morgen und der Abend, d.h. die Zeit, in der im Tempel das tägliche Morgen- und Abendopfer dargebracht wurde, wodurch auch die anderweitig begrenzte Verbindung zwischen Gebet und Opfer hergestellt ist – eine Verbindung, die so weit ging, dass das Gebet geradezu an die Stelle des Opfers treten konnte (vgl. Ps 141,2). Neben dem zweimaligen ist auch das dreimalige Beten belegt: morgens, mittags und abends (Ps 55,18; Dan 6,11; vgl. Apg 10,9 sowie 3,1; 10,3.30: Gebet zur sechsten und neunten Stunde, d.h. mittags und am späten Nachmittag zur Zeit des Abendopfers). Dazu kommt, dass man gegebenenfalls auch des Nachts betete (Ps 119,62; vgl. Apg 16,25).
Als Juden haben Jesus und seine ersten Jünger diese Gebetsgepflogenheiten übernommen. Was Jesus selbst betrifft, steht nach dem Zeugnis der Evangelien fest, dass er ein großer Beter war. Besonders das Lukas evangelium betont dieses Faktum. Immer wieder zog er sich nachts oder frühmorgens an einen einsamen Ort zurück, um zu beten (Lk 5,16; 6,12; Mk 1,35; 6,46 par). Er betete vor wichtigen Entscheidungen (Lk 6,12–14; Mk 14,35 f par), und es war während des Gebets bei der Taufe im Jordan und bei der Verklärung auf dem Berg, als sich der Himmel öffnete und die Stimme des Vaters sich kundtat (Lk 3,21 und 9,29). Er betete für sich selbst in Getsemani und am Kreuz (vgl. neben den Evangelien Hebr 5,7), er betete aber auch für seine Apostel und Jünger (Lk 22,31 f; Joh 17). Dieses sein Gebet für uns setzt er als der Verherrlichte fort. Er ist und bleibt als unser „Hohepriester“ unser Fürsprecher beim Vater (Hebr 7,25 f; vgl. Röm 8,34 und 1 Joh 2,1).
Es war das beispielgebende Beten Jesu, das seine Jünger veranlasste, ihn zu bitten, er möge sie beten lehren (Lk 11,1). Jesus entsprach dieser Bitte, indem er ihnen das ➛ Vaterunser vorsprach, das die zentralen Gebetsanliegen enthält. Außerdem gab Jesus vom NT verschiedenenorts aufgegriffene und ausgeweitete Anweisungen, wie man beten soll. Sie gelten für alle Christen, ganz bes. aber für die Apostel, deren eigentliche und unteilbare Aufgabe das Ausharren „beim Gebet und beim Dienst am Wort“ ist (Apg 6,4). Vor allem soll das Gebet beständig und beharrlich sein. Es gilt, dass man „allezeit beten und darin nicht nachlassen“ soll (Lk 18,1; vgl. Lk 21,36), d.h. „ohne Unterlass“ (1 Thess 5,17), „jederzeit“ (Eph 6,18), „Tag und Nacht“ (1 Tim 5,5). Der Verwirklichung des Ideals des unablässigen Betens dienten bestimmte, teilweise vom Judentum übernommene Gebetszeiten, aus denen allmählich das kirchliche Stundengebet erwuchs. Man soll vertrauensvoll beten, d.h. im festen Glauben, um erhört zu werden (Mk 11,24 par sowie Jak 1,5–8; vgl. Mt 7,7 f par sowie 1 Joh 3,21 f; 5,14 f und Joh 14,13 f; 15,7; 16,23). Wie schon im Judentum die Bitten immer vom Lobpreis (beraka) eingerahmt sind, soll auch das christl. Gebet stets von der Danksagung (griech. eucharistia) getragen und bestimmt sein (vgl. Phil 4,6 sowie 1 Thess 5,17 f; 1 Tim 2,1). Obwohl der Einzelne sehr wohl „in seiner Kammer“ beten kann, kommt dem einmütigen Gebet in der Gemeinschaft doch bes. Wirkkraft zu (Mt 18,19; vgl. Apg 1,14). Das christl. Beten ist geistgewirkt (Röm 8,15 f.26; Gal 4,6; vgl. Eph 6,18): Es ist der Geist Christi, der uns befähigt und veranlasst, gleich ihm Gott mit ➛ Abba anzusprechen und anzurufen. Zum Gebet, das durch Christus im Heiligen Geist an den Vater gerichtet wird, trat schon in der frühen Christenheit das Gebet zu Jesus: Man bittet nicht nur in seinem Namen, sondern ihn selbst; und er ist es, der das Erbetene gewährt (Joh 14,13 f). Dieselbe Bitte, die Jesus am Kreuz an den Vater richtet, richtet Stephanus an den Herrn Jesus (vgl. Apg 7,59 mit Lk 23,46). Die Christen können geradezu „definiert“ werden als diejenigen, „die den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen“ (1 Kor 1,2; vgl. Apg 9,14), und die prophetische Verheißung, die im AT auf JHWH bezogen war, wird nun auf Christus gedeutet: „Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet“ (Apg 2,21; Röm 10,13; vgl. Joël 3,5). So mündet nicht nur die frühchristliche Liturgie, sondern das ganze NT (und mit ihm die ganze Bibel) in den (wie die Gebetsanrede Abba) in der aram. Sprache überlieferten flehentlichen Bittruf: Marana tha („Unser Herr, komm“: 1 Kor 16,22; Offb 22,20). nf
Herders Neues Bibellexikon
Beten, Gebet. 1) Das Gebet ist der unmittelbare Verkehr der Seele mit Gott und bildet daher den Höhepunkt unseres religiösen Lebens. Gewöhnlich hat es die Form des Redens mit Gott (Ps. 19, 15), doch gibt es gerade bei dem innigsten Gebetsleben Berührungen der Seele mit Gott, die, vom Geiste Gottes selbst hervorgerufen, sich nicht in menschliche Worte fassen lassen (Rö. 8, 26). Die innere Bedingung oder „die wirkliche und tätliche Ursache des Gebets ist allein der Glaube an ihm selbst“ (Luther). Der Unglaube betet nicht. Denn das Gebet setzt nicht nur ein Wissen von Gott voraus, sondern auch eine herzliche Bejahung des Grundverbältnisses der Abhängigkeit, in welches uns Gott zu sich selbst gestellt hat und in welchem wir ganz auf seine Lebensfülle angewiesen sind — also zum mindesten Erkenntnis und Anerkenntnis Gottes (Hbr. 11, 6). Das vollkommene Gebet aber hat zur Voraussetzung das durch Christum vermittelte Kindschaftsverhältnis (Joh. 16, 26. 27; Rö. 5, 2; 8, 15). — 2) Ist nun das Gebet ein solches Reden des Glaubens mit Gott, so muß auch sein Inhalt zunächst auf Gott selbst sich beziehen. „Der wahre Beter bittet vor allem um Gott selber“ (Martensen). Unsere Huldigung, unser Dank, unsere Bitte beschäftigt sich mit dem, was zur Gründung, Bewahrung, Förderung und Vollendung unserer Gemeinschaft mit Gott von ihm bisher getan worden ist und noch geschehen soll (Mt. 6, 9 ff. 33; Lu. 11, 13; Joh. 14, 16; Eph. 1, 17 ff.; 1 Kor. 15, 57; 1 Tim. 1, 12–17). Die geistlichen Lebensgüter sind der Natur der Sache nach ohne Gebet gar nicht zu gewinnen. Was zum äußeren Leben dient, gibt Gottes Güte und Langmut auch wohl ohne unser Gebet (Mt. 5, 45; Rö. 2, 4). Aber daß Gott auch hiefür gebeten sein will, zeigt die vierte Bitte im Gebet des Herrn. Mit allen Anliegen dürfen und sollen wir vor Gott kommen (Mt. 6, 25 ff.; 10, 30.31; Eph. 6, 18; Phi. 4, 6). Niemals aber können wir etwas erbitten, was mit dem Namen Jesu Christi, d. h. mit seiner Person, mit seinem Wort und Geiste streitet (Joh. 14, 13; 15, 7, vgl. Kol. 3, 17). — 3) Die Hauptformen, in welchen das Gespräch unseres Herzens mit Gott zum Ausdruck kommt, sind nach 1 Tim. 2, 1: Bittgebet, Lobgebet Fürbitte, Danksagung. Selten steht eine dieser Formeln für sich allein. Beispiele von Bitten um Rettung aus äußerer Not sind Ps. 3.4.5.7.42.54.70; Jes. 38, 10–20; Mt. 26, 39; 2 Kor. 12, 8; Jak. 5, 18. Bitten um Vergebung Ps. 6. 32. 38. 51. 102. 130. 143; Lu. 18, 13. Bitte um Grfüllung der Verheißungen 2 Sa. 7, 18 ff., um Weisheit 1 Kö. 3, 5–12, um seligen Hingang Ap. 7, 58, vgl. Lu. 23, 46. Aufforderungen zur Fürbitte stehen Mt. 5, 44; 9, 38; Rö. 15, 30; Eph. 6, 18.19; 2 Kor. 1, 11; Kol. 4, 3; 2 Th. 3, 1; Jak. 5, 14–16. Hervorragende Beispiele von Fürbitten sind im A. T. 1 Mo. 18, 23–32; 2 Mo. 17, 11; 32, 32; 33, 12. 13; 4 Mo. 14, 13–19; 1 Kö. 8; Jes. 37, 14 ff.; Da. 9; Esra 9. Beispiele von Fürbitten Jesu sind Mk. 7, 34; Lu. 22, 32; 23, 34, namentlich aber das Gebet des Herrn, Mt. 6, 9 ff., und das „hohepriesterliche“ Gebet um seine und seiner Jünger Verklärung, Job. 17. Seine fortwährende Fürbitte: Rö. 8, 34; 1 Joh. 2, 1; Hbr. 7, 25. Menschliche Fürbitte: Ap. 4, 24–30; 7, 59; 9, 40; 12, 5; 20, 32. 36; Rö. 10, 1; Eph. 1, 16 ff.; 3, 13 ff. Das Dankgebet, in welchem Gott für bestimmte Wohltaten gepriesen wird, geht häufig über in das Lobgebet, welches dem Wesen und Walten Gottes im allgemeinen gilt. Ps. 8. 9. 30. 33. 34. 65. 92. 100. 103. 104. 107. 118. 144–150; 2 Mo. 15; Ri. 5; Jes. 14, 25; Lu. 1, 46–55. 68–79; 2, 13.14; Mt. 11, 25; 14, 19; 26, 26. 30; Joh. 11, 41; Ap. 27, 35; Rö. 1, 8; 1 Kor. 1, 4; 2 Kor. 9, 11–15; Kol. 1, 12; 1 Tim. 1, 12. 17; 4, 4; 1 Pe. 1, 3. (Über das Beten mit Zungen, 1 Kor. 14, 13 ff. sieche Zungenreden.) — 4) Wie soll man beten? Bor allem warnt Jesus vor dem heuchlerischen Gebet, welches die Öffentlichkeit aufsucht, nur um den Schein großer Frömmigkeit zu erwecken, Mt. 6, 5; 23, 14. Ebenso verwirst er jene heidnische Geschwätzigkeit des Betens, welche durch die Menge der Worte Gott erst von unseren Nöten benachrichtigen u. durch Ermüdung ihn zur Erhörung zwingen zu müssen glaubt, Mt. 6, 7 f. Damit es ein Beten im Geist und in der Wahrheit sei (Joh. 4, 24) und nicht ein bloßes Werk der Lippen (Mt. 15, 8), tut äußere und innere Nüchternheit not, Lu. 21, 34; 1 Pe. 3, 7; 4, 8. Dazu dient das Fasten (Mt. 17, 21; vgl. 4, 2; Ap. 13, 2; 14, 23, vgl. 1 Kor. 7, 5) und die Einsamkeit (Mt. 6, 6; 14, 23; Mk. 1, 25; Lu. 6, 12; 9, 18). Angesichts der Majestät dessen, zu dem wir reden, muß das Gebet demütig sein (1 Mo. 18, 27; Mt. 8, 8; 26, 39). Dem Heiligen steht der Betende bußfertig gegenüber, mit entschiedener innerer und äußerer Abkehr von der Sünde (Ps. 66, 18; Jes. 1, 15; 59, 1–3; Lu. 18, 13; 1 Pe. 3, 12; 1 Tim. 2, 8; Jak. 4, 3; 5, 16). Die Liebe Gottes fordert Vertrauen (Ps. 55, 23; Mt. 8, 13; 17, 20; 21, 22; Lu. 5, 12; Jak. 1, 5–7). Wenn aber Gott mit der Antwort zu zögern scheint, so steigert sich die Bitte zum Ringen mit Gott in anhaltendem und dringendem Flehen (1 Mo. 32, 26; Mt. 7, 7; 15, 22–28; Mk. 10, 42; Lu. 11, 8; 18, 1–8; Rö. 12, 12; 2 Kor. 12, 8; 1 Tim. 5, 5, vgl. den Gebetskämpf Jesu in Gethsemane, Mt. 26, 44; Lu. 22, 44; Hbr. 5, 7). Das vollkommenste Gebet ist dasjenige, welches in dem Namen Jesu geschieht, d. h. nicht etwa nur mit äußerlicher Berufung auf ihn oder nach seinem Borbild oder auf seinen Befehl, sondern in innigster Einigung des Gläubigen mit dem erhöhten Christus. Dieses Gebet, welches nur die Verherrlichung des Vaters im Sohne bezweckt, ist der Erhörung unbedingt gewiß, ja, es bedarf sogar der Fürbitte Christi nicht mehr, weil der Geist Jesu Christi selbst es ist, der in uns betet (Joh. 14, 13–20; 15, 7; 1 Joh. 5, 14), besonders wichtig ist hiefür Joh. 16, 23–27, vgl. mit 16, 7.–5) Über die äußeren Umstände des Gebets sind weder im A. noch im N. T. bestimmte Vorschristen gegeben. Die das Gebet begleitenden Gebärden sind der sinnbildliche Ausdruck des Verhältnisses der Betenden zu ihrem Gott. Man betet stehend (1 Sa. 1, 9 u. 26; Lu. 18, 13) zum Zeichen der Dienstbereitschaft; knieend (1 Kö. 8, 54; Da. 6, 10; Ap. 20, 36; Eph. 3, 14; Phi. 2, 10) zum Zeichen der Demut, fällt wohl auch im tiefsten Gefühl der Unterwürfigkeit nieder zum Gebet (Ps. 95, 6, vgl. Mt. 4, 9; 26, 39; Off. 4, 10). Die Hände werden zum Himmel erhoben und ausgebreitet, wie zum Empfang der göttlichen Gaben bereit (2 Mo. 9, 29; 1 Kö. 8, 22; Ps. 123, 1; Jes. 1, 15; 1 Tim. 2, 8). Der Zöllner schlägt an seine Brust im Schmerz der Selbstanklage, er hebt seine Augen nicht auf aus Scham über seine Sünden (Lu. 18, 13). Das Händefalten kommt in der Bibel noch nicht vor, es ist die Gebärde der Huldigung gegenüber dem Sieger und hat sich erst seit der Bekehrung der germanischen Stämme in der christlichen Kirche eingebürgert. Als Ort des Gebets ist im A. T. der Tempel zu Jerusalem bevorzugt. David betet in der Richtung zum Hause des Herrn (Ps. 5, 8; 18, 7), zum Allerheiligsten als der Offenbarungsstätte Gottes (Ps. 28, 2, vgl. Ps. 121, 1, das Aufheben der Augen zu den Bergen Zions als zu dem Wohnsitz Gottes, von welchem aus die Hilfe kommt, Ps. 3, 5; 19, 7). Hiskia betet im Hause des Herrn (Jes. 37, 14). Daniel hat nach 1 Kö. 8, 38. 44. 48 offene Fenster gegen Jerusalem. Pharisäer und Zöllner beten im Tempelvorhof (Lu. 18, 10). Christus hat beim Gebet die Augen zum Himmel erhoben (Mk. 6, 41; 7, 34; Joh. 11, 41; 17, 1, vgl. Jak. 1, 17). Doch sind die Christen an keinen Gebetsort, an keine Gebetsrichtung gebunden (Joh. 4, 21. 23). Petrus und Johannes gehen noch in freiem Anschluß an die herrschende Sitte zum Gebet in den Tempel (Ap. 3, 1, vgl. 2, 46), aber schon vor Pfingsten hatten sich die Apostel im Söller (Obergemach) eines Privathauses zu gemeinsamem Gebet versammelt (Ap. 1, 13), das Haus der Maria ist als Vereinigungsort genannt, Ap. 12, 12. In Joppe betet Petrus aus dem Söller (Ap. 10, 9), um jeder Störung auszuweichen, wie Jesus die einsame Wüste aufgesucht hat (Mk. 1, 35) und die Bergeshöhe (Mt. 14, 23). Die gewöhnlichen Gebetszeiten sind der Morgen (Ps. 5, 4), der Mittag (Ap. 10, 9), der Abend (Ps. 4, 9; Esra 9, 5; Ap. 3, 1; Ps. 55, 18; Da. 6, 10). Jesus bleibt auch die Nacht über im Gebet (Lu. 6, 12, vgl. Ps. 6, 7). Die Mahnung, ohne Unterlaß zu beten (1 Th. 5, 17, vgl. Kol. 3, 17), zeigt, daß der Apostel das Gebetsleben nicht auf gewisse Stunden eingedämmt wissen will. — 6) Den Gebeten ist Erhörung verheißen (Ps. 50, 15; 145, 18; Jes. 55, 6; Jer. 29, 12; Mt. 7, 7 ff.). Jn Mt. 18, 19 ist es aber nicht die Zahl der Beter, welche das Gebet erhörlich macht, sondern nach 18, 20 der Name Jesu, auf den sie versammelt sind und zu welchem die gemeinsam Betenden einander hinleiten. Mk. 11, 24 ist nicht dem willkürlichen, möglicherweise recht fleischlichen, wenn auch noch so steifen Glauben die Erhörung zugesagt, sondern dem auf Jesu Namen begründeten und in ihm begrenzten Glaubensgebet (Joh. 14, 13). Da wir aber hinsichtlich dessen, was gut für uns ist, im einzelnen oft irren (Mt. 20, 22), so kann Gott unsere Gebetswünsche nicht immer buchstäblich erfüllen, sondern gewährt uns nur das, was nach seinem Rat gut für uns ist (Mt. 7, 11; Rö. 10, 13; 2 Kor. 12, 9; Jak. 1, 5. 17). Gegen die Möglichkeit der Erhörung ist eingewendet worden, es streite gegen die Würde Gottes, durch menschliche Einwirkung im Gebet sich irgendwie bestimmen zu lassen. Allein es ist Gottes anbetungswürdige freie Gnade, daß er den Handlungen der Menschen überhaupt, und ihren Gebeten insbesondere, einen gewissen Einfluß auf die Weltregierung gestatten will. Er hat ein gewisses Maß von menschlicher Freiheit von Anfang an in seinen Weltplan aufgenommen, und die Menschen bleiben ihm dafür verantwortlich, welchen Gebrauch sie von ihrer Freiheit machen wollen. Tun sie es, namentlich auch im Gebet, in der rechten Einigung mit dem Willen Gottes (vgl. oben 4) „im Namen Jesu“, so kann dies nicht zur Beeinträchtigung, Sondern nur zur Verherrlichung der göttl. Majestät gereichen. Wenn man ferner eingewendet hat, eine Gebetserhörung sei, wie jedes Wunder, unstatthaft, weil es eine Aufhebung des gesetzmäßigen Zusammenhangs der Natur in sich schließen würde, so stellen wir diesem Aberglauben an Unabänderlichkeit des Naturznsammenhangs gegenüber den Glauben an einen lebendigen Gott, welcher, nachdem er die Welt geschaffen hat, sich nicht dazu verurteilen läßt, ein müßiger Zuschauer des Naturlaufs und der Geschichte zu sein. Vielmehr hat er es seiner Weisheit und Macht Vorbehalten, teils mit neuen Schöpfungen, teils durch unmittelbares Einwirken auf schon Geschaffenes in den Lauf der Welt so einzugreifen, wie es zur Vollendung seines Weltplanes, zur Verherrlichung seines Namens, zum Kommen seines Reiches am dienlichsten ist. Beispiele von Gebetserhörungen sind: 2 Mo. 15, 25; 17, 11; 32, 14; 33, 17; 1 Sa. 1, 26–28; Ps. 34, 7; 65, 3; 118, 5; 1 Kö. 3, 11. 12; 18, 37. 38; Jes. 37, 15 ff.; 38, 5; Mk. 7, 34; Mt. 14, 19; Joh. 11, 41; 12, 28; Ap. 4, 31; 9, 40; 10, 31; 12, 5 u. 7; Jak. 5, 17. 18. Vgl. 2 Kor. 12, 8. 9; Lu. 22, 42. 43; Hbr. 5, 7.
Calwer Bibellexikon
Besonders spannend finde ich die Aussage in dem Ratgeber „Alles anders, aber wie?“, indem gezeigt wird, dass meine Gebete ganz viel über mich aussagen:
Wofür beten Sie regelmäßig? Welche Art von „Bedürfnissen“ beherrschen Ihre Gebete? Wie beten Sie für das, was sein könnte, während Sie sich mit dem beschäftigen, was ist? Ihre Gebete enthüllen Ihre Träume. lm Gebet sagen wir Gott, was wir nötig zu haben meinen. Wir bitten um das, was wir wollen.
Alles anders – aber wie?
Einen Gott, den ich mit vielen Worten beeinflussen müsste, ja sogar auf meine Seite ziehen könnte, ja sogar „seine Hand bewegen könnte“ – den mag es ja geben : aber dieser ist eben nicht der allmächtige Schöpfer Jehovah.
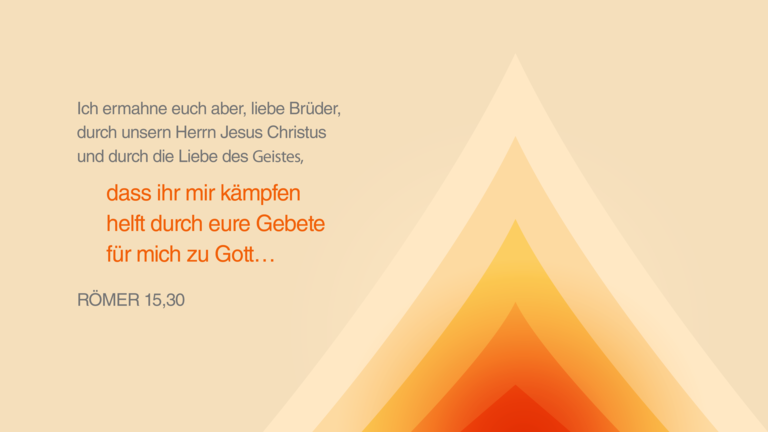

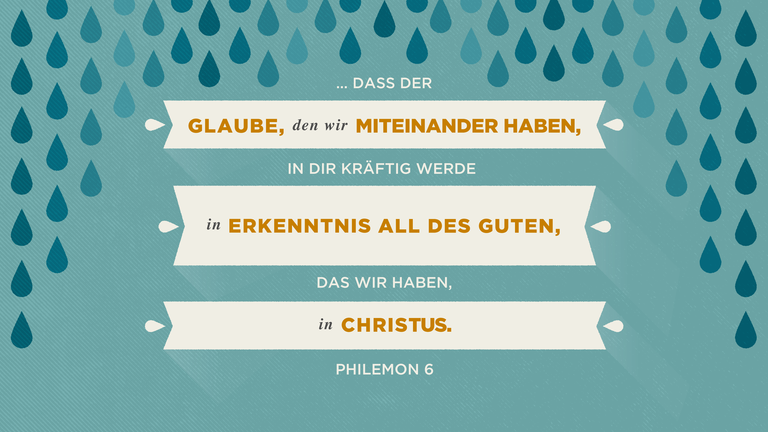
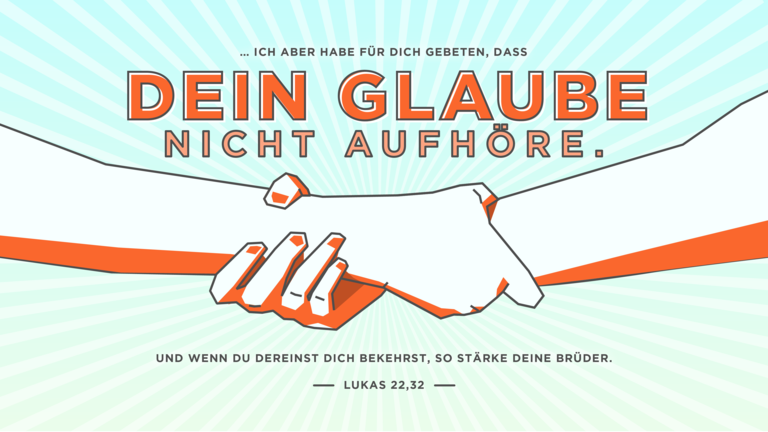
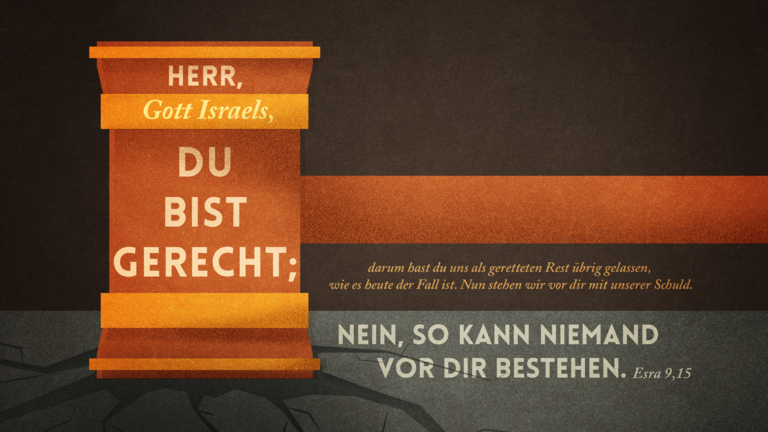
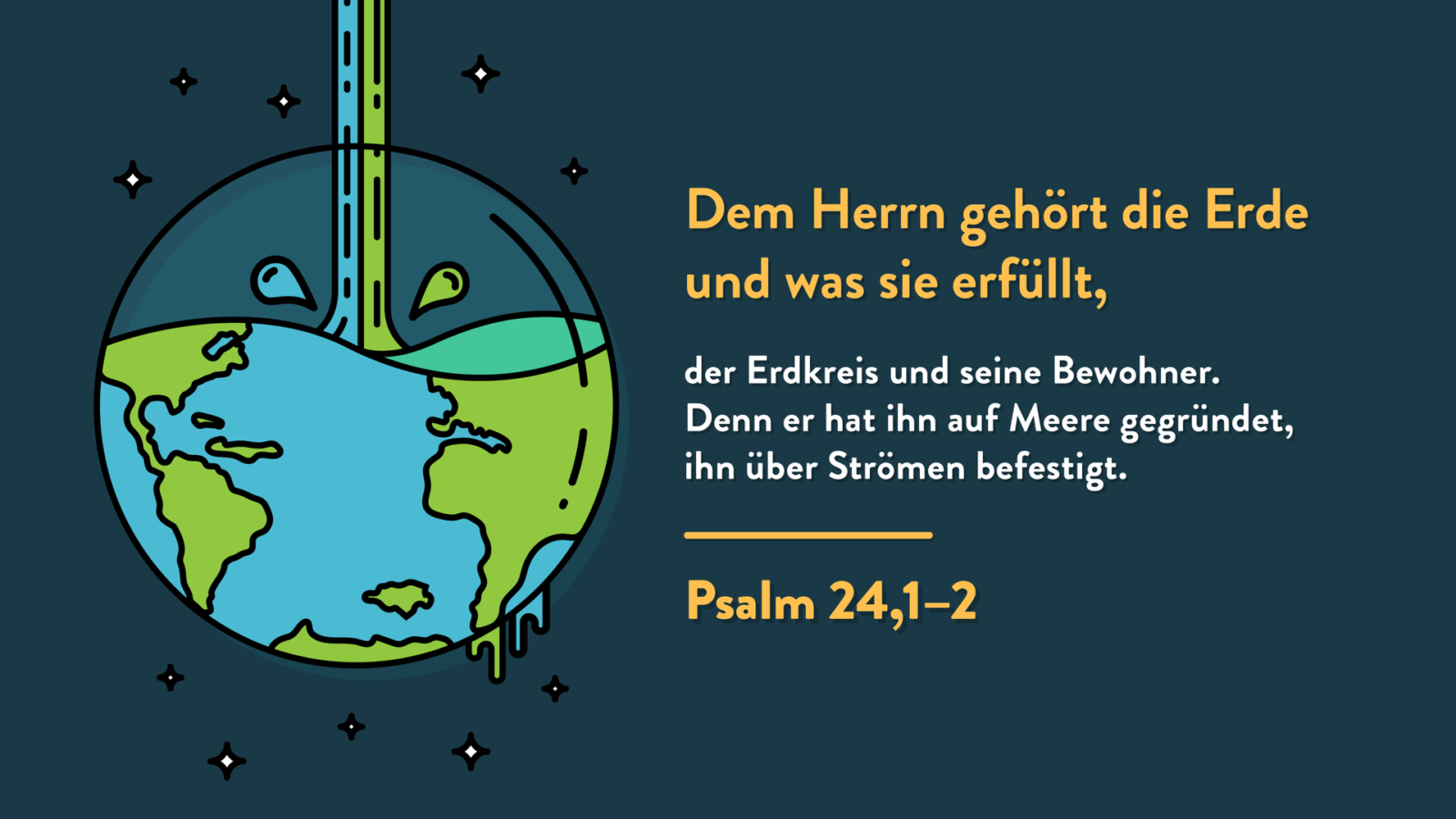
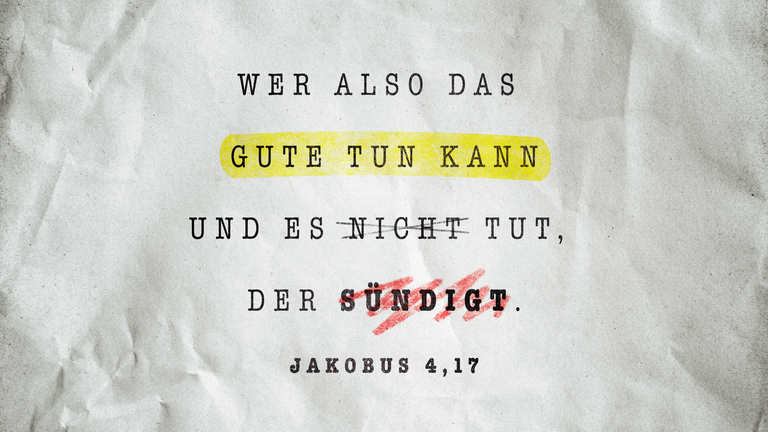
Neueste Kommentare