Der Geist Meines Oberherrn Jehova ist auf Mir; denn gesalbt hat (Drei-Einheit) Jehova Mich (28,16), mit Frohbotschaft zu evangelisieren Gebeugte; gesandt hat Er Mich, Verband anzulegen Herzzerbrochenen, auszurufen für Gefangene (Erlass) Loslassung und für Gebundene völligste Öffnung (für Ohr, Auge, Herz); auszurufen ein Wohlgefallensjahr (Jubeljahr) für Jehova und einen Tag der Satisfaktion für unsern Elohim, zu trösten alle Traurigen; festzusetzen den trauernden Zioniten, zu geben ihnen Kopfschmuck statt Asche (Hiob 42,6), Öl der hüpfenden Freude statt Trauer, (ein lebendiges Lob) Einhüllung in Lob statt eines verlöschenden Geistes (Sept. :statt eines Geistes der Akadie – Stumpfheit) und gerufen wird ihnen: Eichen der Gerechtigkeit, Pflanzung Jehovas zur Entfaltung Seiner Pracht.
Pfleiderer – Jesaja 61,1–3
Der Geist meines Oberherrn, Jehovah‘s, ist auf mir. Denn gesalbt hat mich Jehovah, die Frohbotschaft zu verkündigen Gebeugten; Gesandt hat Er mich, zu verbinden und einen Verband anzulegen den Herzzerbrochenen; auszurufen für Gefangene Freilassung (vergl. 3. Mose 25, 10) und für Gebundene Entfesselung und völligste Öffnung; Auszurufen ein Wohlgefallensjahr (vergl. 3. Mose 25, 13) für Jehovah, und einen Tag der Wiedergutmachung für unseren Schwur- und Bundesgott, zu trösten alle Traurigen; auf- und festzustellen die Traurigen Zions, zu geben ihnen Kopf- schmuck satt Asche, Öl der Freude statt Trauer, Einhüllung in Lob anstatt eines erlöschenden Geistes; Und gerufen wird ihnen: Eichen der Gerechtigkeit; Pflanzung Jehovah‘s zur Entfaltung Seiner Pracht.
Pfarrer Beck – Jesaja 61:1–3

weitere Bibelübersetzungen 2020
Jesaja 61,1-11 ist der letzte Abschnitt des Buches, der vom Knecht JHWHs spricht. Das Kapitel wird in vier Teilen besprochen. Einleitend weist Hindson darauf hin:
Unter den Gelehrten herrscht große Uneinigkeit über den historischen Kontext von Jes 61,1-11. Nahezu alle Gelehrten sind sich einig, dass Jes 61,1-3 von einem Mann verkündet wurde, der glaubte, Gott habe ihn gesalbt, um eine Heilsbotschaft zu verkünden. Einige sehen den Sprecher als Trito-Isaiah, der die Aufgabe von Deutero-Isaiah übernommen hat. Einige kritische Gelehrte siedeln den Schauplatz in der nachexilischen Ära zur Zeit Nehemias an und betonen die Notwendigkeit, die Wiederaufbaubemühungen der Heimkehrer wieder aufzunehmen. Andere betonen das befreiende Wirken des Herrn durch den Propheten. Wieder andere sehen den Sprecher als die kollektive Stimme der levitischen Gemeinde.
Diese Zusammenfassung der Auslegung des historischen Rahmens des Kapitels deckt die Meinungsverschiedenheiten unter den heidnischen Gelehrten ab. Viele Rabbiner sahen den Gesalbten dieses Abschnitts als den Propheten Jesaja. Das Folgende ist nur eine von vielen rabbinischen Erklärungen zu dieser Lehre:
L’MOSHCHAH BAHEM‘ (IN IHNEN GESALBT WERDEN). „L’moshchah bedeutet, durch sie zur Würde erhoben zu werden, denn der Begriff m’shichah (Salbung) wird manchmal im Sinne von ‚Autorität‘ verwendet… Vielleicht ist es so. Denn weil die Autorität in Israel denen gehörte, die gesalbt waren – dem König und dem Hohepriester – verwendeten sie den Begriff („Salbung“) metaphorisch für alle Arten von Autorität. Ähnlich verhält es sich, wenn es heißt: „Du sollst Hasael zum König über Aram salben … und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben“ (1 Könige 19,15-16). (Der Begriff „salben“ wird metaphorisch verwendet – „ernennen“ oder „bezeichnen“). Hier bedeutet l’moshchah bahem jedoch, dass die Hohepriester über ihren Söhnen mit den Kleidern gesalbt und geweiht werden, um die Opfer darzubringen. Ebenso bedeutet „l’moshchah“ (Numeri 18:8), dass ich sie (d. h. die priesterlichen Gaben) gegeben habe, weil ich sie (d.h. die priesterlichen Gaben) gegeben habe, weil ich dich gesalbt habe, um mir zu dienen… Vielleicht haben sie (die Propheten, die zur Zeit des Kyros lebten) das auch bei Kyros (dem König von Persien) getan, den sie wie die Könige Israels gesalbt haben, damit er weiß, dass es ein Prophet in Israel war, der prophezeit hat, dass er regieren wird, und (Generationen vor seiner Geburt) sogar seinen Namen ausgerufen hat, zur (Ehre) G-ttes. Deshalb sagte (Jesaja) zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, (Jesaja 45:1), worauf unsere Rabbiner kommentiert haben: (Megilla 12a) „Und war Kyrus der Gesalbte? usw.“ … Alle diese Verse sprechen also von einer echten Salbung. Der Vers, in dem es heißt: „Der Geist des Ewigen ruht auf mir; denn der Ewige ‚mashach‘ mich, dass ich den Demütigen eine frohe Botschaft bringe“ (Jesaja 61:1), ist jedoch eine Metapher, die den heiligen Geist, der auf dem Propheten ruhte, mit kostbarem Öl vergleicht, ähnlich dem, was gesagt wird: „Ein guter Name ist besser als kostbares Öl.“
Der beste Weg, das Kapitel zu interpretieren, ist, sich auf die Heilige Schrift selbst zu beziehen, und wie wir sehen werden, weist die „eigene Interpretation des Messias in Lk 4,17-21 eindeutig auf die messianische Bedeutung von Jes 61,1-2 hin.“ Außerdem lässt das Lukasevangelium keinen Zweifel daran, dass Jeschua „sich selbst als die Erfüllung der Prophezeiung Jesajas sah.“
a. Das erste Kommen: Die frohe Botschaft bringen – 61:1-2a
Die Verse 1-2a beschreiben das erste Kommen des Messias. Von den vier Arten messianischer Prophezeiungen in den hebräischen Schriften fällt diese in die dritte Kategorie. Zusammen mit den Versen 2b-3 verbindet sie das erste und das zweite Kommen zu einem Bild, ohne im Text selbst darauf hinzuweisen, dass die Ereignisse durch eine zeitliche Lücke getrennt sind. Während sich die Verse 1-2a nur mit dem ersten Kommen des Messias befassen, behandeln die Verse 2b-3 sein zweites Kommen.
Der Abschnitt beginnt in Vers 1a mit einem klaren Ausdruck der Dreieinigkeit der Gottheit: Der Geist des Herrn Jehova ist auf mir. Der hebräische Begriff für „Geist“ ist Ruach und bezieht sich auf Gott, den Heiligen Geist. Der hebräische Begriff für „Herr Jehova“ ist Adonai JHWH und bezieht sich auf Gott den Vater. Das Pronomen „ich“ bezieht sich auf den Knecht, Gott den Sohn. In diesem Vers sind Aussagen aus Jesaja 11,2; 42,1; 49,8 und 50,4-5 enthalten. Durch die Kombination der Informationen aus all diesen Abschnitten offenbart dieser Vers, dass der Geist JHWHs bei seinem ersten Kommen auf dem Knecht sein wird.
In den Versen 1b-2a werden fünf Gründe für die Salbung des Knechtes genannt:
1b Denn Jehova hat mich gesalbt, um den Sanftmütigen eine frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden und den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gebundenen die Öffnung des Gefängnisses 2a, um das Gnadenjahr Jehovas auszurufen.
Die hebräische Wurzel für „gesalbt“ ist mashach und kann als „messiahed“ übersetzt werden. Der Diener wurde gesalbt, um bestimmte Dinge zu tun. Erstens wurde der Knecht gesalbt, um den Sanftmütigen (oder Armen) eine gute Nachricht zu verkünden. Wie bereits in Jesaja 40,9 erwähnt, bedeutet die Wurzel des hebräischen Wortes für „frohe Botschaft“, basar, „Nachricht bringen“ oder „gute Nachricht überbringen“. Es ist das moderne hebräische Wort für „Evangelium“. Der Messias wurde gesalbt, damit er seinem Volk die gute Nachricht, das Evangelium, verkünden konnte.
Zweitens wurde er gesalbt, um die Menschen mit gebrochenem Herzen zu verbinden. Diejenigen, die zerbrochenen Herzens sind, leiden unter den inneren Folgen der Sünde, und das erste Kommen des Messias sollte sich mit diesem Problem befassen.
Drittens wurde der Knecht gesalbt, um den Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Die Gefangenschaft bezieht sich auf die äußere Erscheinungsform der Sünde, und bei seinem ersten Kommen würde sich der Messias auch mit diesem Thema befassen. Die Worte, die Jesaja hier verwendet, beschreiben an anderer Stelle das Sabbatjahr, in dem die jüdischen Sklaven freigelassen werden sollten (Lev. 25:8-55; Deut 15:1-18). Laut Jeremia 34:8-11 bestand eine der Sünden Israels darin, die jüdischen Sklaven im Sabbatjahr nicht freizulassen. Dieser Ungehorsam gegenüber dem mosaischen Gesetz führte dazu, dass die Juden in der Sünde versklavt wurden, und der Messias wurde gesalbt, um diesen Gefangenen die Freiheit zu verkünden.
Viertens wurde er auch gesalbt, um das Gefängnis für die Gefesselten zu öffnen und so die Gefangenen aus ihrer Versklavung an die Sünde, die Welt und den Teufel zu befreien.
Fünftens: Der Knecht wurde gesalbt, um das Jahr der Gunst Jehovas zu verkünden. Der hebräische Begriff für „verkünden“, qara, bedeutet auch „rufen“ oder „lesen“. In diesem Vers bezieht er sich auf die Ankündigung von etwas, das noch nicht begonnen hat, aber noch kommen wird. Der Messias wurde gesalbt, damit er das Jahr der Gunst JHWHs ankündigen konnte, bevor es begann. Der Ausdruck „Jahr der Gunst JHWHs“ bezieht sich auf das Jubeljahr (Lev. 25:8-38). Im Neuen Testament ist das Jahr der Gunst JHWHs die Gnadenzeit. Daher war die Ankündigung dieses besonderen Jahres die Verkündigung des kommenden Gnadenjahrs. Diese Ankündigung kam mit voller Wucht in Matthäus 13, wo der Messias die Verwirklichung des geheimnisvollen Reiches in diesem Zeitalter vorstellte.
Jeschua las Jesaja 61,1-2a in der Synagoge von Nazareth. Der Bericht ist in Lukas 4:16-19 zu finden:
16 Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie es seine Gewohnheit war, am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. 17 Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja vorgelegt. Und er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht: 18 Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen eine frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze, 19 damit ich das gute Jahr des Herrn verkünde.
Bis hierher hat Jeschua gelesen. Dann schloss er das Buch, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Als er ihre volle Aufmerksamkeit hatte, sagte er: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt worden (Lukas 4:21b). So erfahren wir von Jeschua selbst die richtige Auslegung von Jesaja 61,1-3: Nur die Verse 1-2a wurden bei seinem ersten Kommen erfüllt. Er wurde gesalbt, um in dieser Zeit fünf bestimmte Dinge zu tun, und wie die Evangelien zeigen, hat er genau das getan. Er kam, um das Evangelium zu verkünden und diejenigen, die an ihn glauben, aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Die restliche Prophezeiung aus Jesaja 61,1-3, die von der Wiederherstellung Israels spricht, wird sich erfüllen, wenn Jeschua wiederkommt.
b. Die Wiederkunft: Um Israel wiederherzustellen – 61:2b-3
In den Versen 2b-3 geht es um das zweite Kommen des Messias. Das Ziel dieses zweiten Kommens ist die Wiederherstellung Israels:
2b und den Tag der Rache unseres Gottes, um alle zu trösten, die trauern, 3 um denen, die in Zion trauern, einen Kranz für die Asche zu geben, Freudenöl für die Trauer, ein Gewand des Lobes für den Geist der Traurigkeit, damit sie Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, die Pflanzung des HERRN, damit er verherrlicht werde.
Dieser Abschnitt offenbart drei weitere Gründe für die Salbung des Knechtes. Erstens würde sie ihm ermöglichen, Gottes Tag der Rache zu verkünden. In Vers 2a heißt es abschließend, dass einer der Gründe für die Salbung des Knechtes darin bestand, dass er das Jahr der Gunst JHWHs, also die Gnadenzeit, verkünden konnte. Der Tag der Rache Gottes würde nach dieser Gnadenzeit kommen. Daher bezieht sich der Ausdruck „JHWHs Tag der Rache“ auf die Trübsal. Zweitens wurde der Knecht gesalbt, um alle zu trösten, die trauern, und das wird er bei seinem zweiten Kommen tun. Drittens wurde er gesalbt, um denen, die in Zion trauern, das messianische Reich zu verschaffen. Kombiniert man die fünf Gründe in den Versen 1-2a mit den drei Gründen in den Versen 2b-3a, wird deutlich, dass der Gottesknecht gesalbt oder „messianisch“ war, um acht Dinge zu tun.
Der Abschnitt endet mit Informationen über das zukünftige Königreich, das der Knecht Zion einsetzen wird. In diesem Reich wird der Messias Zion einen Kranz für die Asche geben. Er wird ihre Asche durch Schönheit ersetzen. Er wird dem jüdischen Volk das Öl der Freude für die Trauer geben. Ein ähnlicher Ausdruck wird im messianischen Psalm 45 verwendet, wo der Messias mit dem Öl der Freude gesalbt wird: Du hast die Gerechtigkeit geliebt und die Schlechtigkeit gehasst: Darum hat Gott, dein Gott, dich mit dem Öl der Freude gesalbt, das dich von deinen Mitmenschen unterscheidet (Ps 45,7). Darüber hinaus wird der Messias den Geist der Schwere mit dem Gewand des Lobes bekleiden, d. h. er wird den hängenden Geist Zions durch ein Gewand des Glanzes ersetzen.
Der Messias wird all diese Dinge tun, damit Israel die Bäume der Gerechtigkeit genannt wird, die Pflanzung Jehovas, und damit er selbst verherrlicht wird. Diese Aussagen erfüllen eine Verheißung, die JHWH in Jesaja 60:21 gemacht hat: Auch dein Volk soll ganz gerecht sein; sie sollen das Land für immer erben, der Zweig meiner Pflanzung, das Werk meiner Hände, damit ich verherrlicht werde. Israels Einsetzung in das messianische Reich wurde in Jesaja 60 verheißen. Jesaja 61,3 offenbart nun die Mittel, mit denen diese Verheißungen erfüllt werden sollen: Sie werden durch das Programm des Knechtes JHWHs erfüllt, das heißt, sie werden durch das erste und zweite Kommen des Messias verwirklicht.
In der rabbinischen Theologie wird Vers 3 auch dem Messias zugeschrieben. Laut Yerushalmi verlor das jüdische Volk seine Verbindung zu Gott, als sowohl der Tempel als auch die Prophezeiung zerstört wurden. Israel verlor seine Unabhängigkeit und seinen Reichtum und wurde zur Zielscheibe von Spott und Verachtung. Gott wird jedoch die Kronen des jüdischen Volkes (d. h. den Tempel und die Prophezeiung) wiederherstellen. Durch den Messias wird es seine Unabhängigkeit zurückgewinnen, und er wird mit dem Öl der Freude gesalbt werden. Ihre Verachtung wird durch Bewunderung ersetzt, und die Völker werden sie loben. Geistig werden sie hoch wachsen, als wären sie von Gott gepflanzte Terebinthen.
Arnold Fruchtenbaum – Bibelkomentar Jesaja
In Vers 1 werden alle drei Personen der Dreieinigkeit erwähnt: der Geist, der Herr und der Messias . Aus drei Gründen bezieht sich das mich hier auf den Messias (1) Die Verbindung zwischen der Salbung und dem Heiligen Geist weist auf den Messias hin. Die beiden ersten Könige Israels, Saul und David, wurden nach ihrer Salbung mit Öl durch den Heiligen Geist gesegnet ( 1Sam 10,1.10; Jes 16,13 ). Auch Christus wurde in ähnlicher Weise durch den Heiligen Geist zum König Israels gesalbt ( Mt 3,16-17 ). Das hebräische Wort für Messias ( mASIaH ) bedeutet „der Gesalbte“, und Christus ( christos , von chriO , „salben“) ist die griechische Entsprechung von mASIaH . (2) Ein Teil dieses Abschnittes wurde von Jesus vorgelesen ( Lk 4,18-19 ) und auf sich selbst gedeutet. (3) Die Aufgabe dieses Gesalbten ist die gleiche, die auch Jesus hatte: gute Botschaft zu bringen , zu heilen und zu befreien ( Jes 61,1 ; vgl. Jes 42,7 ), zu verkündigen ein gnädiges Jahr und Vergeltung ( Jes 61,2 ) und zu trösten (V. 2 – 3 ). Als Jesus diese Stelle vorlas, hörte er in der Mitte nach den Worten „ein gnädiges Jahr“ plötzlich auf ( Lk 4,18-19 ). Auf diese Weise zeigte er, daß sein Werk auf zwei Erscheinungen aufgeteilt ist. Bei seinem ersten Kommen war seine Aufgabe, die Dinge zu erfüllen, die in Jes 61,1-2 a stehen. Bei seinem zweiten Advent wird er tun, was in Vers 2 b – 3 ausgesagt ist. Wenn er wiederkommt, wird er das Gericht über die Ungläubigen bringen ( Mi 5,14; Offb 19,15-20 ). Dies wird ein Tag der Vergeltung Gottes sein (vgl. Jes 34,8; 35,4; 63,4 ). Aber der Messias wird auch Israel „trösten“, weil es in den Jahren zuvor, der großen Trübsal, schwere Bedrängnis erlebt haben wird (vgl. Dan 7,21.24-25; Offb 12,13-17 )
Walvoord-Bibelkommentar
Wenn der Messias kommt, wird er die Traurigkeit Israels in Freude verwandeln, was Jesaja mehrfach betont. Dort, wo man sich Asche als Zeichen der Trauer auf das Haupt geschüttet hatte (vgl. 2Sam 13,19; Dan 9,3 ), wird man nun eine Krone tragen. Sanftes Olivenöl , auf Gesicht und Haar aufgetragen, wird die Schmerzen lindern und innerlich aufrichten (vgl. Ps 23,5; 45,8; 104,15; Pred 9,8; Mt 6,17; Hebr 1,9 ) und so das Trauern beenden. Ein weiteres Zeichen der Freude ist helle, freundliche Kleidung (vgl. Pred 9,7-8 ). Israel wird gerecht sein (vgl. Jes 54,14; 58,8; 60,21; 62,1-2 ). Wie mächtige Eichenbäume werden sie die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln (vgl. 35, 2; Jes 46,13; 49,3; 55,5; 60,9.21; 62,3 ).

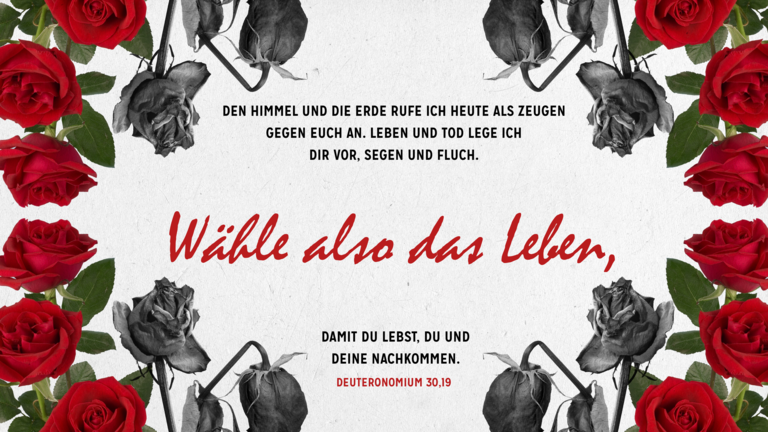
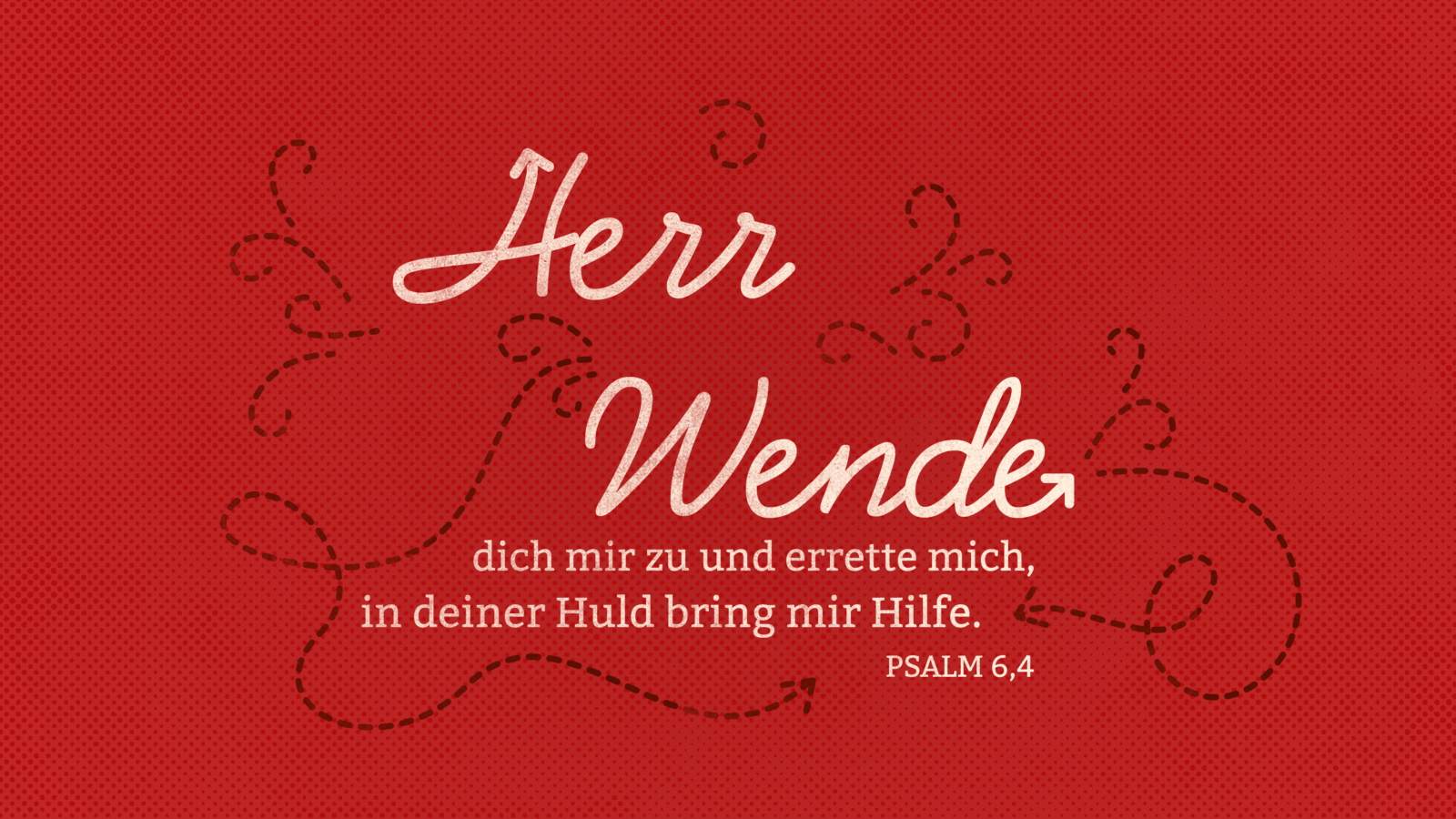


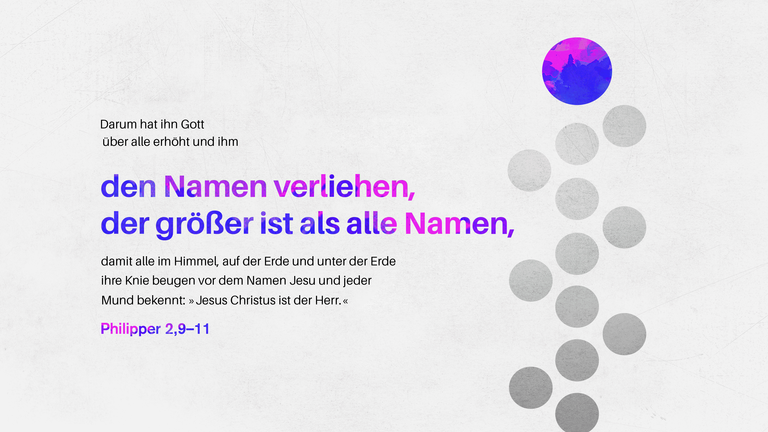

Neueste Kommentare