Laßt eure Gelindigkeit (O. Nachgebigkeit, Milde) kundwerden allen Menschen; der Herr ist nahe.
Elberfelder 1871 – Philipper 4,5
Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald!
Gute Nachricht Bibel 2000 – Philipper 4:5
Verhaltet euch so, dass alle Menschen erkennen, wie liebevoll ihr mit anderen umgeht! Jesus, der Herr, ist ganz nahe!
Roland Werner – Das Buch – 2009 – Phil 4,5
Laßt eure Vernünftigkeit allen Menschen bekanntwerden. Der Herr ist nahe.
neue Welt Übersetzung – Bi12 – Phil 4:5

» Gelindigkeit « , epieikes, (hier wörtlich: Das Gelinde). » Gelinde « zu sein, ist eine der Anforderungen an den Charakter eines Ältesten (1.Tim 3,3). Das soll nach Tit 3,2 jeden Glaubenden kennzeichnen und ist nach Jak 3,17 ein Merkmal der Weisheit, die von oben kommt. Wo es um das Wort Gottes geht, dürfen wir keinerlei Kompromißbereitschaft zeigen (Gal 2,5). Aus dem Thema dieses Briefes wird aber auch deutlich, daß die Haltung der Gläubigen zu Uneinigkeit und Streit führen kann (siehe 2,3). Das hier gebrauchte Wort ist das Gegenteil von Selbstsucht und Streitsucht; es führt zu einem Benehmen, das von allen wahrgenommen werden kann.
Benedikt Peters . Was die Bibel lehrt
Die Wendung oder Herr ist nahe « kann bedeuten, daß der Herr allezeit nahe ist (Ps 119,151). Bedenken wir aber, daß der Apostel eben vom Kommen des Herrn gesprochen hat (3,20), dann mag er auch an dessen Wiederkunft gedacht haben (Röm 13,11; Hebräer 10,37; Jak 5,8).
Eure Nachgiebigkeit sollen alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Es wird der Gemeinde erleichtert, gegen niemand hart zu sein und mit niemand zu streiten, sondern allen den Frieden anzubieten und gegen alle freundlich zu sein, wenn sie bedenkt, daß sie bald vor dem Herrn stehen wird. Das nimmt ihr die Sorge, sie schädige sich durch ihre Freundlichkeit. Der Herr, der alles richtet und in allen Verhältnissen die ganze Gerechtigkeit wirkt, tritt bald hervor. Das macht zugleich, daß sie sich vor ihrem Zorn fürchtet, weil der Herr von denen zu fürchten ist, die nicht verzeihen, sondern an den anderen als die Richter handeln.
Schlatters Erläuterungen zum Neuen Testament
Eure Lindigkeit lasset kund werden (Philipper 4, 5)
Georg R. Brinke – Skizzen über den Philipperbrief
Je größer beim Gläubigen die Freude am Herrn ist, desto mehr wird die Umgebung das erfahren. Es ist so, wie schon David gesungen hat: „Viele werden es sehen“. (Psalm 40, 3). Beim Psalmisten hat es nie an der Lindigkeit gefehlt, er ließ sie Freund und Feind erfahren.
I. Ein beachtenswertes Gebot.
„Eure Lindigkeit lasset kund werden.“ Es genügt nicht nur, dass wir uns des Herrn, Seiner Vergebung und Seines Friedens freuen, sondern die Früchte dieser reichen Segnungen sollen sich auch auf andere übertragen. Beachten wir einiges, was die Schrift darüber sagt.
Gläubige sind nicht allein gerettet, um selig zu werden, sie sind auch geschaffen zu guten Werken. Untätig zu sein als Christ, hieße eine göttliche Bestimmung auf Erden versäumen (Epheser 2, 10). Denken wir an den Herrn selbst; wie reich war doch Sein Leben an guten Werken (Johannes 10, 32; Apostelgeschichte 10, 38)! Petrus, der den Herrn beobachten konnte, sagt, dass Er einherging und Gutes tat. Und weil der Herr, unser Vorbild, so reich an guten Werken war und allen Menschen seine Lindigkeit widerfahren ließ, so sollen auch wir desgleichen tun (1 Timotheus 6, 18). Gerade dafür hat der Herr uns gerettet, losgekauft, dass wir ein Volk seien, eifrig in guten Werken (Titus 2, 14), und das nicht nur gelegentlich und notgedrungen; vielmehr sollen wir im Gutestun nie ermatten. Durch unsern Eifer reizen wir andere an, wie in Hebräer 10, 24 so deutlich und schön geschrieben steht: „Einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken.“ In guten Werken sollen besonders die Hirten mit dem Beispiel vorangehen und die Herde ermuntern.
Der Endzweck des Ganzen ist die Verherrlichung des Herrn (Matthäus 5, 16; Johannes 15, 8; 1 Petrus 2, 12). Wie wurde z. B. der Herr durch die guten Werke der Dorkas verherrlicht. Wahrlich, sie hatte ihre Lindigkeit vielen kund werden lassen und so wurde sie sehr vermisst, als sie plötzlich heimging (Apostelgeschichte 9, 36). Ihre guten Werke und die darauffolgende Auferstehung aus den Toten wurden in weiter Umgebung bekannt, und viele wurden dadurch veranlasst, den Herrn zu suchen.
II. An wem sollen wir das Gebot der Lindigkeit erfüllen?
An allen Menschen! Doch wer ist damit gemeint? In erster Linie die Glaubensgenossen (Galater 6, 10). Paulus befiehlt, dass wir zu allermeist den Glaubensgenossen Gutes tun sollen. Das ist vor allem andern das Missionswerk; denn wir sollen derer gedenken, die für den Namen des Herrn ausgegangen sind, um Seinen Namen zu predigen. Wir sind verpflichtet, ihnen zu dienen (3 Johannes 8). Gläubige, die das nicht regelmäßig tun, versäumen viel, ja, sie laden sogar Schuld auf sich. Unsre Geschwister, die da und dort in der Mission stehen, dienen an unsrer Stelle. Wir alle sollen Gottes Zeugen sein, wir können aber nicht alle in ferne Länder gehen, so sind wir schuldig, der Botschafter Christi zu gedenken. Da sind ferner viele Bedürftige unter den Gläubigen, und welch eine Wohltat ist es, ihnen unsere Lindigkeit zu erzeigen. Sagt nicht der Herr: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist, durstig und ihr habt mich getränkt, krank und ihr habt mich besucht“, und meint dabei Seine geringsten Brüder (Matthäus 25, 35 ff.). Versäumen wir auch nicht, unsere Lindigkeit andersdenkenden Gläubigen kund werden zu lassen. Das fördert die Gemeinschaft untereinander.
Die Menschen im allgemeinen. Gemeint sind also nicht nur die, die uns lieben und uns im Glauben nahe stehen. Denken wir an das schöne Beispiel vom barmherzigen Samariter, der einem verletzten Juden diente, der ihn nichts anging. Der Herr hat Sein Blut für alle vergossen und hat alle gleich lieb, und Gott wird der Erhalter aller Menschen genannt (1 Timotheus 4, 10). Auch uns werden die Gelegenheiten, allerlei Liebeserweisungen zu praktizieren, nie fehlen. Es gilt zu helfen, zu tragen, Sanftmut zu üben und Vergehungen zuzudecken (Kolosser 3, 12).
Endlich auch die Feinde. Der Herr hat geboten, die Feinde zu lieben (Matthäus 5, 44. 45) und Er hat es auch selbst getan. Kaum hatten Ihn die Mörder ans Kreuz genagelt, da betete Er für sie. Und welche Wirkung die von Stephanus geübte Feindesliebe auf Paulus hatte, ist uns bekannt. Auch an anderen Stellen ermahnt uns die Schrift, den Feinden in Liebe zu begegnen (Römer 12, 14, 20, 21; 1 Petrus 2, 23). In 1 Korinther 4, 12, 13, gibt Paulus ein anschauliches Bild und eine treffliche Belehrung vom richtigen Verhalten der Gläubigen den verschiedenen Gegnern gegenüber.
III. Warum sollen wir Lindigkeit üben?
Weil der Herr nahe ist. Dieser Ausdruck kann auf verschiedene Weise verstanden werden:
Nahe, weil Er nach Seiner Verheißung alle Tage bei den Seinen ist (Matthäus 28, 20). Sie sind Seiner ständigen Nähe und Gegenwart sicher. Er hat zudem öfters gesagt: „Ich will dich nicht verlassen noch versäumen“ (Hebräer 13, 5).
Nahe, weil Er gesagt hat: „Ich komme bald“. Das erfüllt uns mit Freude, bewegt uns zur Lindigkeit, bewirkt Vertrauen und treibt ins Gebet.
Nahe, weil Er in Seinen Kindern durch den Heiligen Geist wohnt: „Durch Seinen in euch wohnenden Geist“.
Auch in jeder Prüfung lässt Er sie Seine Nähe erfahren. Man denke an jene drei Männer im Feuerofen. Von Josef heißt es im Gefängnis: „Aber der Herr war mit Josef“. Paulus konnte in jenen schweren Stürmen der Romreise sage: „Der Herr stand mir bei“. Und wie wunderbar Petrus die Nähe des Herrn und die Rettung aus dem Gefängnis erfuhr, beschreibt Lukas in Apostelgeschichte 12.
Nahe den Betern und denen, die zerbrochenen Herzens sind. Er ist auch in der Mitte derer, die sich in Seinem Namen versammeln. Sagt Er doch: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte“(Matthäus 18, 20).
Der Herr ist nahe (Philipper 4, 5)
Da der Apostel hier von unserm Verhalten zur Umwelt redet und nachher auch vom Nichtsorgen spricht, so mag er wohl mit dem Ausdruck „der Herr ist nahe“, vornehmlich an die Gegenwart Gottes im Leben des einzelnen Gläubigen gedacht haben. Die Schrift hat ja diesbezüglich viele herrliche Verheißungen (1 Mose 39, 2, 3, 21; 2 Mose 3, 2; Josua 1, 5; Psalm 46, 7, 11; Jesaja 41, 10; Matthäus 28, 20; Johannes 14, 18 ff.; Hebräer 13, 5-6). Aber ebenso nahe liegt die Annahme, dass der Apostel an das Kommen Christi gedacht hat, weil er wiederholte Male vom Tage Christi spricht und gerade in Kap. 3 von der Umgestaltung oder Erlösung unseres Leibes und von unserm Bürgertum im Himmel schreibt. In jedem Fall ist dem Volke Gottes klar, dass der Herr nahe ist. Immer lauter erschallt der Ruf: „Siehe Er kommt“. Zudem sind die Zeichen der Zeit recht auffallend, und jeder denkende Schriftforscher wird ständig daran erinnert, dass der Herr nahe ist.

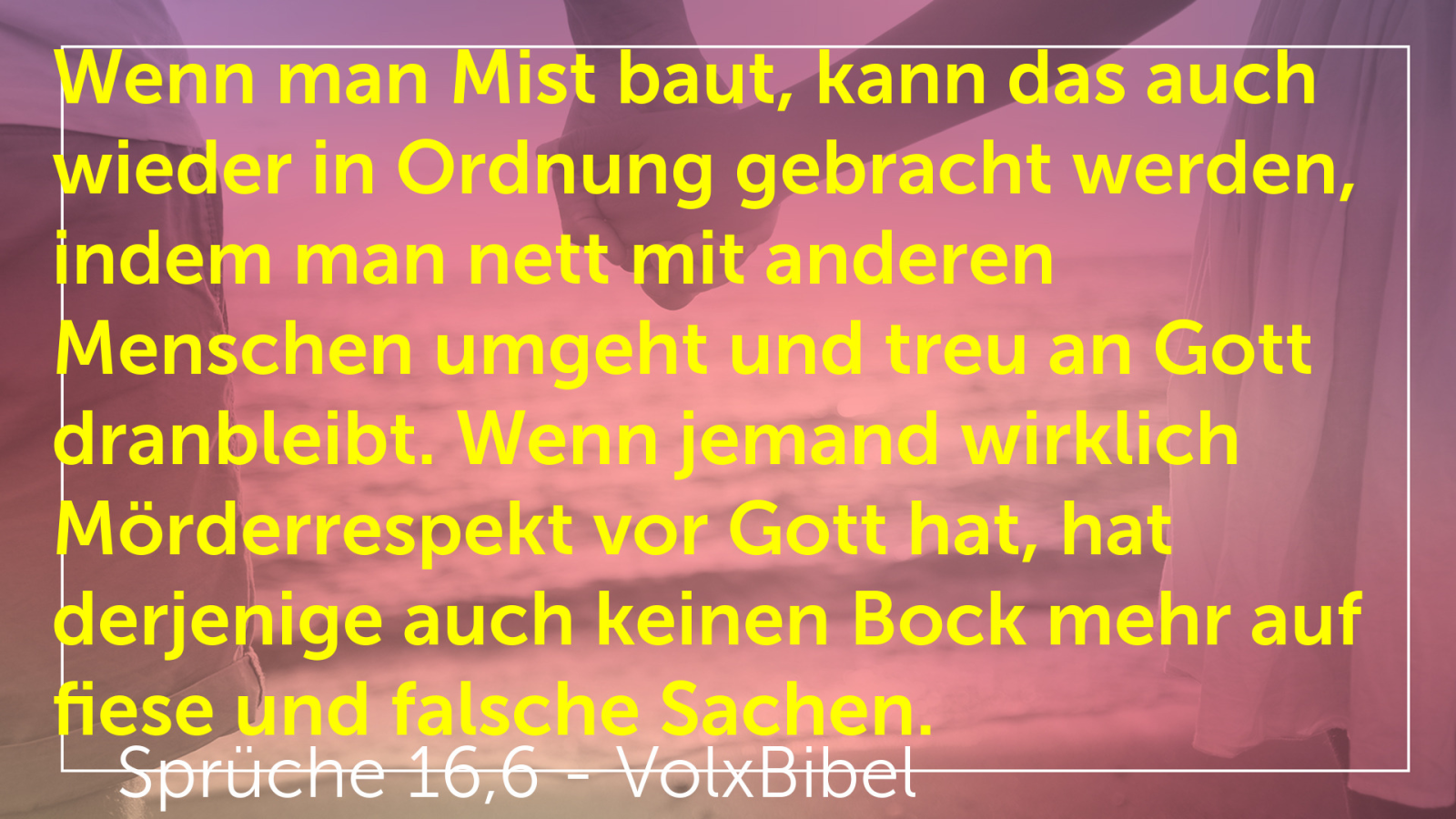
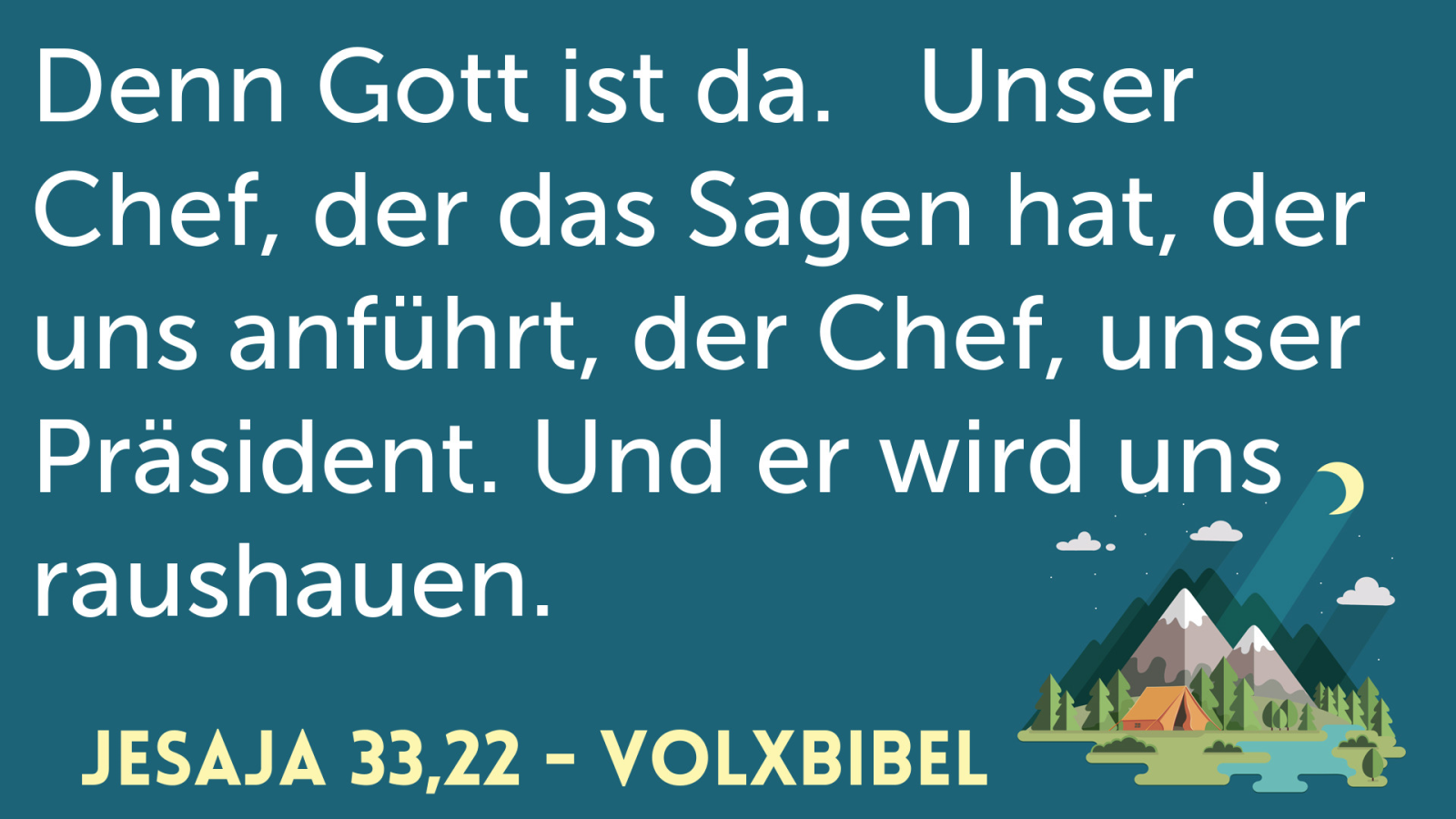
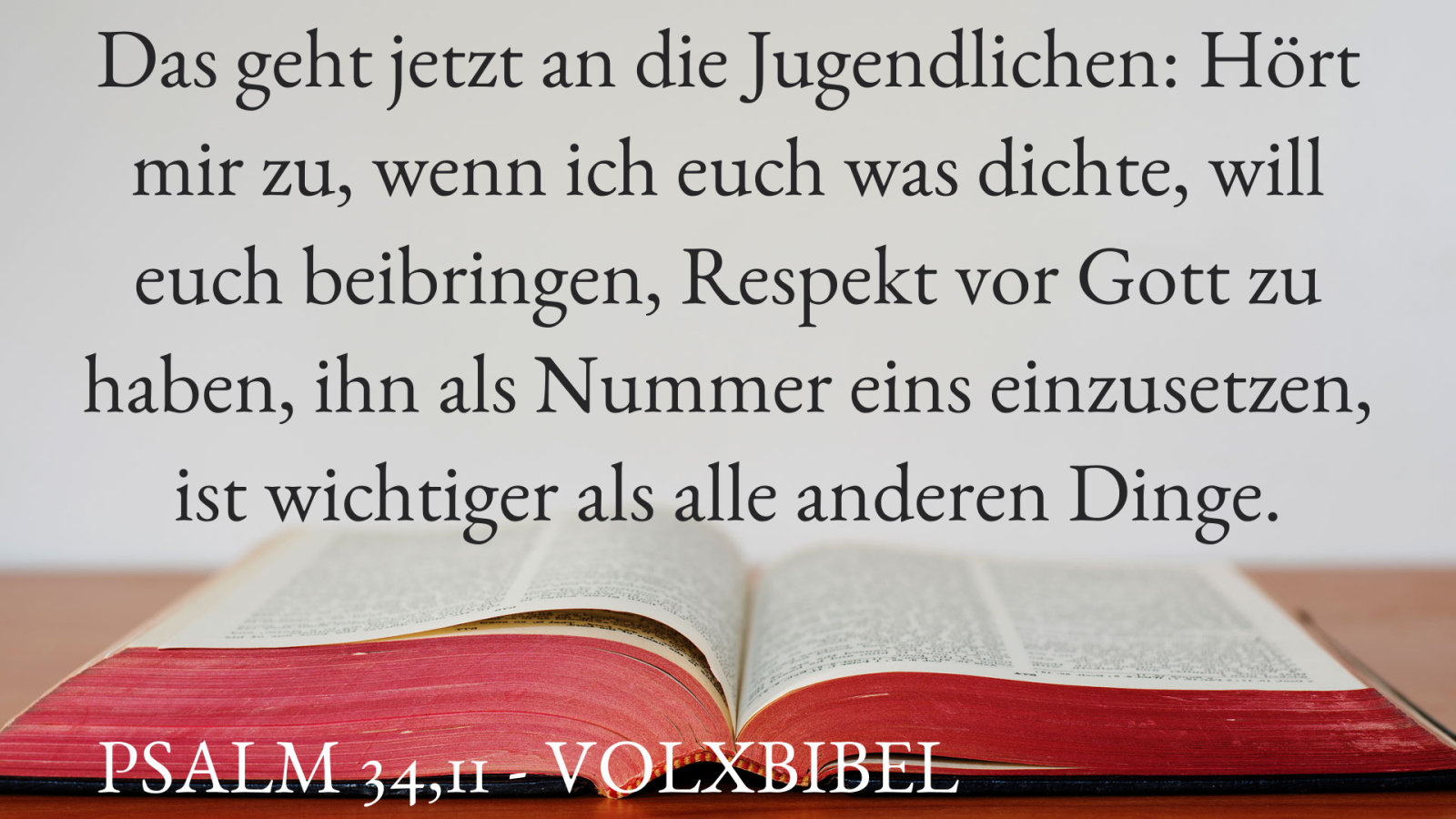
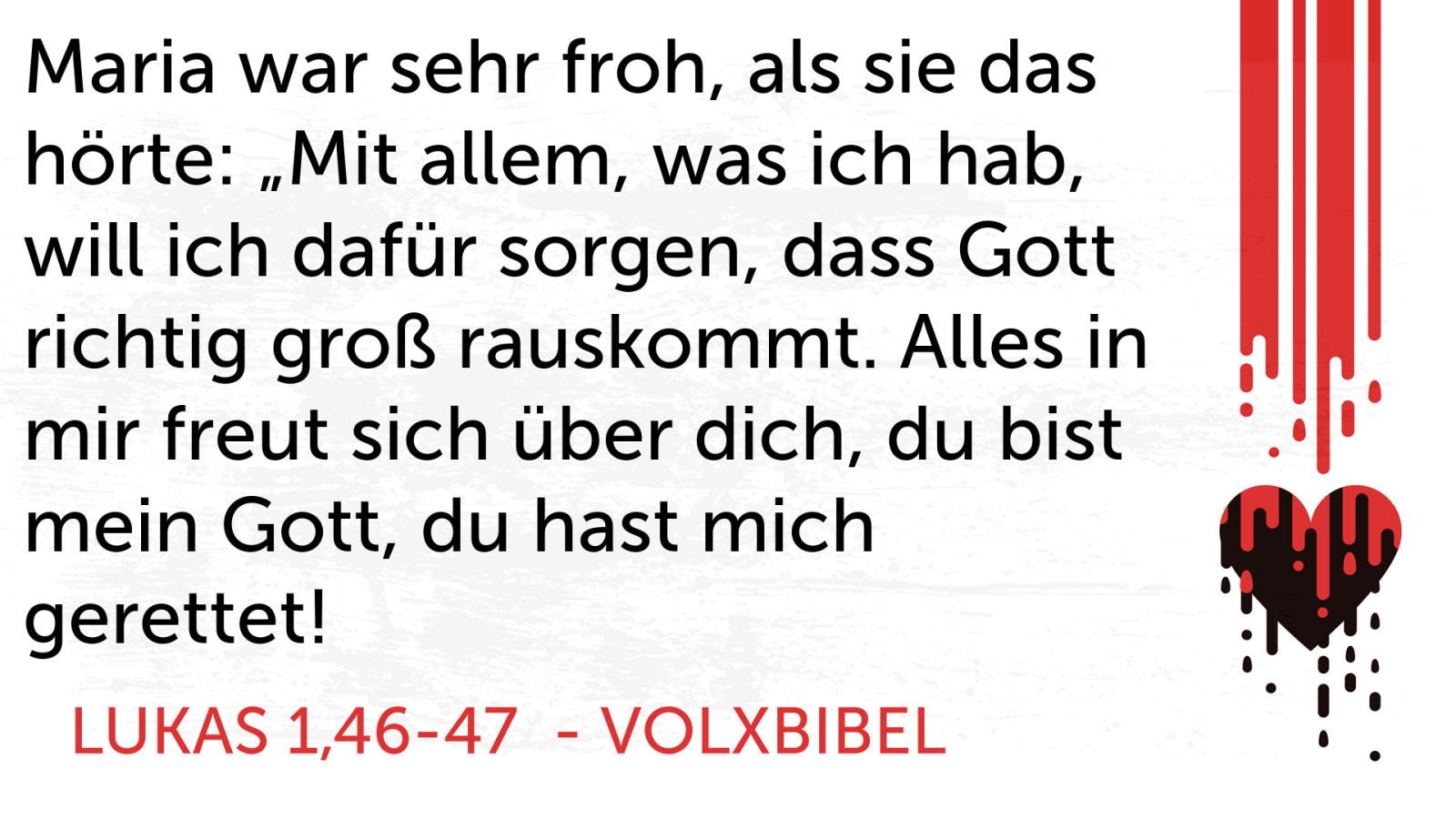
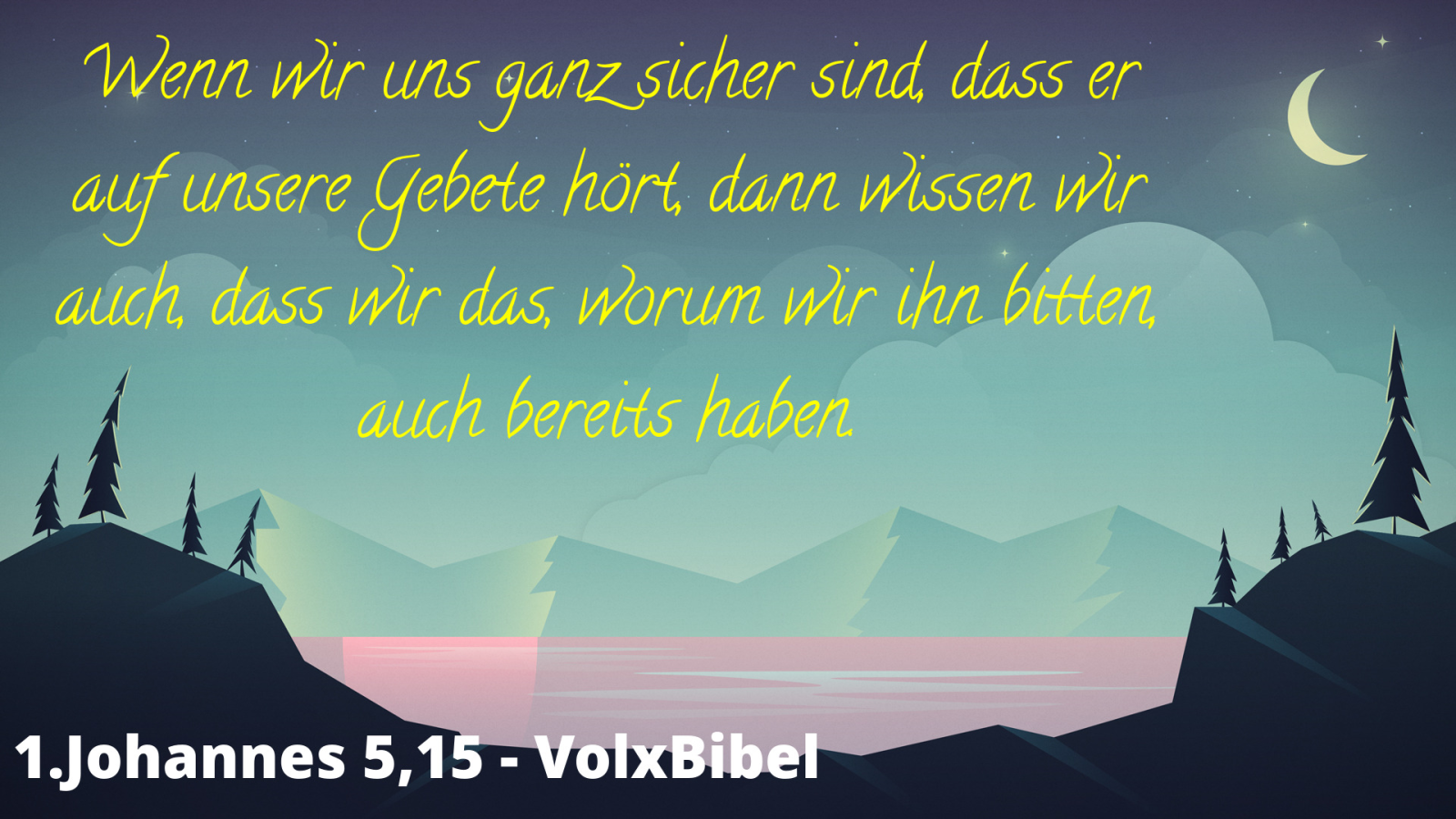
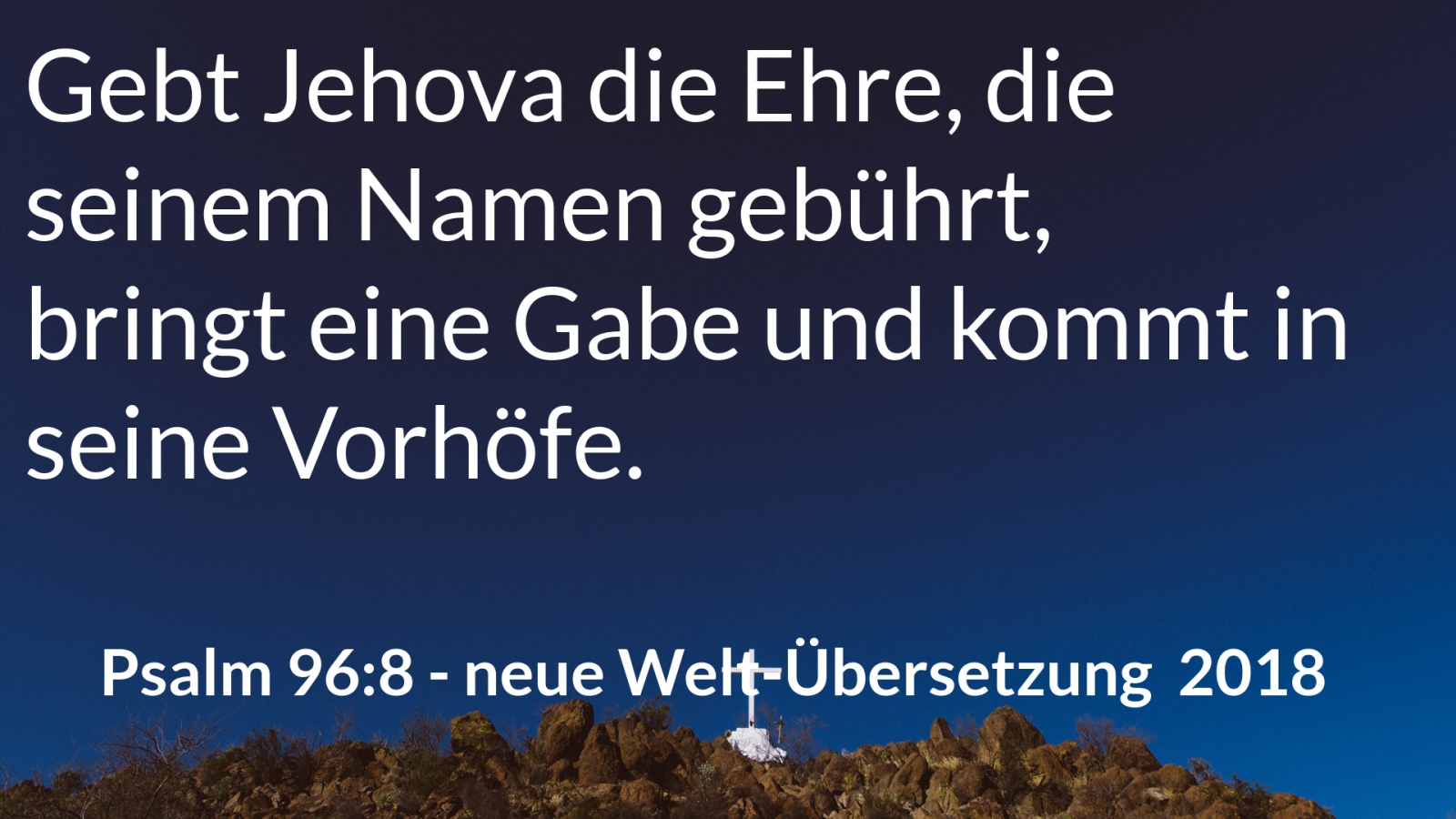
Neueste Kommentare