Genauso sollt auch ihr Männer euch verhalten und euer gemeinsames Leben voller Einsicht und Rücksicht gestalten, weil die Frauen körperlich schwächer sind als ihr. Deshalb behandelt sie erst recht voller Respekt und macht euch klar, dass sie gemeinsam mit euch Anteil haben an Gottes Geschenk des Lebens. Dann werdet ihr eure Gebete nicht selbst behindern.
Roland Werner – Das Buch – 1.Petrus 3,7
Gleichermaßen sollt ihr Ehemänner mit Einsicht mit dem weiblichen als einem schwächer beschaffenen Gefäß zusammenwohnen! Lasst ihnen Würde zuteil werden als solchen, die auch Miterben von Gnade zum Leben sind, sodass eure Gebetszeiten nicht blockiert werden.
Andreas Eichberger – Gottes Agenda – 1.Petrus 3:7
Ihr Männer gleicherweise, wohnet bei ihnen nach Erkenntnis, (O. mit Einsicht) als bei einem schwächeren Gefäße, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf daß eure Gebete nicht verhindert werden.
Elberfelder 1871 – 1.Petr 3,7
Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen! Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie; denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht.
Gute Nachricht Bibel 2000 – 1.Petr 3:7
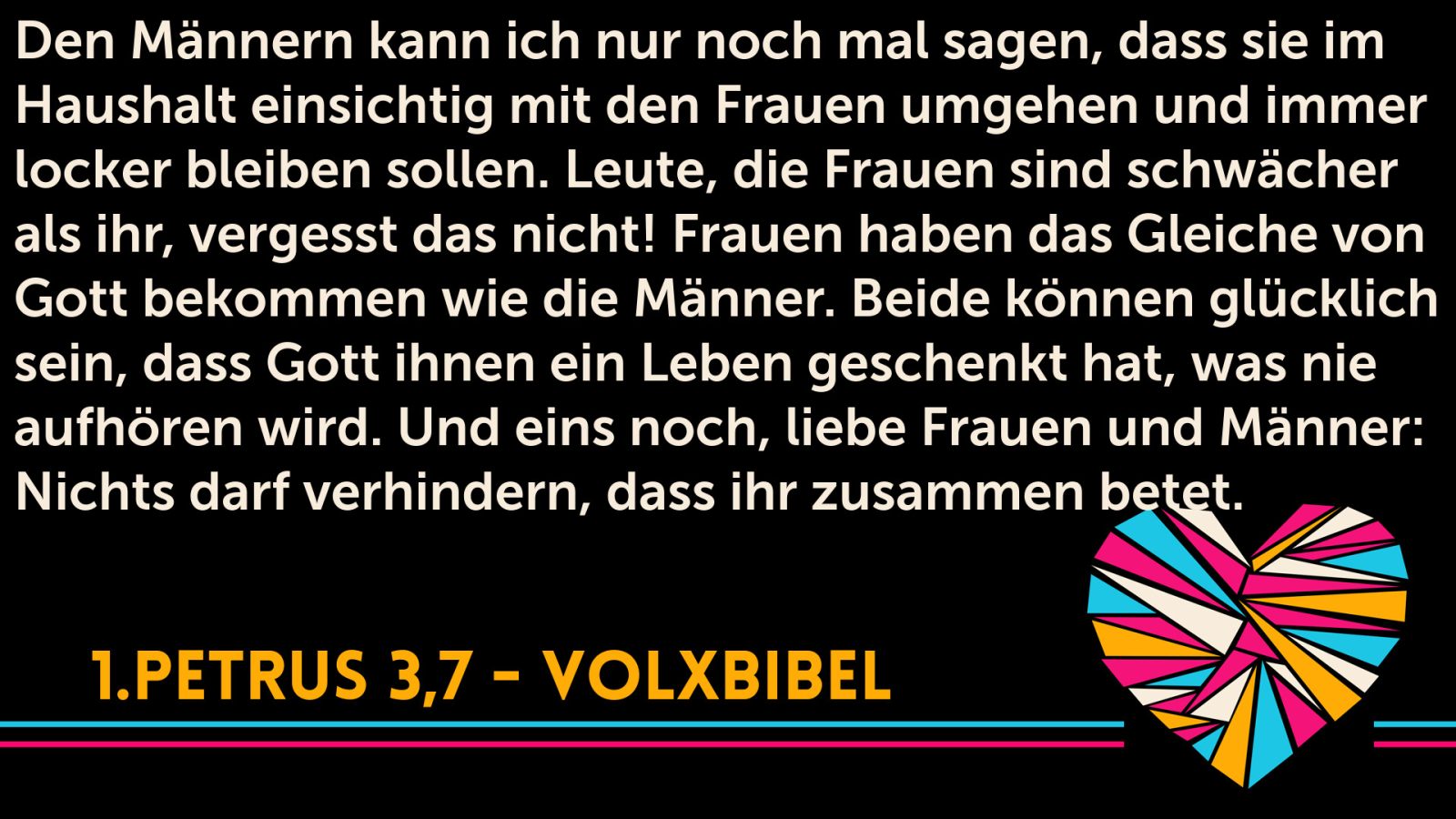
Die mit dem Wort vernünftig übersetzte Wendung (kata gnOsin, wörtlich „nach bestem Wissen, mit Verstand“) macht deutlich, daß die Ehemänner die geistlichen, emotionalen und körperlichen Bedürfnisse ihrer Frauen verstehen und sich um sie kümmern sollen. Auch der Apostel Paulus wies darauf hin, daß ein Mann seine Frau schützen und für sie sorgen muß, „wie auch Christus“ für „die Gemeinde“ sorgt ( Eph 5,28-30 ).
Die Bibel erklärt und ausgelegt – Walvoord Bibelkommentar
Daneben haben die Ehemänner ihren Frauen als dem schwächeren (Geschlecht) die Ehre zu geben. „Schwächer“ (asthenesterO) bezieht sich auf körperliche oder gefühlsmäßige Schwäche, nicht auf geistige Unterlegenheit, denn die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Wenn Petrus hier an christliche Ehemänner denkt, deren Frauen ebenfalls Christinnen sind, dann könnte mit der „Gnade des Lebens“ die Erlösung gemeint sein (vgl. Röm 8,17; Eph 3,6). Wenn sich die Ermahnung jedoch an christliche Ehemänner richtet, deren Frauen ungläubig sind (wie 1 Petrus 3,1-2 sich an Ehefrauen mit ungläubigen Männern richtet), dann ist damit wohl das Zusammenleben von Mann und Frau gemeint. Petrus fügt hinzu, daß Männer, die ihre Frauen nicht mit Verständnis und Ehrerbietung (timEn, „Achtung, Ehre“; vgl. 1 Petrus 2,17) behandeln, nicht erwarten können, daß ihr Gebet erhört wird.
Wie alle Christen und exemplarisch zuvor die Sklaven und Ehefrauen werden jetzt auch die »Männer«, die Ehemänner, in das Leben als Christ in ihrem Stand eben als Ehemann eingewiesen, wie das »desgleichen« betont. Auch christliche Ehemänner haben solche helfende Weisung nötig, denn allzu schnell wird das »Untertan-Sein« der Frau ausgenützt und sie zur Dienerin degradiert, über die der Mann Herrschaft ausübt.
Edition C Bibelkommentar
Die Frau ist ja auch das »schwächere« »Geschlecht«. Damit ist zunächst eine natürlich, biologische Tatsache gemeint. »Schwächer« bezeichnet zunächst die körperliche Konstitution, und vom Körperbau her ist die Frau in der Regel weniger stark als der Mann. Damit können aber auch die psychischen Kräfte gemeint sein, und dann könnten wir mit »sensibler« übersetzen: Die Frau ist emotionaler als der Mann. Daß das keinerlei Abwertung bedeutet, wird schon an dem sichtbar, daß diese »Sensibilität« oft die große Stärke der Frau ist, mit der sie in Ehe und Familie und darüber hinaus wichtige Hilfe geben kann. Das griechische Wort »Geschlecht« meint eigentlich »Gefäß, Werkzeug«. Wenn die Frau als das »schwächere Werkzeug« bezeichnet wird, dann trifft der Begriff »Werkzeug« auch auf den Mann zu. Ist hier versucht, das, was im Schöpfungsbericht im Hebräischen mit »Ebenbild« ausgedrückt ist, wiederzugeben? »Ebenbild« meint ja auch eine Dienstbeauftragung von Gott her im Sinne von »Beauftragter für die Schöpfung«. Die Frau wird im Schöpfungsbericht als »Gehilfin« bezeichnet, nicht im Sinne von »Dienerin«, sondern eben so, daß Mann und Frau erst im Miteinander wirklich brauchbares Werkzeug Gottes sind.
»Wohnt vernünftig mit ihnen zusammen«, das ist die erste Weisung des Petrus (»seid zusammenwohnend nach Erkenntnis« griechisch kürzer). »Zusammenwohnen« meint viel mehr als Wohngemeinschaft; es meint die Lebensgemeinschaft, die Ganzheitsgemeinschaft nach Leib, Seele und Geist. Wirklich beim andern zu sein, das ist das Wesen der Liebe. Die Gleichung der Liebe in der Ehe heißt deshalb: 1+1=1. »So werden die zwei ein Fleisch sein« (1 Mo 2,24). Das ist gemeint. Das Adjektiv »vernünftig« unterstreicht das nachdrücklich: »Erkenntnis« ist mehr als ein Verstandesvorgang. Will ich jemanden wirklich erkennen, kennen, dann muß ich mich ihm ganz hingeben, mich öffnen und bereit sein, ihn ganz zu verstehen. In diesen kurzen Sätzen steckt eine umfassende Ehe-Lehre.
Der Ehefrau soll »Ehre gegeben« werden. Das ist ganz gewiß die äußere Hochachtung, aber auch die volle Wertschätzung, die sich in umsorgender Liebe ausdrückt. Noch umfassender ist aber gerade bei Christen diese »Ehre«, die Wert-Schätzung der Frau gemeint, »denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens«. »Miterbinnen« – das ist die völlige Gleichwertigkeit der Frau vor Gott. Das war revolutionär für die damalige Zeit (vgl. zu 3,1). Die Frau hat gleichen Anteil an der »Gnade des Lebens«. Dieser Ausdruck ist Kurzform für das ganze Heil, das in Jesus Christus geschehen und uns Glaubenden zugeeignet ist. Hier wird jeder Diskriminierung der Frau gewehrt, und das hat Auswirkungen gerade in der Ehe, aber auch weit in die Gesellschaft hinein.
Ist dieser engste Lebensbereich der Ehe gerade bei Christen nicht in Ordnung, dann lähmt das die Gemeinschaft mit dem Herrn, gefährdet so das neue Leben, »…damit eure Gebete nicht behindert werden«: Gemeint ist wohl zuerst das gemeinsame Gebet. Das ist aber unmöglich, wenn die Eheleute in gegenseitiger Mißachtung oder in Streit leben. »Behindert« heißt wörtlich »in etwas einschneiden«. Die Lebensverbindung zum Christus wird also dann abgeschnitten, wenn Männer ihren Ehefrauen nicht die Ehre geben und sie nicht als gleichwertig in allem behandeln.
Petrus hat auch eine Botschaft an die Männer. Dabei handelt es sich aber nicht um die Männer, deren Frauen gläubig geworden sind, die aber selbst keine Christen sind. Hier geht es um christliche Männer mit christlichen Frauen.
Mainka – 1. Petrus
Die Frauen werden als das „schwächere Geschlecht“ bezeichnet. Daher ruft Petrus sie dazu auf: „Wohnt bei ihnen mit Einsicht …“ Das griechische Wort, das hier mit „Einsicht“ übersetzt wird, heißt eigentlich „Erkenntnis“. Es „bezeichnet hier nicht … das Konstatieren eines Sachverhaltes, die empirische Analyse, auch nicht im gnostischen Sinne die überlegene Wirklichkeitsschau (1Kor 8,1). Es ist vielmehr die verstehende Einsicht, die aus der Liebe zu Gott und den Menschen erwächst …“ (Goppelt, 221; vgl. Phil 1,9-10: „(9) Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, (10) damit ihr prüft, worauf es ankommt …“, Phlm 6: „dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten …“). Gemeint ist also, dass die Männer Verständnis für ihre Frauen haben und Rücksicht auf sie nehmen sollen.
Die Frauen sind aber nicht nur „das schwache Geschlecht“. Sie sind auch „Miterben der Gnade des Lebens“ – und stehen in diesem Sinne gleichwertig neben ihren Männern. Deshalb sollen die Männer ihre Frauen ehren.
Ausdruck für diese Gleichberechtigung „ist u.a. das gemeinsame Gebet der Eheleute, das behindert, gehemmt und gelähmt wird, wenn die Männer ihre Frau nicht ehren, d.h. ihnen nicht Achtung erweisen“. (Stuttgarter Erklärungsbibel, 1789).
Wenn wir unter den Augen der Welt ein Zeugnis sein wollen, dann müssen wir Männer unsere Ehefrauen in der rechten Art lieben und ehren. Wie wir mit ihnen umgehen, nimmt die Welt sehr bald wahr. Wenn wir rüde, fordernd, unfreundlich, herzlos und egoistisch sind, wird kein Mensch unseren Glauben ernst nehmen.
Benedikt Peters – Kommentar zu 1. Petrus
»Gleicherweise« wie die vorher genannten Hausknechte und Ehefrauen sollen auch die Ehemänner ihre Pflicht erfüllen, die sie ihren Frauen gegenüber haben. Ihre Aufgabe ist es, bei ihren Frauen »nach Erkenntnis« zu wohnen und ihnen Ehre zu geben. Der Mann darf die stärkere Position, die ihm der Schöpfer gegeben hat, nicht ausnutzen, indem er die Frau als das »schwächere Gefäß« unterdrückt oder herumkommandiert. Ihr hat Gott in der ehelichen Gemeinschaft die schwächere Stellung, nämlich die der Unterordnung, gegeben. Wie erbärmlich ist es, wenn Männer das ausnutzen! Sie bedenken nicht, wie dadurch der Herr entehrt wird, der selbst als Herr und Haupt der Gemeinde nicht kam, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, und der als der Meister den Jüngern die Füße wusch.
»wohnt bei ihnen«: Für »wohnt« steht hier συνοικεω, synoikeō, wörtlich: zusammenwohnen. Ein Verb, das im NT nur hier belegt ist. Der Mann wohnt zusammen mit und bei seiner Frau. »Wohnen« bedeutet »sich bleibend niederlassen«. Er bindet sich an sie und verlässt sie nie mehr. Darin soll er dem Vorbild des Herrn folgen und dessen Liebe zur Gemeinde nacheifern (Eph 5,25).
»nach Erkenntnis«: nämlich Erkenntnis Gottes und seiner Gedanken. Erkennt er, was sie beide, sowohl er als auch seine Frau, als Sünder vor Gott sind, dann wird er demütig. Erkennt er, wie sie beide völlig auf Gottes Gnade angewiesen sind, dann macht das ihn noch demütiger. Er versteht, dass er nicht besser oder würdiger ist als seine Frau, und bedenkt, dass auch sie »Miterbe der Gnade des Lebens« ist. In der Stellung vor Gott und im Erbe, das uns in Christus geschenkt ist, ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau (Gal 3,28).
»und gebt ihnen Ehre«: Wie passend ist das alles: Die Frau sucht nicht eitle Ehre, sondern bleibt bescheiden und still im Hintergrund. Dafür gibt der Mann ihr die Ehre, die ihr zusteht, ja, die er ihr schuldet (siehe auch 2,17). Die vorbildliche Frau von Sprüche 31 sucht nicht Rang und Ansehen in der Öffentlichkeit, sondern ist ganz zufrieden, dass nicht sie, sondern ihr Mann bekannt ist in den Toren der Stadt (Spr 31,23). Dafür stehen ihr Mann und ihre Söhne auf und preisen sie, und ihre Werke werden im Stadttor gepriesen (V. 28–31).
Entspricht die Stellung der Frau nicht auch ganz der gegenwärtigen Position der Gemeinde Gottes? Wir gehen als Unbekannte durch die Zeit, in Knechtsgestalt, von der Welt nicht geehrt und nicht als das anerkannt, was wir wirklich sind (1Jo 3,1); wir sind noch nicht verherrlicht. Für unsere Unterordnung unter unseren Herrn und Gebieter wird er uns am Tag seines Erscheinens Ehre geben vor den Augen der ganzen Welt: Wir werden, wenn er erscheint, mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit (Kol 3,4).
»damit eure Gebete nicht verhindert werden«: Petrus nennt hier den Grund, der ihm der wichtigste war, warum die Männer so bei ihren Frauen wohnen sollten: Ihre gemeinsamen Gebete sollen nicht verhindert werden. Überrascht uns das? Hätten wir erwartet, dass er einen anderen Grund nennt, wie etwa glückliches Familienleben, wohlgeratene Kinder oder – was heute scheinbar sehr wichtig ist – »erfüllende Sexualität«? Petrus hat uns von Anfang seines Briefes an in Erinnerung gerufen, dass wir ein Erbe im Himmel haben, dass wir von oben geboren und als Pilger unterwegs sind zu unserem Erbe in der oberen Heimat. Dahin zieht es beständig unser Herz; dahin, wo unser Herr ist, gehen beständig unsere Gedanken. Zudem hat Petrus in diesem ganzen 2. Teil des Briefes (2,1–3,12) uns gelehrt, welches die Berufung der Gnade ist: Wir sind berufen, ein heiliges und königliches Priestertum zu sein (2,1–10), und als solche sind wir berufen, Zeugen Gottes zu sein in der Welt (2,11–3,12). Sind wir keine Priester, können wir keine Zeugen sein; suchen wir nicht im Gebet beständig sein Angesicht, werden wir unsere Aufgabe als Zeugen nur mangelhaft wahrnehmen können. Darum muss jedes christliche Ehepaar auch ein Priesterpaar sein. Sie müssen regelmäßig und ausgiebig zusammen vor Gott treten mit Dank, Flehen und Fürbitte. Als Priester Gottes sind sie dazu berufen, beständig in Gottes Gegenwart zu treten. Darum darf nichts und niemand ihr Gebetsleben hindern.
Wenn Mann und Frau viel zusammen beten, wird ihre eheliche Gemeinschaft immer tiefer. Nichts lässt ihre Herzen so zusammenwachsen wie das gemeinsame Bitten und Empfangen, das gemeinsame Beten um Gottes Beistand in ihrem gemeinsamen Zeugnis. Jeder, der mit seiner Frau ein regelmäßiges Gebetsleben führt – und das ist etwas anderes als bloß das Tischgebet und das Gute-Nacht-Gebet –, weiß das. Er weiß auch, dass er nicht regelmäßig mit seiner Frau betet, weil er darin eine gute Methode sieht, um in der Ehe glücklich zu werden. Er sucht dabei etwas ganz anderes, er sucht Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Dabei fällt ihm aber all das, was er gar nicht gesucht hat, auch zu (Mt 6,33).
Jetzt werden die Ehemänner hinsichtlich ihrer häuslichen Pflichten ermahnt. „Gleicherweise“ weist auf die ganze Abhandlung über die Unterwürfigkeit hin. Das Eheband ist kein Hundehalsband um den Hals der Ehefrau mit dem Effekt, daß sie nur darauf wartet, den nächsten Befehl auszuführen. Was die Ordnung im Hause angeht, so muß es eine höchste Autorität unter Gott geben. Da der Mann für alle Dinge in seinem Hause Gott gegenüber verantwortlich ist, so wird ihm als den Haupt eine gewisse Autorität übertragen. Was die Harmonie im Hause anbelangt, so ist gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich, wie Paulus es in Eph 5,21-23 ausdruckt: „einander unterwürfig in der Furcht Christi“.
Benedikt Peters – Was die Bibel lehrt
Die Ehemänner sollen, bei ihnen „wohnen“. Das Wort ist suniokes, wörtlich „zusammen wohnen“ oder „zusammen ein Haus benutzen“, in jeder Beziehung eines gemeinsamen Familienlebens. In allem soll der Mann für die Sicherheit seiner Frau sorgen, indem er die notwendigen Initiativen ergreift. Dies schließt körperliche, seelische und materielle Sicherheit ein.
Hier richtet sich zwar nur ein Vers an die Ehemänner, aber die Auswirkungen sind tief und in der Tat weitreichend. Paulus weist auf die ursprüngliche Verbindung zurück und stellt mit Betonung fest, daß es gerade der Mann ist, der die führende Rolle in der Liebe, im Verlassen der Eltern und Anhangen spielt (Eph 5,25-33). Die beständige Praxis des Zusammenlebens soll „nach Erkenntnis“ geschehen. Dies ist nicht auf das körperliche Verhältnis beschränkt, sondern es ist ein Wissen, das beständig versucht, besser kennenzulernen. Da der Ehemann seine Frau mehr und tiefer verstehen lernt, sollten anfängliche Ungewißheiten und Befürchtungen zerstreut werden, da er ihren Bedürfnissen in geistlicher Weise, seelischer, physischer und materieller Hinsicht dient. Die Frau wird als „das schwächere Gefäß“ angesehen, sicher nicht schwächer in irgend einem anderen Sinn als dem körperlichen. Eine Debora, die das Heer Israels anführte, eine Maria, die dem Kreuz des Verachteten gegenüberstand und eine Priszilla, die dem mächtigen Apollos die Schriften öffnete, können schwerlich als Frauen mit schwachem Willen, Geist oder Verstand bezeichnet werden. Es geht vielmehr um liebevolle Zuwendung und Sorge, wie Paulus es formuliert. Der Mann soll der Beschützer seiner Frau vor geistlichen, moralischen und körperlichen Gefahren sein und soll ihre Furcht durch seine Gegenwart beruhigen.
In einer Ehe ergänzen sich Mann und Frau im Idealfalle. Wenn beide gläubig sind, werden die Gaben und Fähigkeiten des einzelnen zusammengebracht, um einen harmonischen Beitrag für das Haus und weiter darüberhinaus zu leisten. Der Ehemann soll seine Frau ehren wie es ihrem großen und kostbaren Wert entspricht. Er soll anerkennen, daß sie wechselseitig Erben der Gnade des Lebens sind. Hier geht es also um Gläubige. Während sie nun auf Erden als Ehemann und Ehefrau leben, so gibt es „eine Beziehung durch Gnade, die niemals vergehen soll “ (W.Kelly). In diesem Verhältnis gibt es keine Unterscheidung hinsichtlich Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Die Perspektive der Ewigkeit vergrößert den Wert jeder Beziehung, indem sie diese über das Zeitliche und Vergängliche hinaushebt.
Das Gebet ist die zusammenhaltende Kraft, die das Haus und die Familie zusammenbindet: Gebet füreinander und Gebet für die Lasten und Nöte des anderen. Es ist eine äußerst schwierige Angelegenheit, ungelöste Fragen zwischen Ehemann und Ehefrau stehen zu haben, wenn diese sich gemeinsam zum Gebet niederbeugen. Der Feind versucht beständig, Gebete zu verhindern. Er hat tausend Tricks auf Lager, von denen einer das Säen von Zwietracht zwischen den Ehepartnern ist. Jede Anstrengung ist zu unternehmen, wobei dem Mann die führende Rolle zufällt, da er Haupt und Priester des Hauses ist, den Familienaltar in Liebe und Achtung aufrecht zu erhalten.
Es ist höchst bedeutsam, das Verhältnis zwischen Gebetsleben und der Liebe zwischen Ehemann und Frau zu erkennen. Eins kann das andere rückwirken. Dieser ganze Abschnitt läßt die Bedeutung eines ausgewogenen Lebens erkennen, wo die göttliche Ordnung in allen Aspekten und Bereichen des täglichen Lebens befolgt wird.
Bezüglich der Ehemänner erwähnt Petrus zwei Verantwortungen. Erstens sollen sie mit Einsicht bei ihren Ehefrauen wohnen. Der Ausdruck ebenso verbindet diesen Vers mit dem vorhergehenden. Genau, wie Ehefrauen sich ihren Ehemännern unterordnen müssen, haben sich Ehemänner dem Herrn unterzuordnen und ihre Unterordnung dadurch zu zeigen, dass sie für die Bedürfnisse ihrer Ehefrauen sorgen. Das Wort wohnt steht in der Gegenwart und betont eine beständige Pflicht. Die griechische Form des Wortes, das nur in diesem Vers vorkommt, vermittelt dieselbe Idee wie das hebräische Konzept des »Erkennens«. Sie bezeichnet »intime Kenntnis«; »sexuelles Erkennen«. Dieses Wort wird in der Septuaginta fünf Mal gebraucht (5Mos 22,17; 24,1; 25,5; Spr 19,14; Jes 62,5). Es bedeutet, »als Ehemann und Ehefrau zusammen zu leben«; »gemeinsam zu wohnen«. Diese Erkenntnis hat mit sexuellen Beziehungen zu tun. Das Wohnen bezieht sich hier darauf, mit ihren Ehefrauen nach der Erkenntnis sexuell zu wohnen. Während sich das Wort Erkenntnis auf Einsichten über die Ehe im Allgemeinen beziehen mag, betont es im Kontext dieses Satzes die körperlichen Aspekte dieses Erkennens. Der Ehemann hat sexuell mit seiner Frau zu leben – nach der Erkenntnis über die Erfüllung der sexuellen Bedürfnisse der Ehefrau.
Arnold Fruchtenbaum – Die Petrusbriefe
Die zweite Verantwortung der Ehemänner ist, dass der Ehemann seine Frau ehren muss. Das Wort Ehre geben in seiner griechischen Form wird nur hier und nirgendwo sonst gebraucht. Es bedeutet »zuweisen oder zuteilen«. Auch dieses Wort steht in der Gegenwartsform und betont die beständige Pflicht des Ehemannes, seine Frau zu ehren. Die Ehefrau soll in die Unterordnung hineingeliebt, nicht hineingezwungen werden. Der Ehemann muss seine Frau ehren, und zwar auf zwei Arten. Erstens muss er ihr als dem schwächeren Gefäß Ehre erweisen. Weil sie das schwächere Gefäß ist, muss er sie beschützen. Das Leben des Ehemannes mit seiner Ehefrau sollte sich darauf gründen, dass sie sich bewusst als das schwächere Gefäß akzeptiert. Der Abschnitt sagt nicht, dass sie schwach ist; er bezeichnet sie als schwächer. Vor Gott sind sowohl Mann als auch Frau Gefäße, und beide sind schwach. Im körperlichen Bereich jedoch ist ein Mann im Allgemeinen stärker als eine Frau; die Frau ist das schwächere Gefäß. Hier meint Petrus mit ihrem schwächeren Zustand die körperliche, nicht die geistliche Verfassung. Im Griechischen ist das schwächere Gefäß »[ehe-]fraulich«. Das Ehren beinhaltet Schutz. Zweitens müssen Ehemänner ihren Ehefrauen Ehre erweisen, weil sie Miterben der Gnade des Lebens sind. Die Ehefrau ist in den geistlichen Facetten der Errettung die Partnerin des Ehemannes. Während die Frau bezüglich der Autorität schwächer ist, weil sie ja unter der Autorität ihres Ehemannes steht, ist sie ihrem Mann bezüglich der geistlichen Privilegien absolut gleichgestellt. Nach Darstellung der beiden Arten, auf die ein Ehemann seiner Ehefrau Ehre erweisen muss, nennt Petrus den Grund, sie zu ehren: damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das Wort damit verweist sowohl auf das Ergebnis, als auch auf den Zweck. Wenn der Ehemann seine Ehefrau nicht ehrt, hat das Auswirkungen auf sein Gebetsleben. Das Wort verhindern bedeutet, dass das Gebet nicht vor den göttlichen Thron aufsteigt. Somit wirkt sich die Partnerschaft zwischen Ehemann und Ehefrau auf zwei Arten aus: Erstens sind sie Partner im körperlichen Bereich, weil sie gemeinsam Kinder hervorbringen; zweitens sind sie Partner im geistlichen Bereich, weil sie beantwortete Gebete hervorbringen

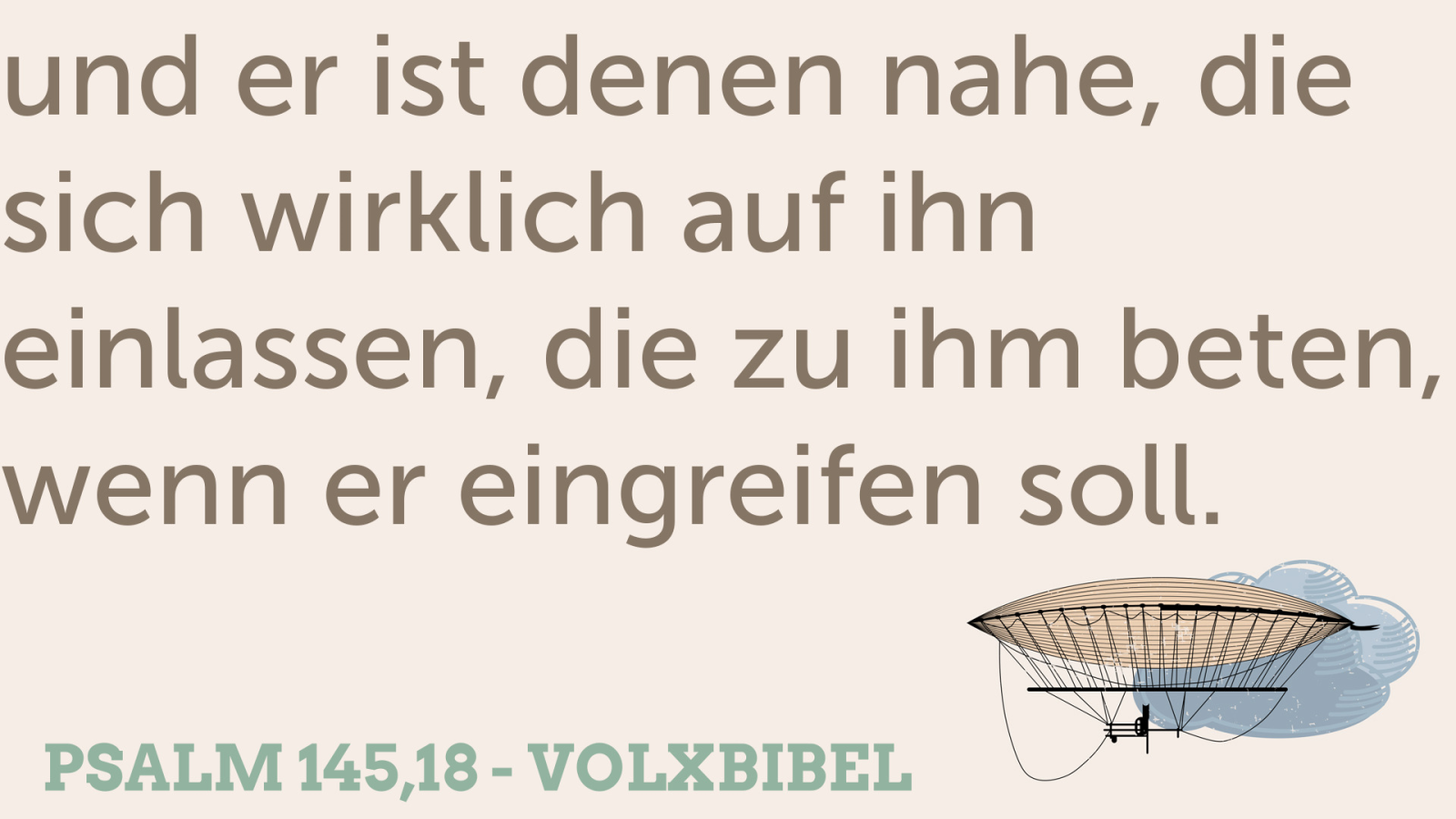
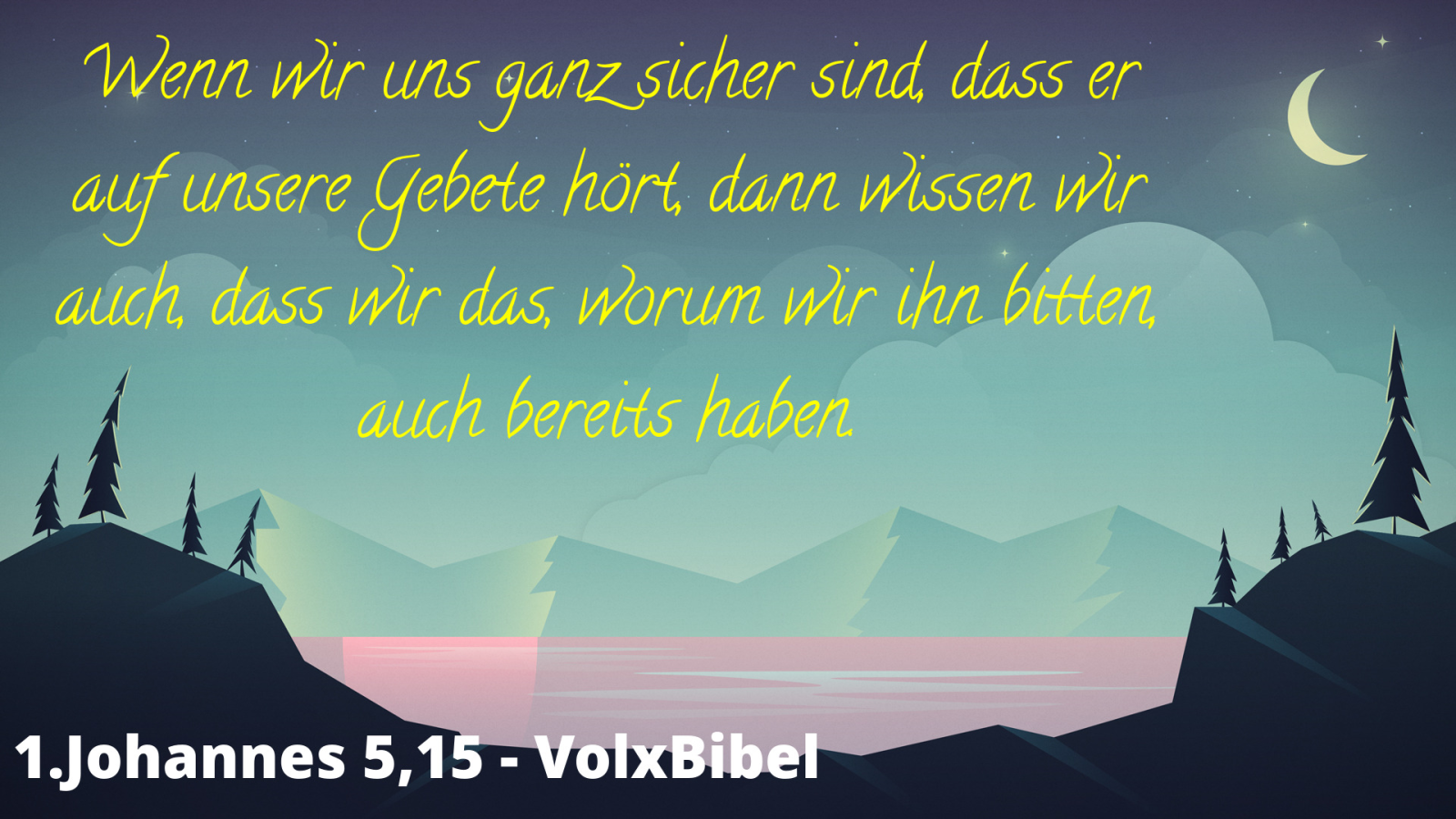
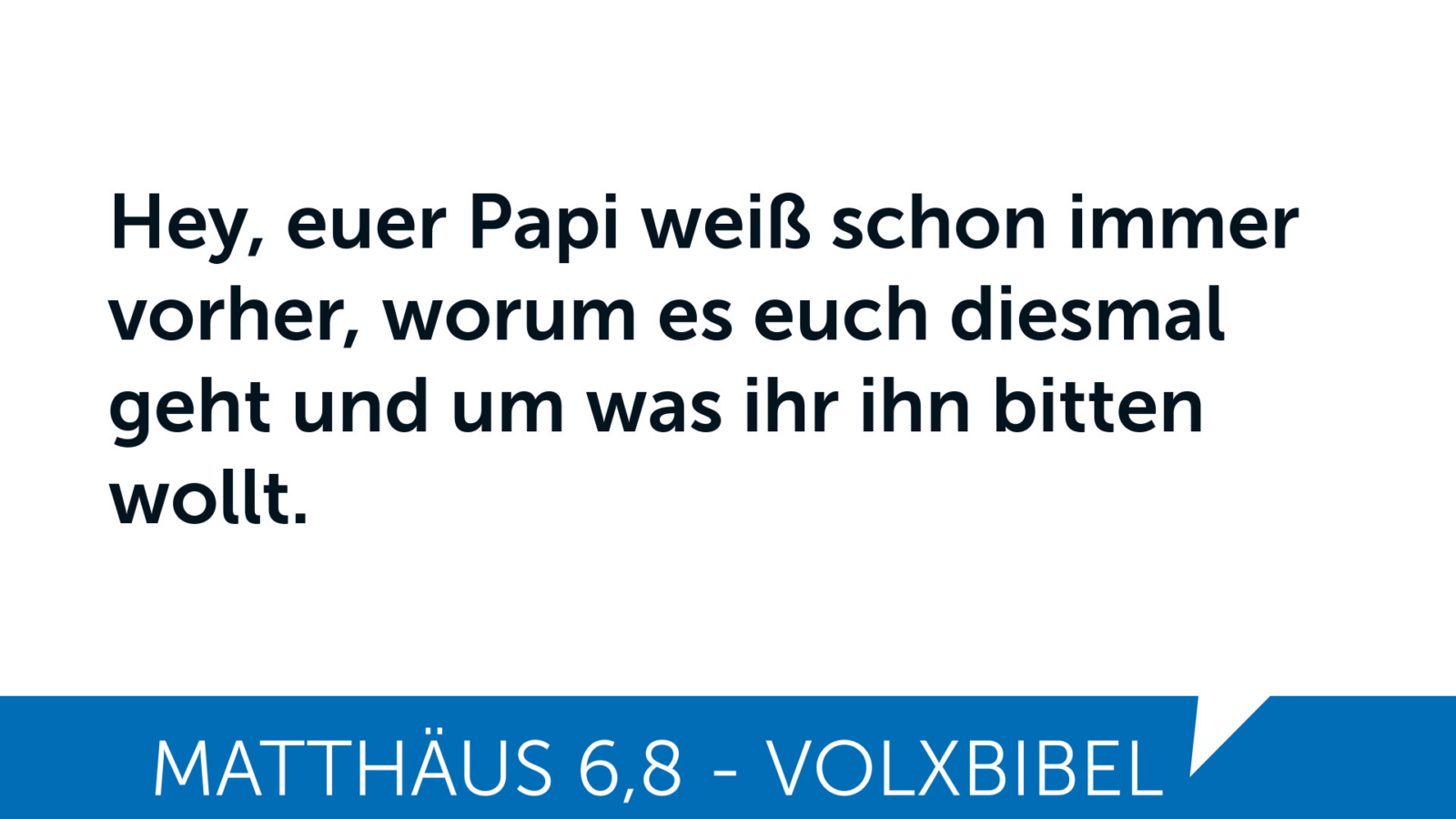
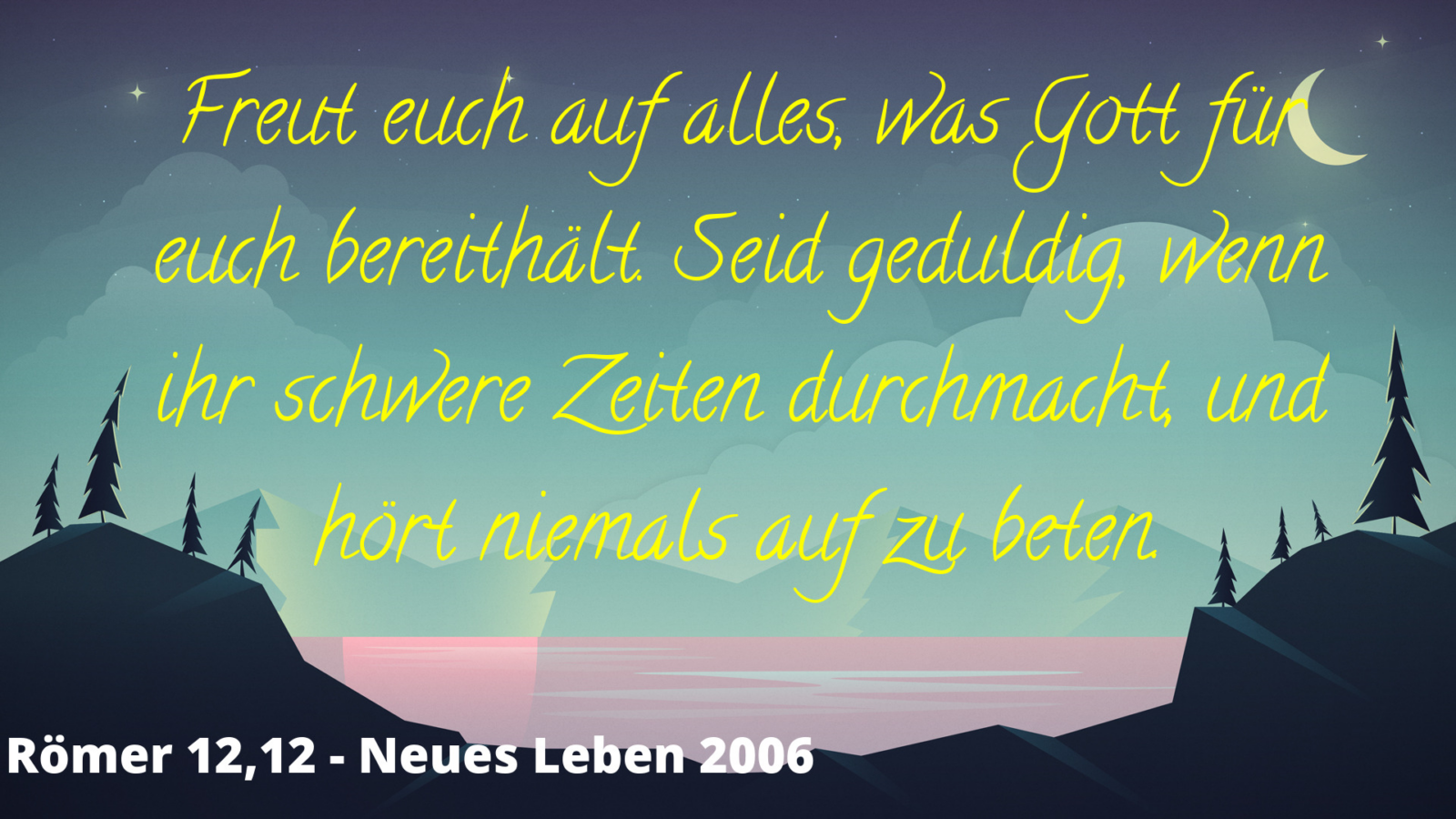
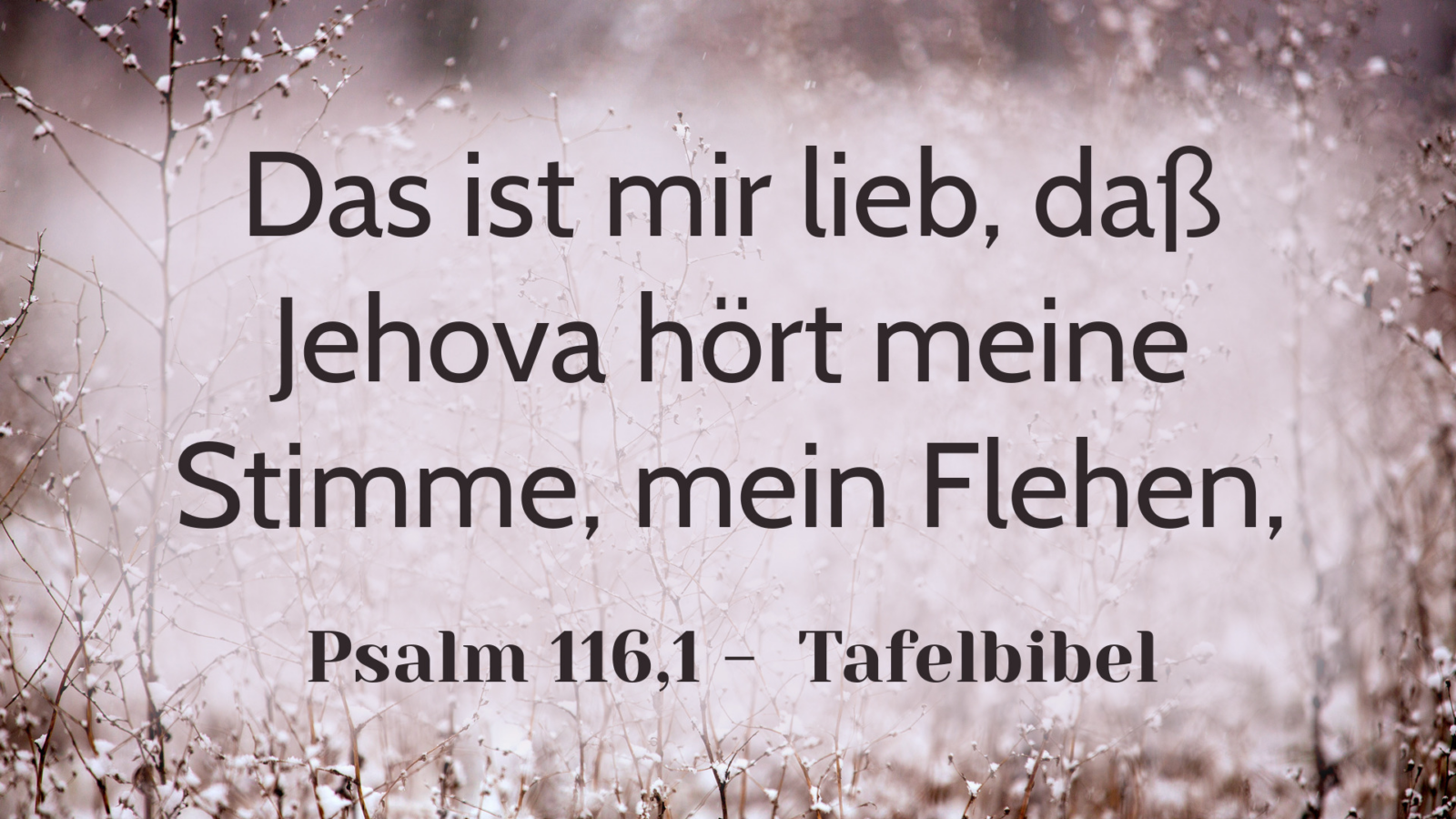
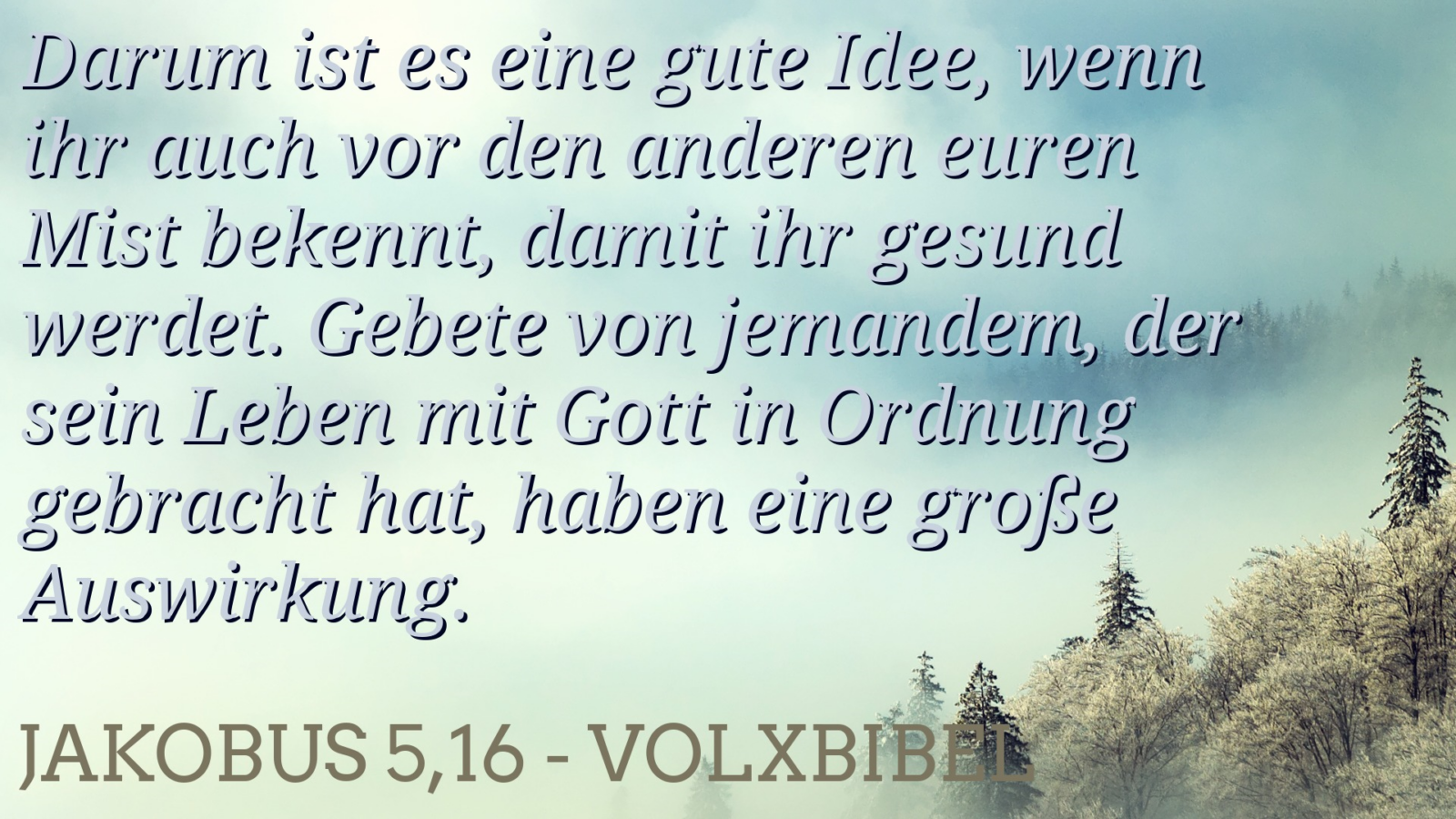
Neueste Kommentare