Daher, meine Geliebten, gleichwie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket (O. wirket aus, vollführet) eure eigene Seligkeit (O. Errettung, Heil) mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen.
Elberfelder 1871 – Phil 2,12–13
Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm Freude macht.
Neues Leben Bibel – Philipper 2,12–13
Also, ihr Lieben, ihr habt ja immer alles umgesetzt, was ich euch empfohlen habe. Egal, ob ich bei euch vor Ort bin oder ob ich gerade nicht da sein kann: Hört auf das, was ich euch sage! Tut was dafür, dass ihr von Gott gerettet werdet! Von dem Gott, vor dem man zittern muss. Aber dieser Gott sorgt ja für beides bei euch, einmal, dass ihr das überhaupt wollt, und dann, dass ihr es überhaupt schaffen könnt, damit er sich über euch freut.
VolxBibel – Phil 2:12–13
Was folgt daraus, liebe Freunde? So, wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daransetzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt – nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.
Neue Genfer Übersetzung – Philipper 2:12–13
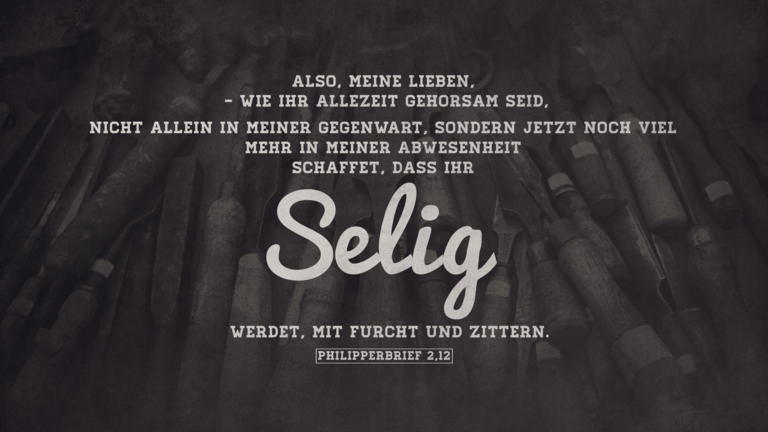
Heute Nacht ein Buch über die Bergpredigt gehört. Der Autor schreibt im Vorwort:
Ich denke, es ist kein barsches Urteil, wenn ich sage, dass das Hauptkennzeichen der christlichen Gemeinden von heute leider die Oberflächlichkeit ist. Dieses Urteil basiert nicht allein auf der gegenwärtigen Situation der christlichen Gemeinden, sondern vielmehr auch auf den gegenwärtigen Beobachtungen im Lichte der gemeindlichen Situation in vergangenen Epochen der Kirchengeschichte. Es gibt nichts Hilfreicheres für das geistliche Leben eines Christen als das Studium der Kirchengeschichte, insbesondere das Studium der großen geistlichen Bewegungen des Heiligen Geistes – von ihnen zu lesen und zu erfahren, was in den Gemeinden zu verschiedenen Zeiten vor sich gegangen ist. Nun, ich bin davon überzeugt, wer den gegenwärtigen Zustand der christlichen Kirche im Lichte vergangener Epochen sieht, wird, wenn auch widerstrebend, zu folgender Schlussfolgerung kommen: Das vorherrschende Merkmal der christlichen Kirchen heute ist die – wie ich schon sagte – Oberflächlichkeit. Wenn ich das so behaupte, dann meine ich gar nicht nur die gegenwärtige Oberflächlichkeit in Sachen Evangelisation. Auf diesem Feld, so können wir uns sicherlich einigen, ist die Oberflächlichkeit besonders auffällig. Aber ich denke nicht nur an moderne Evangelisationsmethoden im Vergleich und im Kontrast zu den evangelistischen Anstrengungen früherer Tage – beispielsweise die heutige Tendenz zur Ausgelassenheit und zu Methoden, die unsere Väter zutiefst schockiert hätten. Ich denke aber auch und zuallererst an das Leben der Gemeinden von heute ganz im Allgemeinen, für die das auch zutrifft, selbst in Dingen wie ihre Vorstellung von Heiligkeit oder wie sie der Frage nach der Heiligung und der Lehre von einem gottgefälligen Leben nachgehen.
D. Martyn Lloyd-Jones – Bergpredigt: Predigten über Matthäus 5,3–48
Für uns ist es daher wichtig, nach der Ursache für diese Situation zu fragen. Meinerseits schlage ich vor, dass die Hauptursache für diesen Zustand unser Verhältnis zur Heiligen Schrift ist. Wir haben versagt, sie ernst zu nehmen, wir haben versagt, sie so zu nehmen, wie sie ist, und sie zu uns reden zu lassen. Verbunden damit ist auch unsere ständige Tendenz, von einem Extrem ins andere zu fallen. Aber die Hauptursache – das ist meine Überzeugung – liegt in unserer Haltung zur Heiligen Schrift. Lasst mich etwas genauer erklären, was ich damit meine.
Ein paar Seiten später, geht der Autor auf die Bibelstelle aus Philipper ein:
Letztlich, diese Betrachtung muss uns vor Augen geführt haben, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen. Sie und ich, wir sind in den oben genannten Dingen gefragt. Jawohl, aber wir benötigen dabei die Kraft und Hilfe, die der Heilige Geist allein geben kann. Der Apostel Paulus sagt das so: „Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet.“ Die Kraft des Heiligen Geistes wird uns gegeben werden. Er ist Ihnen schon gegeben, wenn Sie Christ sind. Er ist in Ihnen; er wirkt in Ihnen „beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“ (Phil 2,13). Wenn wir unseren Auftrag erkennen und uns danach sehnen, ihn zu erfüllen, und diese Reinigung uns ein großes Anliegen ist, wenn wir mit dem Prozess des Abtötens beginnen, dann verleiht er uns die Kraft dazu. So lautet die Verheißung. Also dürfen wir die Dinge nicht tun, von denen wir wissen, dass sie uns schaden. Wir leben als solche, die von ihm mit Macht ausgerüstet sind. In einem Satz hört sich das so an: „Schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist’s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“ (2,12.13). Beide Seiten sind absolut wichtig. Wenn wir allein unser Fleisch töten, in unserer eigenen Stärke und Macht, dann schaffen wir einen falschen Typus von Heiligung, der eigentlich gar keine Heiligung ist. Erkennen wir aber die eigentliche Macht und das Wesen der Sünde – ihren Griff, mit dem sie die Menschen hält, ihren verunreinigenden Effekt –, dann wird uns bewusst, wie geistlich arm und schwach wir sind. Und dann werden wir stets um die Kraft flehen, die allein der Heilige Geist uns geben kann. In dieser Kraft wird es uns dann gelingen, das „Auge auszureißen“ und „die Hand abzuhauen“, das Fleisch zu töten und das Problem anzugehen. In der Zwischenzeit wirkt er in uns fort und wir bleiben nicht stehen, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden und in seiner Gegenwart stehen werden, fehlerlos, untadelig, fleckenlos und ohne Tadel.
D. Martyn Lloyd-Jones – Bergpredigt: Predigten über Matthäus 5,3–48
Schauen wir uns andere Kommentare zu Philipper an:
Das Wörtchen ‚also‘ verbindet die Verse 12-13 mit den unmittelbar vorangehenden. Christus gehorchte dem Vater und führte seinen Plan bis zum Tod am Kreuz aus ( V. 8). Die philippischen Christen sollen sich nun um denselben Gehorsam bemühen und Paulus‘ Anweisungen, in denen er sich auf das Beispiel Christi stützt, befolgen.
Die Bibel erklärt und ausgelegt – Walvoord Bibelkommentar
Die folgende Ermahnung ist sehr direkt und deutlich formuliert, doch ihre Strenge wird gemäßigt durch die Zuneigung des Apostels, die in der Anrede „meine Lieben“ mitschwingt. Dieser liebevolle Ton rief in den Philippern zweifellos Erinnerungen an den ersten Besuch des Apostels und seines Mitarbeiters Silvanus wach. Damals hatte er sie zum christlichen Glauben hingeführt und bekehrt und eine Gemeinde in ihrer Stadt gegründet ( Apg 16,19-40 ). Sie waren seinen Anweisungen rasch und bereitwillig nachgekommen, als er bei ihnen war. An diese Bereitwilligkeit erinnert der Apostel sie nun und fordert dann von ihnen den gleichen Gehorsam auch jetzt, da er fern ist. Schon zuvor hatte er betont, daß seine Abwesenheit ihren christlichen Wandel nicht beeinträchtigen darf (Phil 1,27).
Die Forderung, die er im Hinblick auf ihre geistliche Weiterentwicklung und im Blick auf das Vorbild Christi an sie richtet, klingt hart: „Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern.“
Dieser Satz wird allgemein so ausgelegt, daß es darin um die persönliche Rettung der Heiligen in Philippi geht. Sie werden aufgefordert zu „schaffen“, d. h. in ihrem alltäglichen Leben in die Tat umzusetzen, was Gott durch den Geist in ihnen bewirkt hat. Sie sollen ihre Rettung nicht selbst herbeiführen, sondern die Rettung, die Gott ihnen bereits geschenkt hat, in ihrem Leben Wirklichkeit werden lassen. Angesichts der Uneinigkeit und des Hochmuts, die offenbar in Teilen der Gemeinde herrschten, scheint diese Deutung richtig. Einige Gläubige in Philippi waren anscheinend nichts weniger als selbstlos und stellten die Bedürfnisse der anderen keineswegs über ihre eigenen (vgl. Phil 2,3-4).
Manche Exegeten verstehen Paulus‘ Aufforderung aber auch als Aufruf zu einem wirklichen gemeinsamen Leben der ganzen philippischen Gemeinde. Die Anhänger dieser These finden einen Anhalt im unmittelbaren Kontext des Abschnitts, denn Paulus wirft den Philippern hier vor, daß sich jeder nur um sich selbst kümmere (vgl. V. 4). In diesem Fall bezöge sich das „Seligwerden“ auf die Erlösung der gesamten Gemeinde aus ihrer Uneinigkeit, ihrem Stolz und ihrer Selbstsucht.
Vielleicht ist es am besten, beides in diesem Vers zu sehen – die Umsetzung der persönlichen Erlösung in die Praxis und die Rettung oder Befreiung der gesamten Gemeinde aus allem, was sie davon abhielt, den Segen Gottes in seiner ganzen Fülle zu erfahren.
Das Bemühen um diese Ziele soll „mit Furcht und Zittern“, d. h. in absolutem Vertrauen auf Gott, nicht auf sich selbst, geschehen.
Der einzige Weg zur Erfüllung der Forderung des Apostels führt über Gott, der die Christen dazu befähigen kann, nach seinem Willen zu leben ( V. 13). Paulus erinnert die philippischen Heiligen daran, daß Gott ja in ihnen wirkt und ihnen das Wollen und das Vollbringen schenkt, so daß sie ihm wohlgefällig leben können. Zu einem solchen Lebenswandel sind sowohl die göttliche Befähigung als auch die menschliche Verantwortung nötig. Die Gläubigen sind Partner Gottes, sie arbeiten mit ihm zusammen. Das Verb wirkt ( V. 13) ist gleichbedeutend mit „Kraft geben“ oder „befähigen“. Gott macht die Seinen bereit und willig dazu, sein Werk zu vollbringen.
Wie viel Unheil gestiftet werden kann, wenn Bibelverse für sich allein, aus dem Zusammenhang gerissen, gelesen werden, lässt sich an Vers 12 erahnen. Wie viele seelsorgerliche Nöte sind entstanden, weil einer dieses Wort: »Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern« gelesen hat, ohne auf den Zusammenhang zu achten. Vers 12 kann nicht ohne Vers 13 gelesen werden! Sonst muss ein verzerrtes Bild entstehen, aus dem die Werkgerechtigkeit folgt. Dieser zwölfte Vers sollte aber ebenfalls nicht ohne den fünften Vers gelesen werden. Der Eindruck, den moderne Übersetzungen vermitteln, dass Paulus hier mit einem neuen Einsatz beginnt, trügt. Das »Damit« am Anfang des Verses weist zurück auf die Aufforderung in Vers 5: »Ein jeglicher sei gesinnt wie Jesus Christus auch war. Dass diese Gesinnung sehr stark mit dem Gehorsam zusammenhängt, wurde aus den Versen 6-11 deutlich. Daran knüpft die Rede vom »Gehorchen« hier an. Paulus ruft die Gemeinde in Philippi weiterhin zum Gehorsam auf. Dabei geht es nicht um etwas Neues. Die Gemeinde hat ihren Gehorsam gezeigt, noch als Paulus bei ihnen war, aber auch zu allen anderen Zeiten. Hier geht es um den Gehorsam im Blick auf die Lösung des besonderen Problems in Philippi.
Gerhard Maier – Edition C
Die Gemeindeglieder sollen gerade in ihren Streitigkeiten den Sinn Christi sich zu eigen machen. Setzen sie ihre eigenen Interessen über die Interessen der Gemeinde – und das bedeutet über die Interessen Christi – dann haben sie den Heilsweg verfehlt und befinden sich nicht mehr in der Nachfolge. Die Aufforderung, ihr eigenes Heil zu schaffen, ist bedeutungsgleich mit der Aufforderung, gehorsam zu sein. Der Gehorsam soll ja nicht Paulus zuliebe geschehen. Vielmehr wirkt Gott in uns so, dass wir auf sein Wort hören und gehorsam das tun bzw. lassen, was seinem Willen entspricht. Das Heil wird keineswegs verdient. Dieser Gedanke ist nirgends in diesen Versen zu finden. Aber ebenso wenig wie das Heil verdient wird, wird es außerhalb der Nachfolge und des Gehorsams empfangen. Das Heil ist und bleibt Geschenk. Wie aber alle Geschenke, so will auch das Geschenk der Gnade angenommen werden. Die Begriffe »Gehorsam« und »Gnade« schließen sich gegenseitig nicht aus. Vielmehr stehen sie in einer engen Beziehung zueinander. Wo kein Gehorsam ist, ist Gnade notwendig, aber wo Gnade angenommen wird, wird Gehorsam folgen.
Auch im Deutschen können wir den Gehorsam umschreiben mit der Wendung »hören auf etwas«. Dies ist die Grundbedeutung des griechischen Wortes. Es ist ein Grundsatz der frohen Botschaft, dass sie uns aus Gnaden frei verkündigt wird. Doch wie Römer 10,13ff. zeigt, kommt es darauf an, dass diese Botschaft gehört und angenommen wird. Gehorsam ist die Annahme der Botschaft. Wir könnten auch sagen, dass Gehorsam die Antwort auf die Verkündigung der frohen Botschaft ist.
Wir erleben eine zunehmende Abneigung gegenüber dem Begriff Gehorsam. Unsere Ideale, wie Freiheit und Selbstentfaltung, finden darin keinen Platz.
»Gehorsam« in der Sprache der Bibel setzt aber menschliche Freiheit voraus. Gehorsam ist die freie Antwort auf das Wort Gottes. Es geht hier um eine Beziehung in beide Richtungen: Gott Mensch, Mensch – Gott. Von daher wird auch deutlich, dass »Gehorsam« mit der Redewendung in unserem Vers »euer eigenes Heil schaffet« zu tun hat. »Heil- (griech. soterlia) als Rettung vor dem Verderben ist nicht ohne die Verbindung zu Gott denkbar. Kamen das Verderben und der Tod als Ergebnis der Trennung von Gott, so ist die Rettung, das Heil nur als Ergebnis der Wiederherstellung der Verbindung zu Gott zu verstehen. Diese Verbindung ist aber gekennzeichnet von der Wechselwirkung zwischen Wort und Antwort. Diese Antwort ist jedoch nicht nur ein Geschehen in Worten, sondern Ausdruck unseres ganzen Lebens. Gehorsam ist ein »auf den Ruf Gottes Hören« mit all dem, was wir tun. Dies hat also nichts mehr mit dem Selbstbehauptungstrieb zu tun, sondern bedeutet ein Leben in der Hingabe und in der Nachfolge. Der Zeitgeist unserer Tage kann nichts mit dem Gedanken des Gehorsams anfangen, weil ihm die Beziehung zwischen Gott und Mensch fehlt.
Dreierlei muss noch zu der Wendung: »Schaffet mit Furcht und Zittern euer eigenes Heil« gesagt werden. Zum ersten gibt »schaffet« das zugrundeliegende griechische katergazesthe nur ungenügend wieder. Das liegt an der vielschillernden Bedeutungsskala des deutschen Wortes. »Schaffen« kann sowohl die schöpferische Tätigkeit des Schaffens aus dem Nichts, als auch etwa die Durchführung einer Tätigkeit bedeuten. Nur Letzteres ist mit dem griechischen Wort ausgesagt. Es geht hier keineswegs um eine Urhebertätigkeit. Es geht nicht um das Bewirken des Heils, sondern um seine Ausarbeitung. Es geht nicht um die Voraussetzung, sondern um Konsequenzen. Unser seelsorgerliches Dilemma wird hier ganz ernstgenommen. Gott weiß wohl, dass wir als eine Form der Versuchung streckenweise den Glauben und das Glaubensleben als eigene Leistung empfinden. Er teilt uns aber mit, dass dieses unser persönliches Empfinden nicht das Maßgebliche ist, sondern dass er derjenige ist, der auch in der Versuchung uns beisteht und uns die Kraft zum Glauben gibt. Die Gemeinde in Philippi wird aufgerufen, die von Gott gegebenen Zusagen (s. V. 1-4) in ihrem Leben zur Entfaltung kommen zu lassen (V. 13).
Das in Vers 13 zweimal verwendete Wort energein hat nun die oben zuerst genannte Bedeutung von »schaffen«. Gott allein ist der Urheber des Heils. Aber doch nimmt er uns als seine Geschöpfe und freiheitliche Wesen ernst. Wir sind für ihn keine unpersönliche Modelliermasse, die sich passiv gestalten ließe, sondern er sehnt sich danach, dass wir aus freien Stücken unsere Liebe hin erweisen, gerade auch Gehorsam. Dass diese Liebe, die wir zu ihm erweisen, nur aus der von ihm her kommenden Liebe entspringen kann, ist eine Erkenntnis, die dem Glaubenden vorbehalten bleibt.
In diesen Zusammenhang gehört dies als zweites: Oftmals wird »Mit Furcht und Zittern« im Sinne einer falschen Gesetzlichkeit verstanden. Sowenig die »Ausarbeitung unseres Heils« die Ursache unserer Rettung ist, so verkehrt wäre es, diese Wendung in jenem Sinne auszulegen. Durch eigenes Schaffen wird keiner das Heil erlangen, auch derjenige nicht, der bangt und sich ängstigt, der aus Angst vor dem Verlorengehen in eine verzweifelte Werkgerechtigkeit abgleitet. Ebenso falsch wäre es, die Wendung »mit Furcht und Zittern« in ihrem Gewicht abmindern zu wollen, indem man darauf hinweist, dass es sich hier um eine stehende Redewendung handelt. Zwar verwendet Paulus diese schon aus dem AT bekannte Wendung mehrmals (1Kor 2,3; 2Kor 7,15; Eph 6,5), aber nie in einer abgegriffenen Bedeutung. Gerade die Zusammenstellung der beiden Begriffe »Furcht« und »Zittern« soll ja die schwerwiegende Bedeutung der Sache, um die es geht, zum Ausdruck bringen. Dies ist es, woran wir uns schwertun. Es erscheint uns anstößig, unsere Beziehung zu Gott und unser ethisches Leben von der Furcht kennzeichnen zu lassen. Wir denken zu Recht an Stellen wie Römer 8,15 oder 1Johhannes 4,18, wo uns die Überwindung der Furcht in Jesus Christus zugesprochen wird. Auch in Phil 1,14 war schon die Rede von der Überwindung der Furcht. Das ist auch der Grundzug des Evangeliums, der frohen Botschaft: Den Jüngern Jesu ist der Grund zum Fürchten weggenommen: Das bedeutet, dass sie nicht mit der unbegründeten Furcht, mit der Angst, leben müssen. Die moderne Psychologie hat uns den Unterschied zwischen Furcht und Angst aufgezeigt. Furcht richtet sich gegen etwas Bestimmtes. Angst dagegen hat kein klares Gegenüber. Sie ist ein beengendes und beklemmendes Gefühl, das zwar eine Gefahr wahrzunehmen meint, diese Gefahr aber nicht näher bestimmen kann. Angst brauchen wir als Christen nicht zu haben. Wir dürfen uns geborgen wissen in Gottes Hand.
Und dennoch sollten wir nicht »furchtlos« sein. Die Bibel als Ganzes und auch das NT im besonderen sprechen einhellig von der Wirklichkeit der Furcht bei solchen Menschen, die Gott begegnet sind (z. B. Lk 5,8-10). Die Bibel weiß in vielfältiger Weise davon zu berichten, dass die Begegnung mit Gott die Heiligkeit und Mächtigkeit Gottes dem Menschen so konkret werden lassen, dass der Mensch davor fast vergeht. Ist es möglich, dass uns die Gottesfurcht deswegen nicht mehr bekannt ist, weil unsere Beziehung zu Gott abgeflacht ist und wir ihm nicht in seiner Heiligkeit und Größe begegnen? Können wir das mitempfinden, was in Hebräer 10,31 steht: »Schrecklich (furchtbar) ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen?« Oder haben wir uns an einen kameradschaftlichen Umgang mit dem allmächtigen Schöpfer und Erhalter gewöhnt? Die Erfahrung des Göttlichen muss ein Schaudern nach sich ziehen. Das spricht aber keineswegs gegen die Erfahrung der göttlichen Liebe. Im Gegenteil: Je mehr uns die Größe und Herrlichkeit Gottes bewusst wird, desto tiefer wird unser Empfinden seiner Liebe sein. Gott ist für den Menschen unserer Tage allzu oft der »liebe Gott«. Er wird verharmlost. Bibelworte wie Philipper 2,12 machen aber deutlich, dass die Erfahrung der Liebe und Gnade Gottes die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott, zur Folge haben muss. Dies ist auch das Entscheidende, denn die Furcht ist für Christen als Ehrfurcht allein Gott vorbehalten. Philipper 1,28 hat gezeigt, dass wir unseren Feinden furchtlos gegenüberstehen sollten. Als Jünger Jesu und Kinder Gottes brauchen wir keine Angst zu haben, auch keine Furcht vor irgendwelchen Dingen oder Personen. Je mehr wir aber in der Erkenntnis Gottes wachsen, desto mehr werden wir davon überwältigt und auch erschüttert werden. Die Gottesfurcht ist als Ehrfurcht weit mehr als das heutige Ideal des Respekts.
Das Dritte zu o. g. Wendung betrifft die Worte »euer eigenes Heil«. Das Griechische hat verschiedene Möglichkeiten, das Verhältnis des Besitzes zum Ausdruck zu bringen. Die hier gewählte Form ist die stärkste. Paulus macht deutlich, dass jeder Einzelne der Philipper zunächst einmal eine Verantwortung für sein eigenes Glaubensleben und für seine eigene Beziehung zu Gott trägt. Die in Philippi laufenden Streitigkeiten übersahen womöglich diese Tatsache völlig. Auch in diesem Fall ist der Zusammenhang und die Situation in Philippi maßgebend. Es ist eindeutig eine Warnung an Christen, die sich weniger um ihre eigenen Glaubensangelegenheiten kümmern als um die ihrer Mitchristen. In ihrem Eifer wollen sie andere dazu zwingen, sich zu ändern. Der 13. Vers macht es deutlich, dass dies ein sinnloses Unterfangen ist.
Vers 13 begründet die vorausgehende Ermahnung. Wir lesen diesen Vers sicherlich falsch, wenn wir ihn als Gegensatz zur eben gemachten Aussage verstehen. Die streitenden Christen sollen verstehen, dass sie den anderen nicht ändern können. Diese Arbeit bleibt dem Heiligen Geist vorbehalten: »Gott ist es nämlich, der in euch vollbringt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu (seinem) Wohlgefallen.« Zu Recht fühlen wir uns in der Zwiespältigkeit unseres Herzens angesprochen. Wir merken, wie schwer das Glaubensleben sein kann und wie oft wir versagen, weil wir selbst die Kraft nicht haben. Und doch erkennen wir immer wieder im Nachhinein, wie Gott es gerade war, der uns durchgeführt hat. Dennoch gilt diese Aussage – vor allem bezogen auf die Art und Weise des Umgangs miteinander in der Gemeinde. Was für mich gilt, gilt auch für meinen Bruder. In seinem Leben ist es mit dieser Zwiespältigkeit kein bisschen anders.
Zwar kann ich ihm beistehen; vielleicht wird es mir auch vergönnt sein, ihm eine Hilfe zu sein, aber auch das nur unter der Voraussetzung, dass Gott es ist, der durch mich wirkt. Die Philipper – ihnen wir alle – sollten Vertrauen und Gelassenheit im Blick auf den Nächsten lernen. Gott ist auch am Wirken im Leben unserer Brüder und Schwestern. So sehr wir sie ernstnehmen sollen und zur gegebenen Zeit auch ermahnen und trösten, dürfen wir getrost sein in dem Wissen, dass Gott, »der in uns das gute Werk angefangen hat, es auch vollführen wird bis an den Tag Christi Jesu« (Phil 1,6). Gott allein ist Urheber und Vollender des Heils. Diese Aussage des ersten Kapitels wird hier bestätigt und entfaltet mit dem Begriff, der hinter der notdürftigen Übersetzung »vollbringen« (griech. energein) steht. Dieser Begriff meint »Aktivität« als Gegensatz zur Passivität. Als Christen sind wir nicht passiv. Der so weit verbreitete Schicksalsglaube lähmt und hat nichts mit dem Wirken Gottes in einem Menschenleben zu tun. Als Christen sollen wir aktive Menschen sein. Nur muss uns bewusst sein, dass Gott es ist, der in uns diese Aktivität ermöglicht und auch bewirkt.
Ganz entscheidend ist der Zusammenhang zwischen dem »Wollen« und dem »Vollbringen«. Unser menschliches Elend hängt oft am Auseinanderklaffen von Willen und Tun (vgl. Röm 7,14-25). Unser menschlicher (angebotenen und anerzogener) Wille wird nicht gänzlich durch den göttlichen Willen ersetzt. Es wird unsere lebenslange Aufgabe sein, das Gebet: »Nicht mein, sondern dein Wille geschehe« zu lernen und täglich zu beten. Das ist auch mit der Aufforderung gemeint, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen, unseren eigenen Willen, den alten Menschen, täglich Gott aufs neue zu übergeben, ihm unser Leben samt Wille und Tat zu übereignen. So bringt die Faust’sche Formel: »Zwei Seelen wohnen, ach!, in meiner Brust« die Erfahrung eines jeden Christen zum Ausdruck. Gott schenkt uns das neue Wollen, das das Vollbringen ermöglicht und als Konsequenz nach sich zieht. Gleichzeitig muss aber unser eigener Wille, der von unserer Selbstsucht geprägt ist, überwunden werden.
Die Rolle unseres Willens im Glaubensleben sollte nicht unterschätzt werden. Auf die Tat allein kommt es nämlich nicht an. Das wird z. B. in 1Korinther 13 deutlich, oder auch in 2Korinther 8,10: »… das ist euch nützlich, die ihr seit vorigem Jahr angefangen habt, nicht allein mit dem Tun, sondern auch mit dem Wollen.« Im »Kollektenteil« des zweiten Korintherbriefes wird bestätigt, dass Gott nicht einfach den Geber liebt, sondern den fröhlichen Geber. Mein Wille muss hinter meiner Tat stehen. Wenn ich etwas widerwillig für Jesus tue, dann hat es keinen Wert. Auch wir Christen dürfen nicht in einen falschen Pragmatismus abgleiten. Das Zeichen des Neuen Bundes ist das neue Herz (Jer 24,7; 31,31-33; Hes 11,19ff.; Hes 36,26ff.). Hier ist das Herz als Sitz des Willens angesprochen. Unser Herz soll Jesus gehören, und der Wille soll seinem Willen entsprechen. Gott ist immer am Werk in unserem Leben, wenn wir tätig werden: Er ist es aber auch, der die Motivation dazu gibt.
Das mit »Wohlgefallen« wiedergegebene Wort war bereits in Phil 1,15 vorgekommen, wo wir es, auf den Menschen bezogen, als »gütige Gesinnung« übersetzt haben. Auch hier geht es um eine »gütige Gesinnung«. Der Unterschied liegt darin, dass das Wort sich hier auf Gott bezieht. »Wohlgefallen« sollte keinesfalls als willkürliche Entscheidungsfreiheit verstanden werden, sondern als Ausdruck des Ratschlusses, den Gott zum Heil der Welt gefasst hat. Gottes Wille ist gut, und seine Gesinnung uns gegenüber ist gütig. Darum schafft er in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. So gefällt es Gott wohl. Nichts macht er lieber als gerade dies in einem Menschenleben. Darum sind wir mit den Philippern aufgefordert, unser Leben von Gott umkrempeln zu lassen. Zwei Verse Michael Hahns bringen diesen Gedanken gut zum Ausdruck: »
Frei ungebundner Gott, du alldurchdringend Wesen,
Dich hab ich mir allein zum Herrscher auserlesen.
Besitze mich im Grund und nimm mich gänzlich ein
Und mache selbst dein Haus ganz und vollkommen rein!
Du wirkest ja so gern in einer Menschenseele.
Ach wirke auch in mir, du edle Lebensquelle! Erfülle mich doch ganz mit deiner Lebenskraft, die mich zum Gotteskind und Geistestempel macht!«
Gerade dieses Wohlgefallen Gottes bzw. seine gütige Gesinnung begegnet uns auch im Alten Bund. Heilsbotschaften der Propheten (z. B. Jes 44,21-23) bringen sowohl die gütige Gesinnung Gottes zum Ausdruck als auch die Tatsache, dass Gott es ist, der die Erlösung und das Heil in seinem Volk und im Menschenleben bewirkt. Der Ratschluss Gottes über diese Welt verbindet Alten und Neuen Bund.
Diese »gütige Gesinnung« hat nichts mit einer Laune zu tun, sondern meint den Ratschluss Gottes über die ganze Welt und ihre Geschichte. An Gottes Wohlgefallen und an seiner gütigen Gesinnung misst sich alles andere. Ich darf wissen, dass mein persönlicher Weg, mein ganzes Tun, Handeln und Wollen nicht losgelöst gesehen werden kann von Gottes Ratschluss über diese Welt. Dies hat nichts mit Schicksalsglaube, oder mit einer so verstandenen Prädestinationslehre zu tun. Vielmehr darf ich wissen, dass Gottes gütige Gesinnung auch mir gilt. Deswegen – und nur deswegen – will er beides in mir aktivieren, sowohl Wollen als auch Vollbringen.
Nach dem begründenden Vers 13 werden in Vers 14 die Einzelermahnungen fortgesetzt. Es steht wieder die Aufforderung: »Tut!« im Mittelpunkt. Auch das Verständnis dieses Verses hängt sehr stark von der rechten Betrachtung des Zusammenhangs ab. Das halblaute Murren sowie das offene Widersprechen sind Ausdruck davon, dass zwar etwas getan wird, aber nicht mit der rechten Motivation (vgl. 2Kor 8,10ff.; 1Kor 13). Aber auch der große Zusammenhang muss im Blickfeld behalten bleiben. Wie wir an Vers 15 sehen werden, sind Murren und Widerreden Ausdruck des in Philippi vorhandenen Streites. »Den Sinn Jesu Christi zu haben« schließt beides aus.
Auch das kleine, aber entscheidende Wort »alles« will recht verstanden werden. Gerade wegen dieses Wortes besteht die Gefahr, dass der Satz verallgemeinert wird. Zunächst einmal steht das Wort »alles« im Urtext am Anfang des Satzes, wo es seine besondere Betonung bekommt. Aber ebenso wenig, wie das Wort in Phil 4,13 im allgemeinen Sinn verwendet wird, wird es hier im Sinne von »alles oder jedes« verwendet. Hier und dort verwendet Paulus dieses Wort im Sinne von »all dies«. Er redet hier nicht allgemein, sondern von ganz bestimmten Ermahnungen und Aufforderungen, die er der Gemeinde gegeben hat.

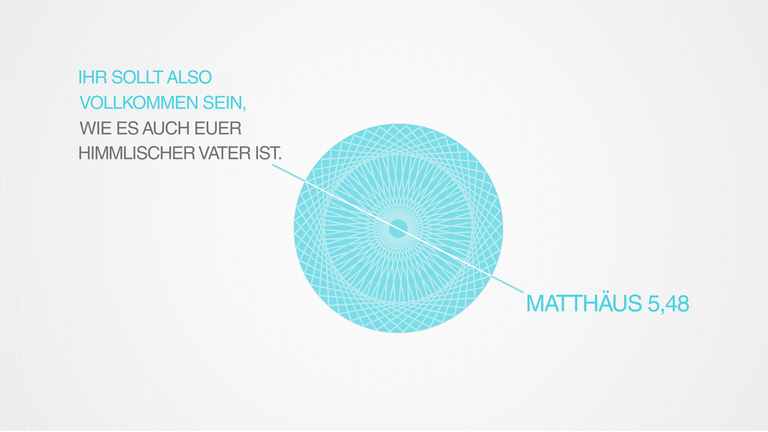
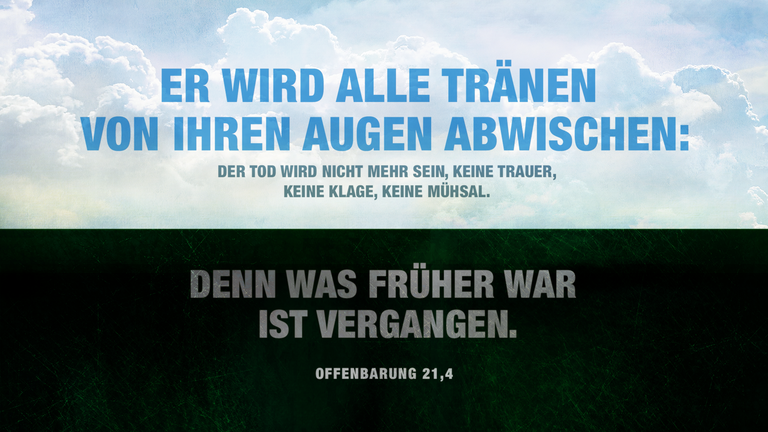

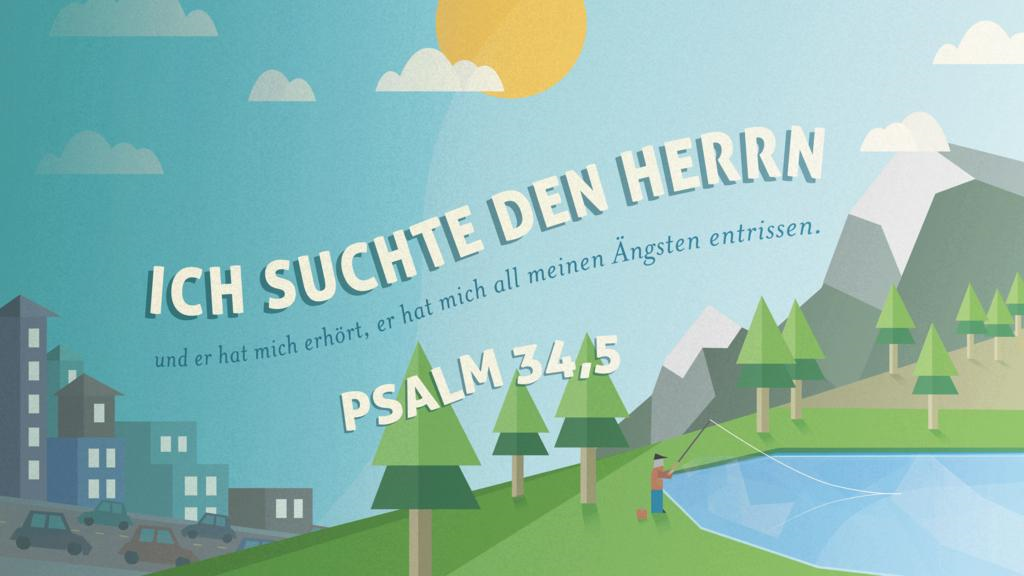


Neueste Kommentare