folgende Meldung wurde von wissenschaft.de heute früh veröffentlicht
Löschen leicht gemacht
Angstzustände könnten sich durch einfache Verhaltens-Technik behandeln lassen
Eine einfache Verhaltens-Technik kann helfen, traumatische Erinnerungen zu löschen: Wird die angstauslösende Erinnerung zurück ins Gedächtnis gerufen und direkt anschließend noch einmal mit einem Sicherheitsgefühl gekoppelt, überschreibt die neue Erinnerungs-Emotions-Kombination die alte. Das haben US-Forscher jetzt bei Freiwilligen gezeigt, nachdem sie bereits Anfang des Jahres das Prinzip an Ratten nachgewiesen hatten. Entscheidend ist dabei vor allem das Timing der Neuverknüpfung: Sie muss innerhalb eines bestimmten Zeitfensters nach dem Wiederaufrufen der Erinnerung stattfinden, sonst wird die Angst lediglich unterdrückt und nicht gelöscht. Gelingt die neue Verbindung aber innerhalb des richtigen Zeitfensters, hält der Effekt mindestens ein Jahr an, berichten Daniela Schiller von der Universität von New York und ihre Kollegen.
Nach dem aktuellen Stand der Hirnforschung gehen Wissenschaftler davon aus, dass Erinnerungen nicht fest im Hirn verankert sind, sondern in einem dynamischen Prozess immer wieder hervorgeholt und neu abgespeichert werden. Darauf basiert auch eine Behandlungsmethode bei Angstzuständen beziehungsweise traumatischen Erinnerungen, die Extinktion: Dabei wird ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem der Patient lernt, mit der Angst auslösenden Situation umzugehen. Er wird so lange in einer sicheren Umgebung damit konfrontiert, bis sich die Ängste mildern. Danach verschwindet die Angst für einige Zeit, Stress kann sie jedoch wieder auslösen. In ihrer aktuellen Studie fanden die Forscher nun heraus, dass sich die Wirkung dieses Ansatzes verbessert, wenn die Erinnerung zunächst angeregt wird.
An Ratten hatten sie diese Hypothese bereits getestet: Sie konditionierten die Tiere, indem sie sie Elektroschocks aussetzten und zeitgleich einen Ton abspielten. Später konfrontierten die Forscher dann eine Gruppe der Tiere kurz mit dem Ton, warteten etwas und setzten sie dann wieder dem Ton ohne den Elektroschock aus. Das Ergebnis: Einen Tag später zeigten diese Ratten keine Angst mehr vor dem Signal. In einer anderen Gruppe, die den Ton lediglich während der Extinktion hörten, löste dieser weiterhin Angst aus.
Das gelang jetzt auch beim Menschen: Die Forscher zeigten Probanden Bilder mit farbigen Quadraten, während diese leichte Stromstöße am Handgelenk spürten. Nach einer Zeit verbanden die Testteilnehmer Bild und Schmerz, und die Leitfähigkeit ihrer Haut als Maß für eine Angstreaktion änderte sich schon bei einer Konfrontation mit den Bildern. Einen Tag später behandelten die Wissenschaftler die Probanden mit Hilfe der Extinktion – einige, nachdem sie das Bild erneut gesehen hatten, andere ohne diese Erinnerung. Es zeigte sich, dass die Probanden, die vor der Extinktion mit den farbigen Quadraten konfrontiert wurden, noch ein Jahr nach der Behandlung keine veränderte Leitfähigkeit der Haut beim Anblick des Bildes zeigten. Das galt allerdings nur, wenn die Extinktion in einem bestimmten Zeitfenster, schätzungsweise etwa sechs Stunden, stattfand. Sollte sich die Methode bewähren, könnte sie zu einer schonenden Alternative zu den auf einem ähnlichen Prinzip basierenden medikamentösen Ansätzen der Erinnerungslöschung werden.
Daniela Schiller (Universität von New York) et al.: Nature, doi: 10.1038/nature08637
ddp/wissenschaft.de – Jessica von Ahn
Also für den Schöpfer noch leichter, wenn er verspricht, dass die früheren angstvollen Gedanken nicht mehr in den Sinn zurückkehren werden – hoffentlich bald.














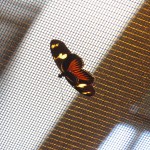




Neueste Kommentare