«Ich sprach:
,Will wahren vor Versündung durch die Zunge meine Wege
will wahren meinem Munde den Verschluß
solang der Frevler vor mir ist.‘
So schwieg ich still
verstummte vor dem Guten
jedoch mein Schmerz war heftig.
Heiß war mein Herz in meinem Innern
in meinem Sinnen loht‘ ein Feuer
da redet‘ ich mit meiner Zunge:
Neftali-Herz-Tur-Sinai – Psalm 39,2–4
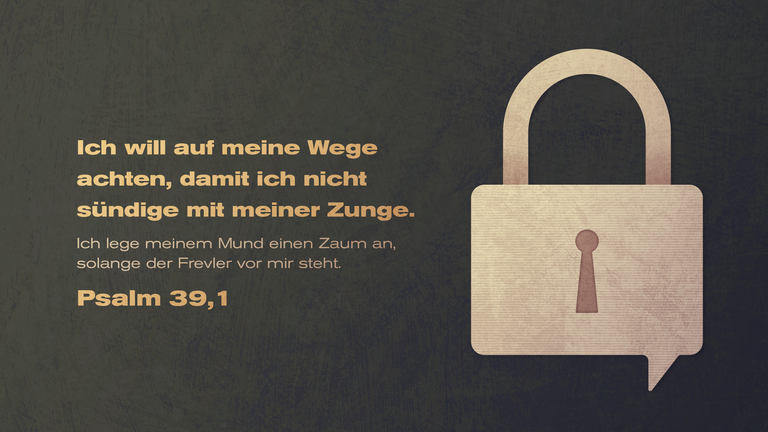
andere Übersetzungen und ein paar kleine Kommentare 2020…
Kennst du das Gefühl, dass dir ständig die Sorgen und Probleme erzählt werden? Meist noch nicht mal die Sorgen des „Sprechers“ sondern eher die Sorgen von die der „Sprecher“ gehört hat? Doch wie umgehen mit den eigenen Sorgen und Problemen? Wo diese „abladen“?
Der Sänger beschreibt seinen schweren inneren Kampf: Er wollte sich still und stumm unter das beugen, was ihm auferlegt war, vor allem auch um seiner gottlosen Umgebung willen, die aus seinen Klagen nur einen Grund zur weiteren Ablehnung Gottes entnommen hätte. Aber der innere Schmerz war so groß, daß er (ähnlich wie Hiob) doch alles aussprechen mußte.
Die Bibel mit Erklärungen: Erklärungen
5–7 Der Sänger findet eine erste Antwort auf seine Fragen durch die Erinnerung an die Vergänglichkeit alles Lebens. Es liegt eine gewisse Ironie in diesen Versen: Der Mensch ist nichts und macht doch so viel Aufhebens von sich und allen seinen kleinen Dingen! Bei dieser Erkenntnis aber beruhigt der Sänger sich nicht. Er betet weiter:
Das Achthaben auf meine Wege ( – Hi 13,15 Ps 26,11 119,30 – ) ist eine typische Ausprägung eines zu Gott hingewandten Lebens, das Errettung und Bewahrung zugleich erfuhr. Zwar hat David Gott oft genug gebeten, seine Wege zu bewahren, aber in der konkreten Situation kommt es auf ihn selbst an, ob er in der Spur Gottes bleibt oder ob er aus ihr herausfällt. Gottes Behüten und des Menschen Achtgeben sind unauflöslich ineinander verwoben. David wußte, daß es eine Schaltstelle für die Sünde gibt, nämlich die Zunge ( – Hi 27,4 Ps 15,3 34,14 119,172 Jak 3,5ff – ), die lästern und verletzend sein kann und somit dem Bösen Tor und Tür öffnet. Das Sündigen mit der Zunge besteht auch darin, daß der fromme Mensch in an sich berechtigter Entrüstung auf Anschuldigungen von Menschen mit gleicher Heftigkeit reagiert. Weil David aber den Weg Gottes gehen wollte, hatte er sich einst fest entschlossen, an seine Zunge einen Zaum zu legen, und zwar so lange der Frevler vor mir ist. Denn wer sich selbst verteidigt, weil er ein Erwählter Gottes ist, unterliegt am Ende doch. Weil es ja um Gottes Sache geht, die der Frevler am Gottesfürchtigen bekämpft, kann und darf dieser sich nicht selbst verteidigen und schützen. Letzteres gelang David mit Gottes Hilfe eine Zeitlang: Ich verstummte (in) Schweigen. Doch dann durchfuhr David ein Schmerz und heiß wurde mein Herz in meinem Inneren ( – Ps 32,3ff Jer 20,9 – ). Auch an dieser Stelle mußte David die Erfahrung machen, daß der Mensch, auch unter dem Beistand Gottes, einen einmal erreichten inneren Zustand auf die Dauer nicht beibehalten kann. David gebraucht jetzt wieder seine Zunge, nicht um vor Menschen zu reden, sondern allein vor seinem Gott.
Wuppertaler Studienbibel
Der Psalm beginnt mit dem Bericht des Psalmisten über sein Bemühen, nicht zu sündigen, indem er über seine Züchtigung spricht, während gottlose Menschen anwesend sind. Es war eine bewusste Entscheidung: „Ich sagte“ (ein definitives Verb in der Vergangenheit) legt die Umstände dieser Entscheidung vor dem Schreiben des Psalms fest. Dass es sich um eine Zeit der schweren Züchtigung handelt, geht aus den Versen 8-13 hervor. Er befürchtete, dass er den Herrn und die, die auf ihn vertrauten, in Verruf bringen könnte, wenn er sich bei Ungläubigen darüber beklagte, wie der Herr ihn in der Züchtigung behandelte. So beschloss er (Kohortenativ), „zu wachen“ (אֶשְׁמְרָה; s.v. Ps. 12:7) über seine Wege und „halte“ (dieselbe Verbform) einen Maulkorb (מַחְסוֹם) auf seinem Mund, solange Ungläubige anwesend sind (wörtlich „noch vor mir“). Wenn er sich hütete, würde er nicht mehr sündigen. Die verwendete Konstruktion ist ein Infinitiv mit einer Präposition, „vom Sündigen“ (מֵחֲטוֹא; s.v. Ps. 51:1). Dies deutet darauf hin, wovor er sich hütete – mit seiner Zunge zu sündigen, d. h. etwas Falsches oder zu den falschen Leuten zu sagen. Es könnte auch als das beabsichtigte Ergebnis interpretiert werden: „Ich will mich hüten, zu sündigen“. Er war entschlossen, sich selbst zum Schweigen zu bringen, und benutzte deshalb das Bild eines Maulkorbs (ein angedeuteter Vergleich). Das Wort „Maulkorb“ kommt von einem Verb, das „zurückhalten“ bedeutet (חָסַם). Er würde sich beim Reden zurückhalten (in ähnlicher Weise wird in Ps. 73:15 erzählt, wie der Weise seine Zweifel für sich behielt).
Ein Kommentar zu den Psalmen 1-89 – Kommentar – Kregel exegetische Bibliothek
Nach Vers 2 blieb er also „still in der Stille“ (נֶאֱלַמְתִּי דוּמִיָּה). Das Verb bezieht sich auf die vergangene Zeit: „Ich schwieg“; und das Substantiv modifiziert das Verb: „Ich schwieg in der Stille.“ Die beiden Wörter betonen, dass er völlig still war.
Er sagt auch, er schwieg „vom Guten“ (הֶחֱשֵׁיתִי מִטּוֹב). Diese Präpositionalphrase ist schwierig zu interpretieren. Delitzsch sagt, der Psalmist wende sich in seinem Schweigen „vom Wohlstand ab“ oder nehme den Wohlstand nicht zur Kenntnis, d. h. von dem, worüber er die Übeltäter frohlocken sah; er versuche, die beunruhigende Diskrepanz zwischen ihrem Wohlstand und dem gerechten Leben zum Schweigen zu bringen. Andere meinen, es bedeute „vergeblich“ oder „nutzlos“ – ich schwieg außer dem Guten, was bedeutet, dass es mir nichts nützte. Goldingay sagt, es könnte übersetzt werden: „Ich habe mehr geschwiegen, als es gut war“. Perowne argumentiert, dass die Präposition nach dem Verb „schweigen“ entweder (1) „fern von Gutem“ (ich schwieg vor Trost und Freude, d. h. ohne Trost und Freude – ich hatte keinen Trost und keine Freude) oder (2) als negative Konsequenz des Schweigens „so dass es mir nicht gut ging“ oder „es funktionierte nicht“ bedeuten würde. Diese zweite Möglichkeit würde dann mit „mein Kummer wurde aufgewühlt“ übereinstimmen. Mit anderen Worten, er versuchte zu schweigen, aber es ging nicht gut für ihn und so musste er sprechen. Was auch immer er mit dieser Formulierung gemeint hat, der Punkt ist, dass er nicht in der Lage war, diese Entscheidung, völlig zu schweigen, aufrechtzuerhalten. Der Kummer oder Schmerz (כְּאֵב, vom Verb כָּאֵב, „Schmerzen haben“) bezieht sich auf den geistigen und körperlichen Schmerz (in Form von Enttäuschung und Unglück), den der Psalmist sicherlich erleiden würde, weil er mit dem Problem seines eigenen Schmerzes und seiner Distanz zu den guten Seiten des Lebens, die er zu ignorieren versuchte, kämpfte. Allmählich begann sich all dies zu regen, so dass er seine aufgestauten Gefühle nicht mehr kontrollieren konnte.
Sein Stress und sein Schmerz wurden so stark, dass er schließlich sprechen musste – aber er sprach zum Herrn. Sein Herz wurde „heiß“ (חַם), denn in seiner Betrachtung der Dinge begann ein „Feuer zu brennen“. Dies sind Bilder für seine zunehmende Angst über sein schmerzliches Dilemma (möglicherweise metonymisch, wenn er fieberte). Inneres Brennen ist in der Schrift ein Begriff, der mit leidenschaftlicher Intensität verbunden ist, die Menschen zum Handeln bewegt (vgl. Jer 20,9; Lk 24,32) – hier ist es der Schmerz und die Angst, die ihn zum Aufschrei bewegen. Das Verb „brennen“ (תִּבְעַר) kann mit „zu brennen beginnen“ oder „brennen“ übersetzt werden, weil die Erregung so groß wurde, dass er nicht mehr schweigen konnte. Das Brennen fand während seines „Grübelns“ statt, d. h. je mehr er darüber nachdachte, desto schmerzhafter wurde es. Das Wort, das mit „grübeln“ übersetzt wird, könnte eigentlich ein Wort für „seufzen“ sein (von הָגַג, „sich sehnen, brennen“, und nicht von הָגָה, „meditieren, sinnieren“. Schließlich konnte er sich nicht mehr zurückhalten und beschwerte sich laut („mit meiner Zunge“) bei dem Herrn (V. 4). Es könnte sein, dass dieses Reden Gott mit seinen Worten zu tadeln schien und in sein Bekenntnis in Vers 9 aufgenommen wurde; oder, was wahrscheinlicher ist, dass das Reden hier einfach sein Schrei zu Gott über seine Qual ist und sich nicht an Ungläubige richtet und daher keine Vergebung nötig wäre. Jedenfalls umfasst der Rest des Psalms das, was er mit seiner Zunge sprach: Er sprach zum Herrn über seinen Kummer, seine Sünde und seine verbleibenden Jahre.


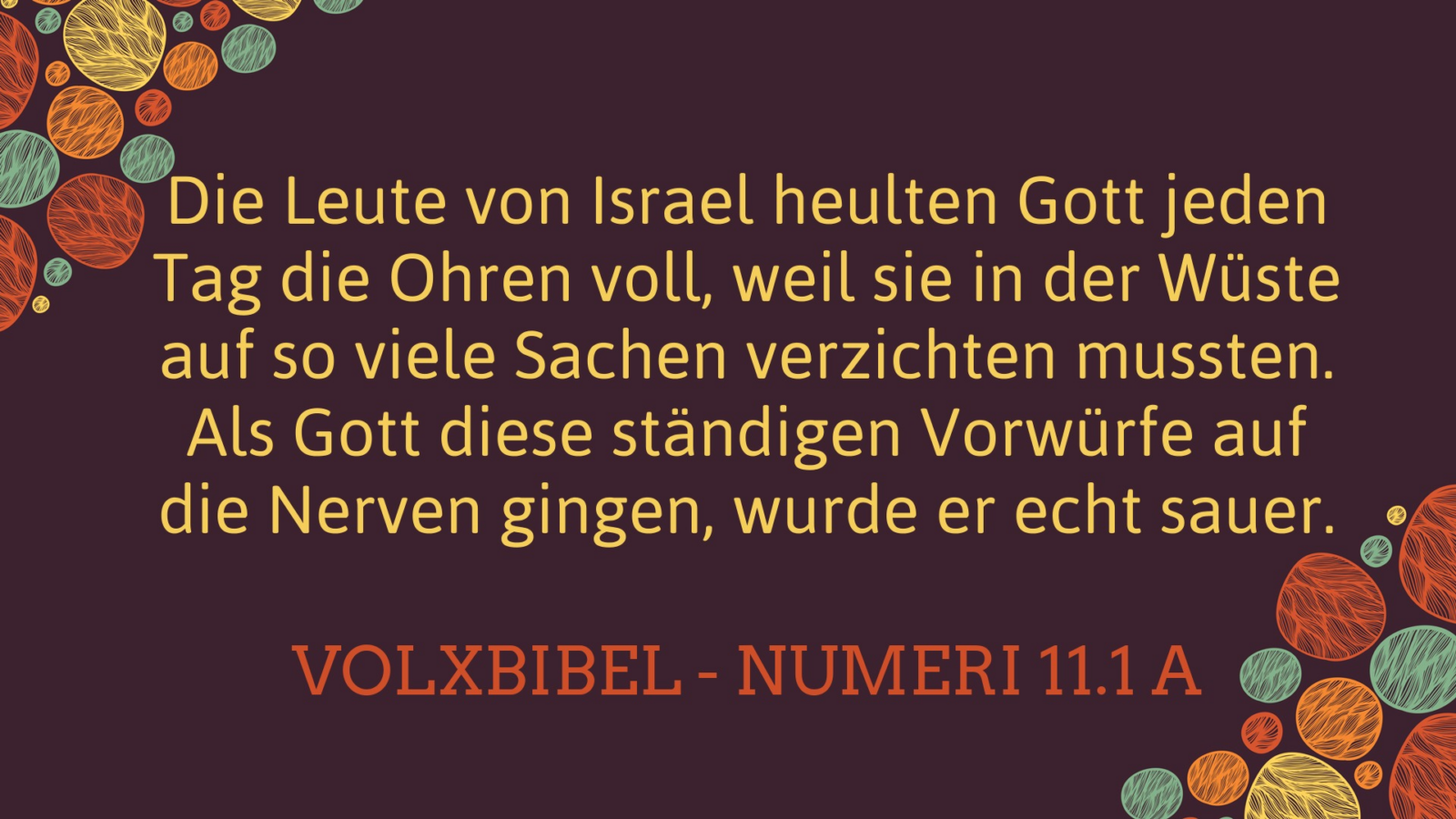
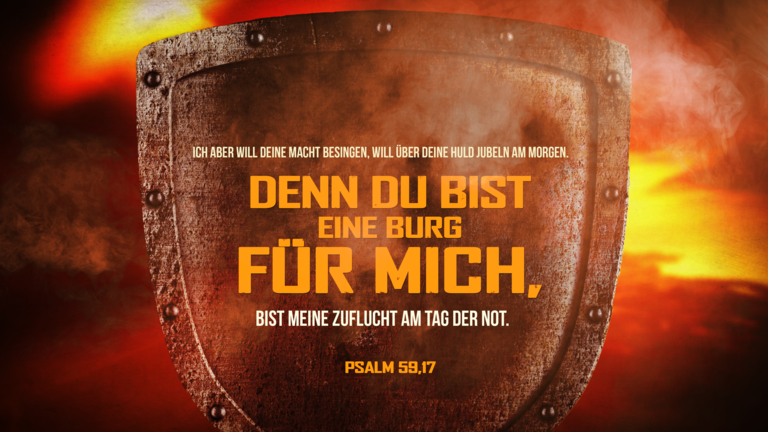
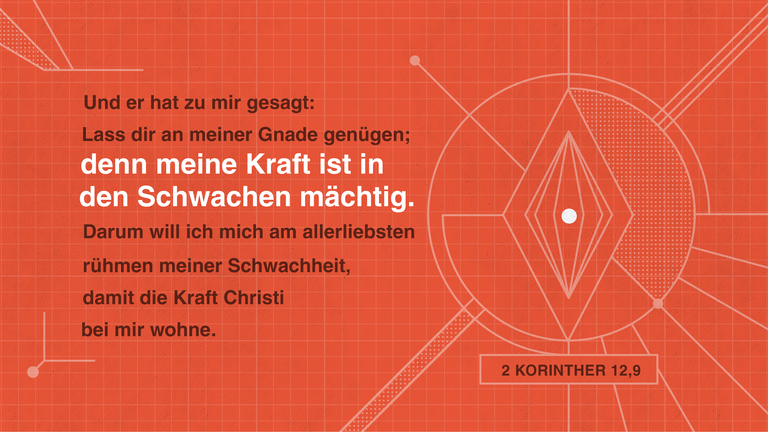
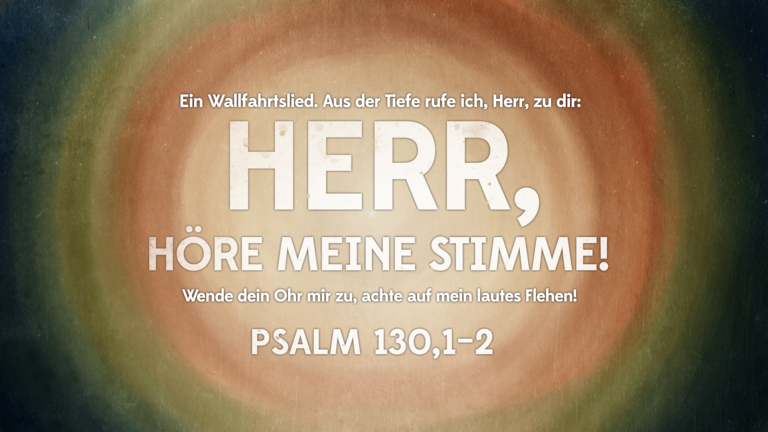
 und es gibt auch kein leeres Accu! Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Situation zu Jehovah beten! Es gibt auch keine Überlastung der Leitung, so dass wir zu einer späteren Zeit noch einmal anrufen müßten, weil auf der anderen Seite besetzt sei! Wir müssen uns auch nicht auf wenige Minuten beschränken.
und es gibt auch kein leeres Accu! Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Situation zu Jehovah beten! Es gibt auch keine Überlastung der Leitung, so dass wir zu einer späteren Zeit noch einmal anrufen müßten, weil auf der anderen Seite besetzt sei! Wir müssen uns auch nicht auf wenige Minuten beschränken. 
Neueste Kommentare