…wenn wir nicht Tiere ausrotten würden, nicht ständig „regulierend eingreifen“ würden?
Interessante Studie gefunden:
Raubtierrudel als Wildhüter
Wölfe pflegen Wildreservate durch Kontrolle des Wildbestands
Kleine und überwachte Wolfpopulationen können in Nationalparks und anderen Wildtier-Reservaten beschädigte Ökosysteme wiederherstellen. Wie US-Forscher bei der Untersuchung von drei Freilandprojekten festgestellt haben, darf dabei das Rudel nicht zu groß und der Lebensraum nicht zu klein sein. Wölfe haben eine positive Wirkung auf ihren natürlichen Lebensraum: Die Raubtiere verhindern die starke Vermehrung von Huftieren, die zu nachhaltigen Schäden an Bäumen und Sträuchern führt. Übernehmen die Wölfe die Kontrolle über Hirsche und Wildschafe, so steigert sich die pflanzliche Biomasse und die Pflanzenvielfalt erhöht sich wieder.
Bisher wurden Wölfe nur in sehr großen Gebieten wieder angesiedelt, in denen kaum Menschen leben und nur wenig Viehbestand vorhanden ist: Die Wolfpopulationen sollten sich erholen und dafür genügend Platz zur Verfügung haben. Die Wissenschaftler um Licht verschieben nun den Fokus von der Regeneration der Wolfpopulationen auf die Erholung der Ökosysteme. Die Forscher untersuchten dazu drei Fallstudien. Der bisher einzige Versuch in den USA, Wölfe zur Kontrolle von Huftieren einzusetzen, begann danach sehr erfolgreich, scheiterte aber am zu starken Wachstum der Wolfpopulation. In den zwei weiteren Projekten bremsten die verantwortlichen Stellen das Aussetzen von Wölfen in zwei US-Nationalparks: Die Gebiete waren nicht groß genug, um die Rudel zu ernähren.
Die Forscher schlagen deshalb die Einführung von kleinen, kontrollierten Wolfpopulationen vor, deren Individuen mit modernen Geoinformationssystemen jederzeit über Satellit geortet werden können. Die Größe des Rudels soll nach Empfehlung der Wissenschaftler über eine spezielle Art der Empfängnisverhütung reguliert werden, die Schwangerschaften über die körpereigene Immunabwehr verhindert. Außerdem raten sie, Zäune um die Wolfgebiete zu ziehen, um Nutztiere vor den Raubtieren zu schützen.
Ökosysteme würden von regulierten Wolfpopulationen stark profitieren, erklären die Forscher: Erstens hinterlassen Wölfe Aas, das ein wichtiges Nahrungsmittel für andere Fleischfresse darstellt. Zweitens senkt sich durch die Raubtiere die Zahl der Huftiere, wodurch sich die Schädigung der Pflanzenwelt durch Verbiss reduziert. Außerdem passen die Huftiere ihr Verhalten an das der Wölfe an: Um ihnen nicht zu begegnen, streifen sie weniger durch die Wälder und entlasten auch auf diese Weise die Flora. Als drittes sehen die Wissenschaftler einen ökonomischen und kulturellen Nutzen: Die Akzeptanz der Wölfe in der Bevölkerung könnte durch die gemanagten Rudel gesteigert werden, auch verbuchen Nationalparks wie der Yellowstone National Park eine deutliche Zunahme an Besuchern, seit dort wieder Wölfe beheimatet sind.
Daniel Licht (American Institute of Biological Sciences, Washington) et al.: BioScience, doi: 10.1525/bio.2010.60.2.9
ddp/wissenschaft.de – Regula Brassel






























































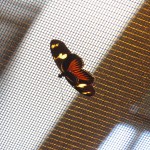




Neueste Kommentare